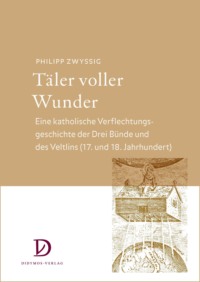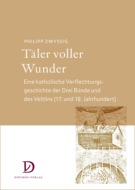Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 5
2. Translokaler Katholizismus: Akteure und kommunikative Praktiken
2.1. Translokaler Katholizismus: Begriffliche Annäherung
Das Bild, das der erste Hauptteil dieser Arbeit vom Bündner und Veltliner Katholizismus entwirft, ist ein anderes, als es die Lokalgeschichtsschreibung vermittelt. Dort erhält man fast ausschließlich Einblicke in die kontextbedingten Entwicklungen von Kirche und Glaubenspraxis, wobei fast immer das Prinzip der kommunalen Selbstregulierung als bestimmendes Wesenselement hervorgehoben wird.1 Unter diesem Gesichtspunkt erscheint der Katholizismus im rätischen Alpenraum der Frühen Neuzeit als selbstreferentieller Kosmos mit eigenen Logiken: Die Nachbarschaftsgemeinden bestimmten die konfessionell-katholische Identität weitgehend selbst,2 Glaubenspraxis und Frömmigkeitsvorstellungen standen ganz im Zeichen von kommunaler Sittenzucht und symbolischer Überhöhung der Dorfgemeinschaft.3 Äußere Einflüsse sind in dieser Perspektivierung auf die Rolle des Impulsgebers reduziert und stellten tendenziell ein die soziale Ruhe gefährdendes Element dar, was in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts offenkundig wurde, als die Habsburgermächte Österreich und Spanien-Mailand auf eine gewaltsame Rekatholisierung des rätischen Alpenraums drängten und die lokale Gesellschaft in einen Strudel von Gewalt und Gegengewalt gezogen wurde.4 Von dieser Sichtweise Abstand nehmend, stellt das hier zu entwerfende Bild des Bündner und Veltliner Katholizismus die Wechselwirkungen mit fremden Einflüssen als viel breiter, tiefgehender und längerfristig wirksam dar. Denn bei genauer Betrachtung lassen sich vielfältige Beziehungsstränge erkennen, die weit über die lokale Gesellschaft hinausreichten und den rätischen Alpenraum mit Personen, Institutionen und Gesellschaften im übrigen katholischen Europa verknüpften.
Weshalb braucht es eine solche gegen außen gerichtete Perspektive auf die katholische Gesellschaft im Alpenraum? Das entscheidende Argument liefert nicht etwa die Kirchen- oder Religionsgeschichte, sondern wirtschafts- und sozialhistorische Studien zur alpinen Arbeitsmigration.5 Sie haben gezeigt, dass der bemerkenswert hohe Grad an grenzüberschreitender Mobilität und überregionalen Austauschbeziehungen nicht allein mit der naturbedingten Ressourcenknappheit erklärt werden kann.6 Vielmehr sind die (saisonalen) Wanderungsbewegungen als Ausdruck großräumiger Integrationsprozesse zu verstehen. Der frühneuzeitliche Alpenraum war eingebunden in das europäische Wirtschaftssystem, das sich im Rahmen einer »regionalen Spezialisierung«7 in verschiedene Arbeits- und Produktemärkte ausdifferenzierte.8 Dass sich solche Verflechtungsprozesse auch in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen einstellten, ist plausibel, wurde bisher aber noch kaum untersucht.9 Für den ersten Hauptteil lässt sich daher erkenntnisleitend fragen, in welche überregionalen Bezugssysteme die katholische Gesellschaft im rätischen Alpenraum eingebettet war. Dabei wird nicht a priori davon ausgegangen, dass der Katholizismus im rätischen Alpenraum per se etwas Eigenständiges, spezifisch Bündnerisches oder Veltlinerisches ist, sondern es soll zunächst die Möglichkeit offen gelassen werden, dass er in kirchlich-institutioneller oder kulturell-religiöser Hinsicht dem eidgenössischen, österreichischen, (nord)italienischen oder vielleicht sogar dem französischen Katholizismus zuzuordnen ist oder – noch wahrscheinlicher – Berührungspunkte mit mehreren dieser Regionalkatholizismen aufweist.10
Dieser empirisch noch offenen Frage wird im Folgenden in einem ersten Kapitel nachgegangen, indem in verschiedensten Bereichen der katholischen Gesellschaft grenzübergreifende Bezüge aufgedeckt werden (2.2.1.–2.2.4.). Dabei lässt sich, soviel sei hier schon verraten, eine Entwicklung hin zu einer intensiver werdenden Verflechtung insbesondere mit dem Süden beobachten. Wenn in diesem Zusammenhang von Verflechtung gesprochen wird, dann sind damit die über die Grenzen der lokalen Gesellschaft hinweg verlaufenden Beziehungen von einer bestimmten Dauer und Verbindlichkeit gemeint. Sie sind in erster Linie personaler Art, das heißt sie beruhen auf sozialen Bindungen wie Verwandtschaft, Freundschaft, Landsmannschaft oder Patronage, können aber auch institutionalisierte Formen annehmen oder sich in kulturellen Interferenzen bemerkbar machen. Auf jeden Fall spielen dabei die Interaktionen von Personen oder Gruppen beziehungsweise die von ihnen in Gang gesetzten Transfers materieller wie immaterieller »Ressourcen«11 eine wichtige Rolle. Daraus folgt, dass der Blick auf den Katholizismus im rätischen Alpenraum in diesem ersten Hauptteil ein akteurszentrierter ist. Es wird gezeigt, welche Personen und Institutionen über welche kommunikativen Praktiken die Beziehungsstränge zwischen dem rätischen Alpenraum und externen Einflusssphären verdichteten und verstetigten (2.3.1.). Festgestellt werden kann dabei, dass sich über Medien wie Bittschriften oder Missionsberichte bestimmte Kommunikationszusammenhänge mit je eigenen Sprechweisen und semantischen Codes etablierten (2.3.2.). Wie zu zeigen sein wird, wurden diese semantischen Muster in den unterschiedlichsten Verhandlungssituationen aktiviert und von verschiedensten Akteuren situativ für die eigenen Interessen instrumentalisiert. Für die lokale Gesellschaft bedeutete dies, dass die intensivierten Verflechtungen in bestimmten Bereichen zwar durchaus neue Abhängigkeiten schufen, in vielen anderen aber ebenso neue Handlungsspielräume eröffneten. Angesichts dessen scheint es nicht länger angebracht, von einer auf sich selbst bezogenen katholischen Gesellschaft im rätischen Alpenraum auszugehen. Wenn in der vorliegenden Studie stattdessen von einem »translokalen Katholizismus« die Rede ist, sollen die Interdependenzen zwischen lokaler Gesellschaft und externen Akteuren und Institutionen betont werden.12 Der analytische Begriff der »Translokalität« ist hierfür geeignet, weil er den Fokus auf die grenzüberschreitenden Austauschbeziehungen lenkt, ohne dabei die lebensweltlichen Bezüge zu unterschätzen oder gar außer Acht zu lassen: Das Lokale steht nach wie vor im Zentrum des Interesses, wird nun aber in seinen Wechselwirkungen mit äußeren Einflüssen betrachtet.13
2.2. Intensivierte Verflechtung: Die grenzüberschreitenden Beziehungsgeflechte von Bündnispolitik und rätischer Mission
In diesem Kapitel geht es darum, ein Bewusstsein für das Eingebundensein von katholischer Kultur und Gesellschaft in weiträumige Beziehungsgeflechte zu entwickeln. Die mittlerweile hinlänglich bekannten Eckpunkte der Bündner und Veltliner Geschichte14 werden hierfür aus dem Blickwinkel der katholischen Außenbeziehungen neu ausgeleuchtet. Dem mit der Geschichte der Drei Bünde weniger vertrauten Leser sollen die Ausführungen damit auch Einblicke in die wichtigsten Entwicklungen von Politik, Kultur und Gesellschaft der Drei Bünde ermöglichen. Gleichzeitig wird ein Paradigmenwechsel vollzogen, indem der Einfluss von außen nicht auf die Bündnispolitik oder die offizielle Diplomatie beschränkt wird, sondern subtilere Formen der externen Einflussnahme,15 etwa die Förderung von religiöser Bildung und materieller Frömmigkeitskultur, in den Fokus rücken. Wir werden sehen, dass sich die in der gegenreformatorischen Ära der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aufgebauten Kooperationen zwischen fremden Mächten und dem katholischen Teil der Drei Bünde nachhaltiger auswirkten, als bislang angenommen wurde.16
2.2.1. Politisch-symbolische Verflechtung: Königliche Stifter und Schenker
Die Spurensuche nach großräumigen Verflechtungen katholischer Spielart soll dort beginnen, wo grenzüberschreitende Bezüge am offensichtlichsten sind: im Feld der politischen Außenbeziehungen. Die neuere Forschung hat aufgezeigt, wie wichtig die Bündnisse mit europäischen Königs- und Fürstenhäuser für die katholischen Orte der Eidgenossenschaft und für die Drei Bünde waren: Sie lenkten über Pensionen beachtliche finanzielle Mittel in sonst eher ressourcenschwache Gemeinwesen; wirtschaftliche Privilegien ermöglichten einen bevorzugten Zugang zu den Absatzmärkten in Venedig, Mailand, Lyon und anderswo; und der Solddienst respektive das Militärunternehmertum erhöhte das Sozial- und Ehrkapital einer neuen gesellschaftlichen Führungsschicht, die die politischen Ämter spätestens seit dem Ende des 16. Jahrhunderts dominierte.17 Da gleich mehrere Mächte um die Zugänge zu den Bündner Pässen und um Söldnerkontingente konkurrierten, bargen die politischen Außenverflechtungen aber auch erheblichen Konfliktstoff: Im 17. und noch im 18. Jahrhundert kam es in den Drei Bünden regelmäßig zu bewaffneten Erhebungen (sogenannten »Fähnlilupfen«), weil die Pensionsempfänger der einen fremden Macht den Einfluss einer anderen fürchteten und zu bekämpfen suchten.18 Diese politischen und gesellschaftlichen Folgen der Beziehungen zu auswärtigen Mächten sind mittlerweile gut erforscht. Noch wenig weiß man indessen über die kulturellen beziehungsweise religiösen Auswirkungen. Dieses Forschungsdesiderat aufnehmend, soll im Folgenden danach gefragt werden, inwiefern sich die politischen Außenbeziehungen auch in der religiösen Kultur bemerkbar machten.
Im Jahr 1602 konnte die französische Diplomatie einen Erfolg verbuchen. Nach zähen Verhandlungen und trotz spanischen Entgegenwirkens erneuerten die eidgenössischen Orte (vorerst noch ohne Zürich) und mit ihnen die Drei Bünde ihr Bündnis mit Frankreich.19 Genau aus dieser Zeit datiert ein schwarzes Messgewand aus dem Kirchenschatz der Churer Kathedrale (Abb. 35 und 36). Es zeigt die Wappen des französischen Königs Heinrich IV. und eines gewissen Méry de Vic, der von 1602 bis 1603 als französischer Resident in Chur Wesentliches zur erfolgreichen Bündniserneuerung beitrug.20 Das zeitliche Zusammenfallen der Bündniserneuerung und der Stiftung des Messgewandes ist augenfällig – war es aber auch zufällig? Wohl kaum, denn zwei Briefe Méry de Vics an den Kirchenpfleger der Wallfahrtskirche von Tirano, Oratio Venosta, vom August und September 1603 lassen dahinter eine programmatische Symbolpolitik zur Bekräftigung des nun vertraglich festgeschriebenen französischen Einflusses erahnen. In den besagten Briefen bedankte sich de Vic für die von Venosta erhaltenen Maße des Altarbildes, welches er im Namen des französischen Königs in Auftrag gegeben hatte.21 Zudem stellte er eine zunächst nicht näher bezifferte Pension in Aussicht, wenn sein königlicher Dienstherr täglich in die Gebete der in der Wallfahrtskirche von Tirano zelebrierten Messen miteingeschlossen würde. Einige Wochen später sandte de Vic 50 franchi nach Tirano und forderte Venosta abermals auf, jeden Tag zwei Gebete zu Ehren des französischen Königs in die Gottesdienste einfließen zu lassen.22 Gleichzeitig gab er Anweisungen für die Komposition des Bildes: Er wolle, so de Vic, den ihm vorgelegten Entwurf zwar nicht vollkommen ablehnen, sei aber der Meinung, es müsse die Himmelfahrt der Jungfrau Maria zusammen mit der heiligsten Dreifaltigkeit und dem Erzengel Michael abgebildet sein. Darunter müsse man deutlich das Wappen des »Allerchristlichsten Königs« erkennen können. Mit dem Entwurf war der französische Resident offenbar nicht restlos zufrieden, und so betonte er nachdrücklich, dass das Bild von einem »exzellenten Meister« gemalt werden müsse, bezahle er doch schließlich 70 Dukaten dafür.23 Das Bild müsse so gut gemalt sein, dass es auf dem Hochaltar ausgestellt werden könne. De Vic ging es insgesamt also darum, den französischen König am symbolisch wichtigsten Ort einer Kirche sowohl in Wort (in Form der am Altar gelesenen Messe) als auch in Bild (in Form des königlichen Wappens) in Szene zu setzten. Der Grund hierfür dürfte ein zweifacher gewesen sein: Erstens verspürte der zum Katholizismus konvertierte französische König Heinrich IV. womöglich stärker als andere katholische Fürsten einen religiösen Legitimationsdruck seiner Außenpolitik.24 Weil er nun eine Allianz mit den mehrheitlich protestantischen Drei Bünden eingegangen war, tat er gut daran, gegenüber den katholischen Veltlinern seine katholische Rechtgläubigkeit in Erinnerung zu rufen. Zweitens hat sich nur ein Jahr nach der Allianzerneuerung gezeigt, dass die französische Krone entgegen anderweitiger Vereinbarungen kein Monopol auf ein außenpolitisches Bündnis mit den Drei Bünden beanspruchen konnte. 1603 kam es nämlich zum Abschluss einer Allianz zwischen den Drei Bünden und Venedig, das Frankreich zunächst durchaus als Rivale wahrnahm, bald darauf allerdings als willkommenes Gegengewicht zum Einfluss Spanien-Mailands betrachtete. Angesichts der bündnispolitischen Konkurrenz schien es Méry de Vic und seinen Nachfolgern angebracht, an religiösen Zentren wie Tirano oder Chur den französischen Einfluss symbolisch und visuell ins Bewusstsein zu rufen.
Welche eminente Bedeutung fremde Mächte der symbolischen Präsenz im Kirchenraum beimaßen, und dass die Rivalität zwischen den europäischen Großmächten dabei eine entscheidende Rolle spielte, zeigte sich in den 1620er-Jahren. Bereits im April 1622 echauffierte sich der französische Ambassador Etienne Gueffier in einem Schreiben an den Churer Bischof darüber, dass die vom französischen König der Churer Kathedrale geschenkten silbernen Kerzenständer nur selten auf den wichtigen Altären – sprich auf jenen, an denen das Messopfer dargebracht werde – aufgestellt würden. Er müsse daher annehmen, dass sich der Bischof und die Chorherren in ihren Gebeten »nicht der Wohltat und der Freigiebigkeit des Königs erinnerten«, der doch so eifrig für den katholischen Glauben einstehe.25 Und als im Jahr 1624 dann auch die Bourbonenlilien aus der Kathedrale entfernt wurden, protestierte der französische Ambassador Robert de Myron vehement dagegen, indem er dem Bischof in Erinnerung rief, dass »der König, mein Herr, Euer bester alliierter Freund und Verbündeter ist«26. Beide Proteste zeigen: Die französischen Vertreter verstanden die Stiftungen und Schenkungen zugunsten kirchlicher Institutionen, mehr noch aber die dadurch ermöglichte symbolische Präsenz im Kirchenraum als Ausdruck und zugleich Mittel guter politischer Beziehungen.27 Wurden Kerzenständer und Wappen aus der Kathedrale entfernt, so musste dies vor diesem Hintergrund geradezu als Aufkündigung oder zumindest als Infragestellung des politischen Vertrauensverhältnisses interpretiert werden. Und in der Tat ist auffallend, dass sich die Bindungen zwischen der französischen Krone und dem Churer Domkapitel sowie den Drei Bünden insgesamt just in jener Zeit lockerten.28
Dass man in Chur Missstimmungen in der Beziehung zur französischen Krone in Kauf nahm, hatte vor allem auch damit zu tun, dass die mit Frankreich rivalisierenden Habsburgermächte Österreich und Spanien mit ihrer aktiven Interventionspolitik eine Machtverschiebung im Feld der Außenbeziehungen herbeiführten: 1620 nutzten sie den Aufstand der Veltliner gegen die Bündner Herrschaft dazu, das Veltlin, das Unterengadin und etwas später auch das Prättigau zu besetzen.29 In der Folge musste sich die Außenpolitik der Drei Bünde fast zwangsläufig auf die direkten Nachbarn Österreich-Tirol und Mailand ausrichten; die engen Beziehungen zu Frankreich erschienen unter diesen Umständen zunehmend als Hypothek. Bemerkenswert ist, dass wie zuvor die französische jetzt auch die spanische Krone großen Wert auf religiöse Handlungen und die Unterstützung lokaler Wallfahrtskulte legte. Im selben Jahr 1622, als der französische Ambassador den Churer Bischof ermahnte, die königlichen Kerzenständer auf den Altären auszustellen, inszenierte sich der spanische Gouverneur von Mailand wirkmächtig als Verteidiger des katholischen Glaubens, indem er das Gnadenbild aus der Kirche des Castello di Chiavenna eigenhändig zur Kollegiatskirche von Chiavenna überführte, um es vor den angeblich herannahenden Bündner Truppen zu retten.30 Diese symbolträchtige Handlung passte gut zur Legitimation der spanischen Veltlinpolitik, für die vorwiegend mit der Protektion der Katholiken gegenüber den »häretischen« Bündnern argumentiert wurde.31
Gerade im Veltlin, dem sowohl die Habsburgermächte als auch Frankreich wegen der Passübergänge eine geostrategische Schlüsselposition zuerkannten, vermochten die außenpolitischen Verstrickungen der Drei Bünde die Frömmigkeitskultur entscheidend mitzuprägen. Die beiden wichtigsten religiösen Zentren in der Region, die Wallfahrtskirchen von Tirano und Gallivaggio, profitierten von beachtlichen Zuwendungen entweder von französischer oder spanischer Seite. Für den französischen König und seine Familie wurde in Tirano jeden Mittwoch eine Gedenkmesse gelesen. Die dafür zur Verfügung stehende (jährliche) Pension wurde 1622 von 50 auf 70, 1636 dann auf 100 franchi erhöht.32 Ebenfalls 1636 stiftete Kardinal Richelieu, der erste Minister des französischen Königs, für die Wallfahrtskirche von Tirano eine Garnitur kostbarer Messtextilien, die seine Wappen trugen (Abb. 37 und 38). Laut Stiftungsurkunde tat er dies »zum Zeugnis seiner Frömmigkeit und als Dank für den Sieg, welcher die Armeen Seiner Majestät bei der Protektion des Tals errungen haben«33. Hier deutet sich abermals an, dass diese Stiftungen im Kontext der Rivalität mit Spanien zu verorten sind, die ab 1624 und nochmals ab 1635 in einen bewaffneten Konflikt um das Veltlin ausartete.34 Weil Frankreich mit den protestantischen Bündnern kooperierte und bereit war, das katholische Veltlin wieder der Bündner Herrschaft zu unterstellen, litt die französische Politik an einem latenten konfessionellen Legitimationsdefizit, das sie durch fromme Stiftungen zu kompensieren versuchte. Zudem waren religiöse Stiftungen und Handlungen in einer Zeit, in der Gott als historischer Akteur wahrgenommen wurde, der aktiv ins Weltgeschehen eingreift und mitunter auch Kriege entscheidet, ein erweitertes Mittel der Politik und gehörten wie diplomatische Verhandlungen oder Krieg zum Repertoire staatlicher Machtausübung. Politik wurde in der Frühen Neuzeit damit nicht nur im Sinne einer Religions- oder Konfessionspolitik für Gott, sondern vor allem auch mit Gott gemacht.35 Folglich waren die in Tirano für das französische Königshaus gelesenen Messen darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Gott und der französischen Krone zu intensivieren und eine schlagfertige Koalition himmlischer und irdischer Mächte gegen den spanischen Feind zu schmieden. Dazu passt, dass die Wallfahrtskirche von Tirano im Verlaufe der französischen Militäroperationen regelrecht zu einem französischen Erinnerungsort geworden war. Da dort jeweils am Mittwoch die französische Königsfamilie mit einer Messe geehrt wurde, wollten viele französische Offiziere, die in den Gefechten mit den spanischen Truppen ums Leben kamen, in der Kirche der Madonna von Tirano bestattet werden, auch »wenn sie weit weg von Tirano starben«36. Die teils monumentalen Grabplatten, auf denen die Verdienste der meist adligen Offiziere für die französische Krone hervorgehoben wurden, fanden ihren Platz an den Kirchenwänden (Abb. 39), womit die französische Präsenz in der Wallfahrtskirche im Verlaufe des Krieges sichtbar zunahm.37 Für viele der Offiziere wurden außerdem jährliche Gedenkgottesdienste abgehalten, wobei meistens die von Richelieu gestifteten Messtextilien zum Einsatz kamen und eine Kollekte zugunsten des »Allerchristlichsten Königs« aufgenommen wurde.38 Die Berühmtheit und die außergewöhnliche Opulenz der Wallfahrtskirche der Madonna di Tirano sind ein Stück weit auch auf diese französische Präsenz zurückzuführen.
Was Tirano für die französische Krone war, stellte die Wallfahrtskirche von Gallivaggio in der Grafschaft Chiavenna für die Vertreter des spanischen Herzogtums Mailand dar: ein religiöses Zentrum, wo mit Stiftungen und Schenkungen die konfessionelle Rechtmäßigkeit des eigenen politischen Handelns demonstrativ bekräftigt werden konnte. Bei jeder Durchreise von Mailand nach Chur und umgekehrt besuchten die spanischen Gesandten bei den Drei Bünden den Wallfahrtsort.39 Luigi Panizza, der spanische Gouverneur der Festung Fuentes, von wo aus Mailand den Zugang zum Veltlin kontrollierte, stiftete 1640 der Wallfahrtskirche eine große Lampe aus Silber, für deren Öl er in Mailand ein Kapital anlegte.40 Auch der große Platz vor der Kirche ließ Panizza auf seine Kosten herrichten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Spanien den Machtkampf mit Frankreich zu seinen Gunsten entschieden, mit dem sogenannten Mailänder Kapitulat von 1639 das Veltlin wieder den Drei Bünden zurückgegeben und gleichzeitig seinen Einfluss in der Region vertraglich festgeschrieben.41 Gleichsam als sinnhafter Ausdruck dieser außenpolitischen Machtverschiebung zugunsten Spaniens stiftete Panizza auch für die Wallfahrtskirche von Tirano eine kostbare Öllampe,42 obwohl – oder vielleicht gerade weil – dort noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein eine wöchentliche Messe43 für den französischen König gelesen wurde.
In einer Zeit, in der die Konkurrenz um politischen Einfluss geringer war, verlor die ostentative Präsenz in Kirchenräumen an Bedeutung,44 nicht jedoch die Unterstützung des Katholizismus vonseiten auswärtiger Mächte an sich. Letztere verlagerte sich indessen auf weniger öffentlichkeitswirksame Bereiche. Sie blieb wichtig, weil damit dem Vorwurf begegnet werden konnte, politische Bündnisse mit den mehrheitlich protestantischen Bündnern, wie dasjenige zwischen den Drei Bünden und Spanien von 1639, würden einem Verrat an der eigenen Konfession gleichkommen. Zu offensichtlich durfte sie aber auch nicht sein, um bei den verbündeten Protestanten keinen Anstoß zu erregen.45 Und so verschob sich die fremde Unterstützung für die Bündner Katholiken aus pragmatischen Gründen auf die Hinterbühne der Politik. 1641 stiftete der spanische König der katholischen Schule im Churer Dominikanerkloster einen Ofen, für dessen Holz die »spanischen Minister«46 aufkamen. Außerdem sicherte Madrid nach langen Verhandlungen eine jährliche Pension von 200 scudi für den Unterhalt eines Lehrers zu.47 Im wahrsten Sinne des Wortes getätigt für ein Hinterzimmer, besaß diese Stiftung kaum einen repräsentativen Charakter. Glaubt man aber dem Nuntius, so war sie dennoch ein besonders frommes Werk: Zur »Propagierung des katholischen Glaubens ist nichts nützlicher als die Einführung von Schulen«, schrieb er in einem für die Kurie in Rom verfassten Bericht.48 Nicht nur könne man so gute Pfarrer und Prediger ausbilden, sondern auch geeignete Politiker. Denn da es sich bei den Drei Bünden um repubbliche popolari, um vom Volk gelenkte Republiken, handle, sei es für den katholischen Glauben von großem Nutzen, wenn die Katholiken gebildet seien und sich folglich auf den politischen Versammlungen argumentativ gegen die Protestanten zur Wehr zu setzen verstünden. Seien die Katholiken schon nicht in der Mehrheit, so würden sie so die Protestanten wenigsten in Gelehrsamkeit und Ansehen übertreffen. In diesem Licht betrachtet, barg auch die abseits des öffentlichen Raums getätigte Stiftung einen wichtigen symbolischen Gehalt: Sie bewies, dass die spanische Krone auch nach der Allianz mit den Drei Bünden von 1639 nach konfessionspolitischen Gesichtspunkten handelte und den Katholizismus im rätischen Alpenraum nach Möglichkeiten unterstützte.49 Und so ist es denn auch zu erklären, dass der spanische Gouverneur von Mailand 100 fiorini (Gulden), der spanische Gesandte Francesco Casati etwas mehr als 30, ein anderer Graf Casati 22 und der Inquisitor von Mailand etwas mehr als 33 Gulden zur Renovierung der Schulräumlichkeiten im Churer Dominikanerkloster beisteuerten.50
Festzuhalten ist, dass sich das Eingreifen fremder Mächte in die kirchlich-konfessionellen Verhältnisse der Drei Bünde spätestens seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf solche »weiche« Mittel wie die eben geschilderte Unterstützung für die Schule von Chur beschränkte. Die Zeit der Gegenreformation, als vor allem die Habsburgermächte ihr militärisches Eingreifen mit dem Kampf gegen den protestantischen Einfluss rechtfertigen konnten, war nun definitiv vorbei. Doch auch auf diese subtilere Weise ließ sich Beziehungspolitik im weiteren, Machtpolitik im engeren Sinne betreiben, wie das Beispiel Österreichs, der seit dem Spanischen Erbfolgekrieg einflussreichsten Großmacht in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Drei Bünden, zeigt. Um 1720 schenkte Johann Baptist Wenser, der österreichische Gesandte bei den Drei Bünden, der Kirche Mariae Geburt in Rhäzüns ein großformatiges, in einen opulenten Goldrahmen eingefasstes Gemälde des Johannes von Nepomuk (Abb. 31 und 33).51 Weder der Ort der Schenkung noch das Bildsujet waren zufällig. Noch bis 1809 gehörte die Herrschaft Rhäzüns zu Österreich. Seit 1696 stand sie direkt unter habsburgisch-österreichischer Verwaltung, nachdem sie zuvor jeweils einheimischen Lehnsempfängern verpfändet worden war.52 Mit diesem Wechsel in der Herrschaftsverwaltung ging eine Intensivierung der herrschaftlichen Repräsentation einher, wobei die 1697 wohl eigens hierfür erbaute Kirche Mariae Geburt den Kristallisationspunkt bildete: Über dem Hochaltarbild thront bis heute ein großes, von zwei goldenen Reichsadlern gehaltenes Wappen Österreichs (Abb. 31 und 32). Der rechte Seitenaltar trägt das Wappen von Antonius von Rost, dem Vorgänger Wensers als österreichischer Verwalter der Herrschaft Rhäzüns, der linke dasjenige des mit Österreich eng verbundenen Churer Bischofs Ulrich VII. von Federspiel (1692–1728)53. In dieses repräsentative Programm fügte sich das von Wenser gestiftete Nepomuk-Gemälde bestens ein, denn der heilige Johannes von Nepomuk wurde gerade um 1720 von der österreichischen Monarchie als »nationaler« Schutzpatron aufgebaut und seine Verehrung in die Pietas Austriaca, in die österreichspezifische Frömmigkeitskultur, eingefügt.54 Mit allen Mitteln forcierte der Kaiser die Seligsprechung des bereits im 14. Jahrhundert verstorbenen Johannes von Nepomuk, die dann 1721 tatsächlich erfolgte. Auch der Bischof von Chur war aufgefordert worden, er möge in Rom »zur Beschleinigung dieses processus etwa durch ein Handtschreiben aus Eigener bewegung« vorstellig werden.55
Wir werden unten auf die Nepomuk-Verehrung im rätischen Alpenraum zurückkommen. An dieser Stelle soll die Feststellung genügen, dass die Bekanntmachung dieses Heiligen in den Drei Bünden vor allem auch das Verdienst der österreichischen Gesandten und Repräsentanten war.56 So unterstützte Johann Baptist Wenser 1727 die Drucklegung einer rätoromanischen Vita des Heiligen;57 ein Jahr später ließ der österreichische Verwalter auf Schloss Rhäzüns eine Brückenkapelle erbauen, die Nepomuk geweiht war.58 Sicherlich hatten solche Initiativen zu einem bedeutenden Teil ihren Ursprung in der persönlichen Frömmigkeit beziehungsweise in der persönlichen Verehrung für den Heiligen. Gerade bei Heiligen, die stark »national« konnotiert waren, müssen sie aber auch als Medium der symbolischen Repräsentation von Herrschaft oder zumindest von politischem Einfluss verstanden werden. Dass der Nepomuk-Kult einen Rahmen bot, um klienteläre Beziehungsnetze aufzubauen, die wiederum die Einflussnahme auf Politik und Kirche erleichterten, lässt der sogenannte »Nepomucenische Bund«59, gegründet 1758 in der Kathedrale von Chur, erahnen. Eine Besonderheit dieser Bruderschaft war, dass sie aus zwei verschiedenen Abteilungen mit je unterschiedlichen Pflichten bestand: einer herkömmlichen »Bruderschaft« für gewöhnliche Laien und einem »Nepomucenischen Bund«, dessen »Banden« »enger verstricket«60 waren. Den Mitgliedern des »Bundes« waren strengere Pflichten auferlegt, etwa, dass sie entweder selbst zwei Messen lesen oder wenigsten lesen lassen mussten, ferner dass ihnen das Geldopfer nicht freigestellt war: Sie waren verpflichtet, zwei Gulden Churer Währung in die Bruderschaftskasse einzubezahlen.61 Diese Auflagen und weitere Hinweise aus dem Bruderschaftsbuch lassen den Schluss zu, dass sich im »Nepomucenischen Bund« vor allem die kirchliche Elite (sprich das Domkapitel und weitere kirchliche Amtsträger), darunter mehrere Mitglieder des Tirolers Adelsgeschlecht von Buol-Schauenstein62, aber auch einflussreiche weltliche Magistraten versammelten.63 Auffallend ist, dass viele der eingeschriebenen Mitglieder des Bundes einen Österreichbezug aufwiesen oder sogar aus dessen Herrschaftsgebiet stammten. Einzelheiten lassen sich leider nicht mehr rekonstruieren, da das vollständige Mitgliederverzeichnis beim Brand des bischöflichen Hofes 1811 zerstört worden ist. Aus der kurzen Mitgliederliste, die der damalige Archivar offenbar aus dem Gedächtnis angefertigt hat, wissen wir jedoch, dass im »Nepomucenischen Bund« »Brüder und Schwestern aus Tÿrol, Voralberg, Schweiz und anderen Gegenden nicht minder, als aus hiesigen Landen, und zwar in den ersten Jahren sehr zahlreich eingetragen waren«64. Insofern darf angenommen werden, dass diese religiöse Vereinigung der seit dem frühen 18. Jahrhundert »zunehmend engere[n] Bindung des [Churer] Hochstifts an Österreich«65 einen institutionellen Rahmen verlieh. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass die Verbreitung des Nepomuk-Kultes im rätischen Alpenraum seit etwa 1720, ausgedrückt in zahlreichen Nepomuk-Kapellen, -Bildern, -Statuen und -Büchern, ein eminent politischer Vorgang war. Er zeigte an, dass Österreich offenbar in der Lage war, nicht nur die Politik, sondern auch Kultur und Religion der Drei Bünde mitzugestalten.66
Für den Gang der weiteren Argumentation gilt es zwei Beobachtungen in Erinnerung zu halten: Erstens wetteiferten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts fremde Mächte um politischen Einfluss in den Drei Bünden, und sie taten dies nicht nur mit politisch-diplomatischen oder militärischen Mitteln, sondern auch über eine wirkungsvolle symbolische Repräsentation an wichtigen religiösen Zentren.67 Zweitens schwächte sich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Konkurrenzkampf zwar ab, die Einflussnahme auswärtiger Mächte verschwand damit aber keineswegs. Vielmehr nahm ihre Tiefenwirkung noch zu, da nun versucht wurde, durch finanzielle oder anderweitige Unterstützung die katholische Gesellschaft (etwa durch ein erweitertes Schulangebot) und die religiöse Kultur (durch Förderung neuer Heiligenkulte) grundlegend und auf lange Sicht mitzuprägen. In den nächsten Kapiteln werden wir sehen, in welchen Bereichen sich diese zunächst auf der politischen Ebene eingestellten Verflechtungen mit auswärtigen Machtblöcken längerfristig auswirkten.