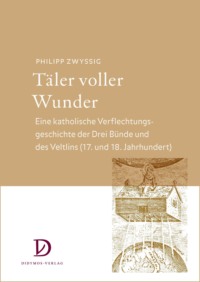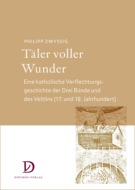Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 6
2.2.2. Finanzielle Verflechtung: Die rätische Mission
Für die 1622 von Papst Gregor XV. (1621–1623) neugegründete Kurienkongregation de Propaganda Fide war die ein Jahr zuvor ins Leben gerufene »rätische Mission«68 des Kapuzinerordens so etwas wie ein Prestigeprojekt. Die gemischtkonfessionellen, mit ihren Untertanengebieten unmittelbar an Italien angrenzenden Drei Bünde waren geradezu prädestiniert, um als Testfeld für eine der Hauptaufgaben der Propagandakongregation zu fungieren: die Stärkung des Katholizismus in Gegenden, die »häretischen« oder »schismatischen« Einflüssen ausgesetzt waren (Abb. 4).69 In den ersten Jahren ihres Bestehens gedachte die Propagandakongregation dieses Ziel zu erfüllen, indem sie eine streng gegenreformatorische Missionsstrategie verfolgte, das heißt die protestantisch gewordenen Gebiete im rätischen Alpenraum zu rekatholisieren versuchte. Im Unterengadin, Münstertal und Prättigau war dies seit der österreichischen Invasion von 1621 möglich. Faustino da Brescia, der oberste Kapuziner der Ordensprovinz Brescia und als solcher gleichzeitig auch Präfekt70 der rätischen Mission, beschrieb rückblickend die Hauptaufgabe der Mission in den ersten Jahrzehnten wie folgt:
»Es sind nun ca. 20 Jahre vergangen, seit unsere Provinz von Brescia auf Befehl des heiligen Apostolischen Stuhls eine Mission im Unterengadin eingerichtet hat, bestimmt zur Konversion der Häretiker, welche im Verlaufe der Zeit sich im Land der Herren Graubündner ausgebreitet haben, wo die Häresie am meisten Schaden anrichtete und der katholische Glauben größter Gefahr entgegenging; und bis jetzt haben sich unsere Patres treu abgemüht im Bebauen dieses Feldes, das schon so viele Jahre brachlag, und sie haben eine reiche Ernte an Seelen eingefahren, die von der Häresie konvertiert sind und nun wieder in die Tenne Gottes, die Heilige Katholische Kirche, gebracht wurden; und so haben sie den [katholischen] Gottesdienst dort wieder eingeführt, wo er verfallen war.«71
Diese gegenreformatorischen Missionstätigkeiten waren in hohem Maße abhängig von externer Hilfe. Die Ermordung des Missionsvorstehers der »helvetischen« Kapuzinerprovinz, Fidelis von Sigmaringen (Abb. 23), im April 1622 hatte deutlich und aus katholischer Sicht schmerzvoll gezeigt, dass ohne militärischen Schutz katholischer Potentaten die Mission sich nicht würde halten können.72 Darüber hinaus waren die Verbindungen der rätischen Mission sowohl zu auswärtigen Fürstenhäusern wie auch zur päpstlichen Kurie wichtig, um eine genügend große Ressourcengrundlage für den Unterhalt der Missionare und die Ausstattung von Missionshospizen zu schaffen. Denn zum einen blieb der Zugang zu lokalen Ressourcen in der Regel schwierig,73 weil der Einfluss der reformierten Kirche trotz Verbot der österreichischen Besatzung im Unterengadin ungebrochen war und den Protestanten seit dem Feldkircher Vertrag zwischen den Drei Bünden und Österreich von 1641 die Ausübung ihres Glaubens dort wieder gestattet war.74 Und zum anderen blieben die Hospize der rätischen Mission stets so klein, dass sich keine eigentliche Missionsökonomie wie etwa in der außereuropäischen Mission entwickeln konnte.75 Dazu kam es ansatzweise lediglich in den neugegründeten Kapuzinerklöstern von Tirano (1627), Sondrio (1628), Morbegno (1632) und Chiavenna (1640), die dann tatsächlich eine wichtige Funktion sowohl für die Ausbildung wie auch für die ökonomische Versorgung der Missionare übernahmen.76 Stärker als in anderen Missionen77 dürften in der rätischen Mission daher die finanziellen Zuwendungen von außen – vor allem vonseiten auswärtiger Potentaten – von geradezu existenzieller Bedeutung gewesen sein. Wenn im Folgenden diese finanzielle Verflechtung der rätischen Mission zu beschreiben versucht wird, dann geschieht dies, ohne dass auf genaue Zahlen beziehungsweise ökonomische Quellen wie Rechnungs- oder Haushaltsbücher zurückgegriffen werden kann. Folglich kann und soll es nur darum gehen, mithilfe von Korrespondenzen und Missionsberichten die ungefähren Dimensionen dieser grenzüberschreitenden Geldflüsse zu umreißen. Selbstverständlich gilt zu beachten, dass dieser Blick auf die finanziellen Verstrickungen ein holzschnittartiger ist und dass die transferierten finanziellen Ressourcen stets nicht nur materiellen, sondern mitunter auch symbolischen Wert haben konnten, etwa, wenn der Geldfluss als Ausdruck von »guten« politischen oder institutionellen Beziehungen verstanden wurde. Solche Zusammenhänge zu diskutieren, wird es später noch Gelegenheit geben; in diesem Kapitel soll nun zunächst geklärt werden, aus welchen verschiedenen Einflusssphären die rätische Mission finanzielle Unterstützung erhielt.
Erste Anlaufstelle für die Suche nach Donatoren war die päpstliche Kurie, genauer: die Kongregation de Propaganda Fide, der die Aufsicht über die rätische Mission oblag. Sie war einerseits in der Lage, Finanzmittel aus der Kasse des Papstes zu mobilisieren, andererseits verfügte sie dank des kurialen Beziehungsnetzes über die Möglichkeit, weitere geistliche und weltliche Mächte zur Unterstützung für das Missionswerk zu bewegen. Im Sommer 1624 übersandte die Propagandakongregation dem Nuntius in Luzern 100 scudi, um damit Wein für die Kapuzinermissionare im Engadin zu kaufen.78 Weitere solche punktuellen Zahlungen wurden in den folgenden Jahren regelmäßig getätigt. Allerdings mussten die Kapuziner jedes Mal ausdrücklich darum bitten.79 Die entsprechenden Suppliken zeigen, mit welchen Argumenten die Kapuziner auf fremde finanzielle Hilfe drängten: Das Betteln in dieser armen Gegend sei frustrierend und ohnehin bleibe hierfür schlicht keine Zeit, schrieb Pater Damiano da Nozza 1640 nach Rom. Zudem gebe es im Missionsgebiet keine Person, der man wirklich vertrauen könne. Es sei daher sinnvoll, dass man in Italien für jedes Missionshospiz eine vertrauenswürdige, finanziell potente Person als Gönner suche.80 Und ein anderer Missionar schlug 1641 vor, die päpstliche Kurie solle allen Bischöfen Italiens den Befehl erteilen, an einem Sonntag in den Fastenwochen Almosen für die rätische Mission und die bedrängten Bündner Katholiken zu sammeln.81
Fast noch wichtiger als für die Kapuzinermission im protestantischen Unterengadin waren die Subsidien aus Rom für die gemischtkonfessionellen Gemeinden. Aufgrund der geteilten Pfarrpfrund war es solchen Gemeinden oft nicht möglich, einen Pfarrer anzustellen. Aus diesem Grund bildete die Propaganda Fide in ihrem Priesterseminar (Collegio Urbano) junge Bündner und Veltliner aus, die sie später, ausgerüstet mit jährlichen Alimenten, als Apostolische Missionare in diese paritätischen Gemeinden schickte.82 1623 erhielt ein gewisser Paganino Gaudenzi 100 scudi, nachdem er in sein Heimatdorf Poschiavo zurückgekehrt war, wo seit 1620 sowohl eine katholische als auch eine protestantische Kirche existierte.83 1646 alimentierte die Propagandakongregation den Pfarrer des gemischtkonfessionellen Zizers mit 25 Gulden; gleichzeitig vergab sie Stipendien an die Bündner Christian Arpagaus und Ulrich Bertogg, damit diese ein Theologiestudium in Rom aufnehmen konnten.84
Während die finanziellen Zuwendungen aus Rom zwar zögerlich, dafür aber über einen langen Zeitraum – noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein – in der rätischen Mission eintrafen, dauerte die weltliche Unterstützung für die Mission meist nur solange, wie die entsprechende Großmacht politischen Einfluss in der Region geltend machen konnte. Aus den Missionsquellen geht hervor, dass vor allem in der Anfangszeit der Mission die materiellen Zuwendungen aus der Republik Venedig recht umfangreich gewesen sein mussten. Die genaue Herkunft dieser Gelder lässt sich dabei nicht in aller Einzelheit aufschlüsseln. Ein Teil davon stammte offenbar aus den Staatsgeldern Venedigs und wurde im Rahmen der Pensionszahlungen an die Drei Bünde respektive den Churer Bischof ausbezahlt.85 Vom Umfang her waren diese »vielen Subsidien aus dem Staate Venedig« zumindest so bedeutend, dass der Nuntius in Luzern sich besorgt nach Rom wandte, als 1669 die Zahlungen aufgrund des 6. Venezianischen Türkenkrieges ausgeblieben waren.86 Darüber hinaus stammte wohl ein nicht zu unterschätzender Teil der in den Quellen als »venezianisch« bezeichneten Geldern von privaten Gönnern, wobei diese Gelder wahrscheinlich meist über die Netzwerke der Kapuzinerklöster aus der Ordensprovinz Brescia, welcher anfänglich die meisten Missionare angehörten, aufgetrieben wurden.
Neben Venedig unterstützte auch Frankreich, das seit 1624 aktiv und militärisch in das Ringen um den geostrategisch bedeutenden rätischen Alpenraum eingriff, die Kapuzinermission. Konkret ließ der französische Befehlshaber François-Annibal d’Estrées, Marquis de Coeuvres (1573–1670), den Missionaren in Chur 30 Gulden zukommen;87 den Bau des Kapuzinerklosters von Tirano (1627), das als Rückzugsort für die Missionare im Engadin dienen sollte, finanzierte er gemeinsam mit dem venezianischen Gesandten.88 Dass sich Frankreich gegen die Mission ausgesprochen hätte, weil sie zu Beginn – wie bereits gezeigt – eng mit der militärischen Intervention der Habsburger verflochten war, wie dies vielleicht ein moderner Betrachter erwarten würde, war somit nicht der Fall. Dafür war der Preis zu hoch: Aus legitimatorischen Gründen konnte ein katholischer Fürst nicht anders, als sich hinter die »Apostolische Mission« zu stellen, wollte er den Kontrahenten nicht die Gelegenheit geben, sich als alleinige Verfechter des »wahren« Glaubens in Szene zu setzten und das Handeln der anderen als bloße Machtpolitik zu diskreditieren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es innerhalb der Mission keine Spannungen zwischen den unterschiedlichen Einflusssphären gegeben hätte. Tatsächlich verliefen die Gräben zwischen den verschiedenen an der Mission beteiligten Ordensprovinzen häufig entlang der außenpolitischen Gegensätze.89
Politisch-rechtlich betrachtet waren die soeben aufgedeckten finanziellen Verflechtungen mit fremden Mächten und der Propagandakongregation nicht ohne Brisanz, richtete sich doch der um die zweiten Ilanzer Artikel von 1526 ergänzte Bundesbrief ausdrücklich gegen fremde Einflüsse in kirchlich-religiösen Belangen.90 Bezugnehmend auf diesen verfassungsrechtlichen Grundsatz forderte die evangelisch-rätische Synode im Herbst 1641 die Ausweisung der Kapuziner aus den Drei Bünden sowie ein »Verbot jeglicher Einmischung fremder Fürsten in Bundes- wie Religionsangelegenheiten«91. Die Katholiken entgegneten, dass »die Ordensgeistlichen ihren Unterhalt durch die Almosen fremder Fürsten bestreiten«, bringe »keinen Schaden, sondern Nutzen und Ehre«92; und außerdem würden die Katholiken auch nicht danach fragen, wie sich die protestantischen Prediger finanzierten. Dass katholische Kreise in der Folge die Ausweisung der Kapuziner zu verhindern versuchten, indem sie fremde Gelder als Mittel der politischen Einflussnahme einsetzten, war eine Ironie der Geschichte und zugleich eine Konsequenz der politischen Kultur der Drei Bünde: Der Mailänder Erzbischof Cesare Monti (1632–1650) ließ verlauten, die Mailänder Pensionen erachte er als »das nützlichste Mittel«, um einen Entscheid der Bundestage in die gewünschte Richtung zu lenken, weil sich mit ihnen »die Katholiken animieren und die Häretiker zügeln« ließen.93 Doch trotz aller Gegenwehr ist es den Protestanten letztlich bis 1650 gelungen, die mit fremden Geldern finanzierten Kapuzinermissionare per Bundestagsbeschluss aus allen evangelischen und den meisten gemischtkonfessionellen Gemeinden auszuweisen.94 In Anbetracht dessen wuchs bei den zuständigen Kircheninstanzen die Einsicht, dass die von Rom vorgegebenen Missionsziele einer grundlegenden Anpassung bedürfen. Der Luzerner Nuntius Carlo Carafa formulierte es so:
»Da die Kapuziner durch die Gewalt der Häretiker gezwungen wurden, alle Ortschaften gemischter Religion zu verlassen und sich in diejenigen Ortschaften zurückzuziehen, welche vollständig katholisch sind, bleibt ihnen keinen Platz mehr, um Protestanten zu konvertieren, und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die [katholischen] Kirchen zu verschönern und [für die Katholiken] gute Pfarrer zu sein.«95
Bereits 1654 konnte Nuntius Carafa nach Rom vermelden, die innerkatholische Mission habe der katholischen Kirche im rätischen Alpenraum »einen großen Gewinn« gebracht. Viele Kirchen seien restauriert, andere neu errichtet worden, die Kirchengüter und Pfarrpfründe habe man neu angereichert, die Kinder in den »wahren und guten Grundsätzen unseres heiligen Glaubens« unterrichtet und viele »Schismen« und »falsche Glaubensgrundsätze« beseitigt.96 Diesen raschen Erfolg der Mission in katholischen Gemeinden erklärte man sich mit der substanziellen Hilfe von außen: Nach mehreren Zusammenkünften zwischen dem Nuntius und dem Churer Bischof auf der einen, dem Mailänder Senator Casnedi und dem Ambassador Francesco Casati auf der anderen Seite, habe Senator Casnedi angeboten, für den Unterhalt der Kapuzinermissionare aufzukommen.97 Casnedi, das sei hier dazwischen geschoben, stammte aus Domaso am oberen Ende des Comersees in unmittelbarer Nähe zum Veltlin und war bekannt für seine Affinität zum Katholizismus im rätischen Alpenraum: Mit Vorliebe pilgerte er etwa zur Wallfahrtskirche von Tirano.98 Zudem hatte er als mit den Veltliner Verhältnissen bestens vertrauter Informant einen entscheidenden Part in der Mailänder Drei-Bünde-Politik übernommen: 1633 entsandte ihn der Mailänder Gouverneur nach Chur, um Klienten für die spanische Krone anzuwerben und eine allfällige Allianz in die Wege zu leiten.99 1637 führte er in Alessandria die Verhandlungen mit den Drei Bünden, die letztlich 1639 in die Rückgabe des Veltlins an die Bündner (Mailänder Kapitulat) und in den »ewigen Frieden« zwischen Spanien und den Drei Bünden mündeten.100 Und nun machte sich Casnedi 1654 also auch für die rätische Kapuzinermission stark. Über ein Legat aus der Hinterlassenschaft seines verstorbenen Vaters stellte er den Unterhalt von acht Missionsstationen mit insgesamt zweiunddreißig Missionaren sicher.101 Allerdings knüpfte er seine Unterstützung an Bedingungen, die er für eine erfolgreiche Mission für notwendig hielt. So war er der Meinung, die Kapuzinermission müsse gleichmäßiger als bisher auf die Ordensprovinzen aufgeteilt werden.102 Dass Casnedi damit den Einfluss der Mailänder Kapuziner auf die rätische Mission stärken wollte, liegt nahe. Denn obschon in den deutschsprachigen Gemeinden rund um Chur Kapuziner aus der »helvetischen Provinz«103 und in den katholischen Tälern Misox und Calanca seit den 1630er-Jahren Ordensbrüder aus Mailand104 missionierten, dominierten die Kapuziner aus der Provinz Brescia die rätische Mission, was gelegentlich zu Konflikten und Kompetenzstreitigkeiten führte.105 Um solche zu vermeiden, schlug Casnedi vor, die Propagandakongregation solle die operative Leitung der Mission selbst übernehmen beziehungsweise einen Präfekten für die ganze rätische Mission ernennen, dem die Kapuziner aus allen Provinzen rechenschaftspflichtig sein sollten.
Während diese Forderung Casnedis letztlich ohne Folge blieb, wirkten sich seine finanziellen Zuwendungen unmittelbar und nachhaltig auf die Mission aus. Im Oberhalbstein statteten die Kapuziner viele Kirchen mit kostbaren Kelchen, Gefäßen, Messgewändern etc. aus, die aus dem Legat Casnedis bezahlt wurden. Wir wissen davon, weil die Talgemeinde Oberhalbstein zum Dank dafür eine Stiftung für einen alljährlichen Memorialgottesdienst zugunsten von Casnedi und seiner Familie einrichten ließ.106 Nachhaltig war die finanzielle Hilfe des Mailänder Senators damit einerseits, weil sie sich auf lange Sicht einschrieb in die katholische Frömmigkeitskultur im Missionsgebiet und dieser ein mailändisches Gepräge verlieh. Bezeichnend ist etwa, dass die Kirche von Cunter im Oberhalbstein dem Mailänder Heiligen Carlo Borromeo geweiht wurde. Nachhaltig war Casnedis finanzielle Unterstützung andererseits aber auch, weil sie nicht mit seinem Tod im Jahr 1660 endete. Schon 1649 hatte er nämlich testamentarisch eine »fromme Stiftung« (legato pio) errichten lassen, die auch seine Nachkommen zur finanziellen Unterstützung der Kapuzinermission, insbesondere der Hospize in Almens, Bivio und Santa Maria (im Münstertal), verpflichtete. Noch 1695 forderten die Kapuzinermissionare zusammen mit dem Churer Bischof beim Gouverneur von Mailand diese Legatsgelder erfolgreich ein.107 Je mehr Zeit aber verstrich, desto weniger waren Casnedis Erben bereit, die Kapuziner finanziell zu unterstützen. Ab 1668 weigerten sie sich, die Gelder auszubezahlen,108 und 1712 vernahm man dann vom Marchese Casnedi, die Zahlungen seien ausgeblieben, weil die Kapuziner in Bivio gar nicht mehr stationiert seien. Da dies nicht der Wahrheit entsprach, protestierten die Kapuziner vehement dagegen, fanden aber bei Casnedi kein Gehör. Mehrere Male sei er in dessen Haus gewesen, stets habe man ihn vertröstet, dass der Herr gerade nicht zuhause sei, berichtete der Kapuziner Tomaso da Chiavenna aus Mailand.109 Dass die Zahlungen aus Mailand nun ausblieben, war auch dem veränderten politischen Umfeld geschuldet: Da das Herzogtum Mailand im Gefolge des Spanischen Erbfolgekrieges aus der spanischen Monarchie herausgelöst und später unter österreichische Herrschaft gestellt wurde, war von weltlicher Seite kaum Widerstand gegen die Auflösung der einst von der spanischen Politik eingefädelten Finanzbeziehung zur rätischen Mission zu erwarten.
In der Gesamtschau ergibt sich der Befund, dass die finanzielle Verflechtung mit außerhalb der Drei Bünde angesiedelten Akteuren und Institutionen für die »Apostolische Mission« im rätischen Alpenraum recht bedeutend war. Während die fremden Gelder bis in die späten 1640er-Jahre vor allem dazu gebraucht wurden, Missionsstationen in protestantischen Gegenden aufrechtzuerhalten, wurden nach der Verlagerung der Mission in katholische Gemeinden damit Kirchen gebaut, Sakralgegenstände angeschafft, Bücher gedruckt und Schulen finanziert – und dies auch noch im 18. Jahrhundert. Mit der finanziellen Verflechtung ging damit eine kulturelle Verflechtung einher, die es im Folgenden näher zu beschreiben gilt.
2.2.3. Kulturelle Verflechtung: Ländliches Schulwesen und volkssprachliche Schriftkultur
Die Ausbildung von konfessionellen Bekenntniskirchen begünstigte die Entwicklung hin zu einem professionalisierten und institutionalisierten Schulwesen.110 Wie in anderen Gegenden, wo sich die Konfessionen auf engstem Raum in einen Wettkampf um die Gläubigen verwickelt sahen, zogen auch in den Drei Bünden »die Bemühungen beider Kirchen um die Vergrößerung der Zahl ihrer Gläubigen eine Intensivierung der lokalen Bildungsanstrengungen nach sich«111. Ulrich Pfister konnte zeigen, dass in den katholischen Gemeinden hauptsächlich zwei Gruppen für den Schulunterricht verantwortlich zeichneten: zum einen die Weltgeistlichen, vor allem die Kapläne, »deren Benefizien manchmal ausdrücklich mit der Zweckbindung des Grundschulunterrichts gestiftet worden waren«112, zum anderen Laien, die von der Dorfgemeinde oder von religiösen Bruderschaften angestellt wurden. In Anbetracht dieser beiden Akteursgruppen liegt es nahe, die Initiativen für die intensivierte Schultätigkeit im lokalen Umfeld zu vermuten. Das Quellenmaterial der rätischen Mission bringt nun aber ans Licht, dass das katholische Dorfschulwesen zu einem nicht zu unterschätzenden Teil mit externer Unterstützung errichtet und aufrechterhalten wurde.
Im Jahr 1642 schickte der Kapuzinermissionar Stefano da Gubbio seinen Mitbruder Domenico da Monteleone nach Rom, um bei Kardinal Marcello Lante della Rovere (1569–1652) um (dauerhafte) Subsidien (assegnamento stabile) in der Höhe von 50 scudi für eine von den Kapuzinern betriebene Schule im Oberhalbstein zu bitten.113 Dieses Geld sei nötig, um den Schulmeister zu bezahlen. Dieser sei auf die Alimente angewiesen, da er bis vor kurzem ein protestantischer »Minister« gewesen sei und jetzt – als »bester Katholik« – keine Einkünfte mehr habe.114 Die Aussichten, bei Kardinal Lante, dem Auditor der Apostolischen Kammer, Gehör zu finden, standen gut, hatte dieser doch bereits zuvor jährlich 100 Gulden für eine »Deutsch-« und »Grundschule« im Oberhalbstein zur Verfügung gestellt.115 Und tatsächlich konnte Pater Stefano da Gubbio später vermelden, der Kardinal habe den besagten Lehrer und die Schule im Oberhalbstein mit mehreren Zahlungen unterstützt, so auch mit 50 scudi für diejenigen Schüler, welche zum höheren Studium ins Jesuitenkolleg nach Luzern wechselten. Erst dank dieser Subsidien von außen, so Pater Stefano, sei die katholische Jugend nicht mehr gezwungen, Schulen der Protestanten zu besuchen.116
In fast allen Missionsstationen gründeten die Kapuziner solche Schulen, in denen vor allem in den Wintermonaten Unterricht erteilt wurde – im Sommer seien die meisten Dorfbewohner auf den Alpen, heißt es in einem Missionsbericht aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.117 In vielen Fällen traten die Kapuziner selbst als Lehrer auf. Nicht minder wichtig waren aber die Laien aus der Dorfgemeinschaft, die von ihnen in der Lehrtätigkeit instruiert wurden. Den passenden Rahmen dafür boten die Christenlehrbruderschaften, die eine religiöse Bildung auch für die Erwachsenen ermöglichen sollten. Aus ihrer Mitte wurden im Idealfall vier Frauen und vier Männer zu Maestri, also Lehrern ernannt – je einer für die vier (demographischen) Bevölkerungsgruppen Schulkinder, Jugendliche, Unverheiratete und Verheiratete, jeweils nach Geschlecht getrennt.118 Die Christenlehrbruderschaften kannten zudem bis zu zwölf weitere Amtsträger, von denen der ranghöchste, Suot Priore119 genannt, die Pflicht hatte, sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen während einer halben Stunde aus einem Katechismus vorzulesen.120 Der Canceliere wiederum hatte der versammelten Gemeinde den Actus Fidei oder andere katholische Gebete vorzubeten und sie die einzelnen Strophen wiederholen zu lassen. Alle diese Lehrämter im weiteren Sinne waren mit besonderen geistlichen Privilegien und Ablässen verbunden, an die die Christenlehrbruderschaften nur gelangen konnten, weil die Kapuziner sie an die entsprechenden Erzbruderschaften in Brescia und Rom angegliedert hatten.121 Somit prägte auch auf dieser Ebene die grenzüberschreitende Verflechtung der Mission das ländliche Unterrichtswesen entscheidend mit.
Der Unterricht in solchen von den Kapuzinern geführten Bruderschaften und Schulen baute auf zwei Säulen auf. Zum einen leitete er die katholische Jugend in der Glaubenspraxis an und vermittelte ihr die wichtigsten (sittlich-moralischen) Grundsätze einer katholischen Lebensführung. So lernten die Schüler beispielsweise, wie man den Rosenkranz rezitiert, die marianischen Litaneien betet oder wie man »richtig« beichtet. Zum anderen wurde den Schülern eine über den kirchlich-religiösen Bereich hinausreichende Elementarbildung vermittelt, das heißt, ihnen wurde auch das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht.122 Gerade im Misox waren die Schulen der Kapuziner aus diesem Grund äußerst beliebt, denn viele Talbewohner verdienten ihr Geld als Baumeister, Kaminfeger oder Händler weitab der Heimat und waren für diese Tätigkeiten ebenso wie für die Aufrechterhaltung des Kontaktes mit ihren Familien auf diese Fähigkeiten angewiesen.123 Auch der in ganz Europa bekannte Architekt Giovanni Domenico Barbieri (1704–1764) aus Roveredo, um nur ein besonders gut dokumentiertes Beispiel zu nennen, hatte bei den im Misox missionierenden Mailänder Kapuzinern rechnen, lesen und schreiben gelernt.124
Dass auswärtige Verfechter der katholischen Konfessionskirche das ländliche Schulwesen im rätischen Alpenraum unterstützten, hatte zwei Gründe. Mit dem Ziel der Stärkung des Katholizismus im konfessionellen Grenzgebiet vor Augen, versprach der Schulunterricht erstens einen über den religiösen Bereich hinausgehenden »profanen« Nutzen: Während der Großteil der Bündner Bevölkerung nicht einmal lesen könne, verstünden sich die Absolventen der katholischen Schule in Chur sowohl in Grammatik als auch im Schreiben und Rechnen, weshalb sie in ihren Heimatdörfern oft in führende Ämter gewählt würden und somit die Politik der Drei Bünde nach katholisch-konfessionellen Gesichtspunkten mitgestalten könnten, begründete etwa der Churer Bischof Ulrich von Federspiel (1692–1728) gegenüber der römischen Kurie noch im 18. Jahrhundert seine regelmäßigen Bitten um finanzielle Unterstützung für die Churer Domschule.125 Tatsächlich schien der Propagandakongregation in Rom diese Argumentation wichtig genug, um die Schule in Chur im Zeitraum von 1715 bis 1728 mit 70 scudi pro Jahr zu alimentieren.126 Zweitens dienten die von außen angestoßenen Initiativen zur Förderung der Schreib- und Lesefähigkeit dem von der Propagandakongregation vorgegebenen Ziel, die katholische Bevölkerung zu einer kirchengebundenen und konfessionell festgelegten Frömmigkeit zu erziehen.127 Hierfür brachten die Missionare volkssprachliche Andachts-, Gebets- und Liederbücher in Umlauf, in welchen den Bündnerinnen und Bündnern die wichtigsten Grundsätze des katholischen Bekenntnisses vermittelt wurden. Die beiden bedeutendsten dieser Druckwerke hat der selbst in der rätischen Mission tätige Pater Zacharias da Salò († 1705)128 verfasst: den Spieghel de Devotiun (1665) und das Glisch sin il chandelier invidada (1685).129 Sie enthalten auf jeweils mehr als siebenhundert Seiten teils mystisch anmutende Texte zu Leben und Tod von Jesus, Maria und den Heiligen – auch solchen, die nur im rätischen Alpenraum verehrt wurden – sowie konkrete Anweisungen zur Glaubenspraxis. Sie fassten, angepasst auf die lokalen Begebenheiten, das konfessionelle Glaubenswissen der Zeit zusammen. Der katholischen Jugend sollten sie Anweisungen zur »Frömmigkeit von morgens bis abends« an die Hand geben und ihnen beispielsweise beibringen, wie und bei welcher Gelegenheit das Kreuzzeichen zu machen ist, welche religiösen Praktiken im Falle einer Krankheit angewendet werden können und welche geistlichen Mittel gegen Dämonen nützen.130 Viele dieser Bücher wurden für den religiösen Alltag konzipiert: Insbesondere die kleinformatigen, zum Teil nur gerade 9×7 cm großen131 Taschenbücher konnten die Gläubigen gut bei sich tragen und zuhause oder unterwegs als Anleitung für die individuelle Andacht verwenden. Wie das Vorwort eines solchen Büchleins betonte, wurde deshalb darauf geachtet, dass sie »wenig kosten« und so auch für die ärmere, bäuerliche Bevölkerung erschwinglich waren.132
Gerade auch weil sie erschwinglich und auf die Sprache der Landbevölkerung angepasst waren, haben die seit den 1660er-Jahren im Umfeld der rätischen Kapuzinermission entstandenen Druckschriften eine breite Rezeption erfahren. Die Forschung hat darin zu Recht das entscheidende Moment für die Ausbildung einer eigenständigen rätoromanischen Schriftkultur gesehen.133 Allerdings tendieren Literatur- und Kulturwissenschaftler bis heute dazu, die rätoromanische Buchproduktion des 17. und 18. Jahrhunderts als autonome Kulturleistung der lokalen Gesellschaft überzubewerten. Zwar ist unbestritten, dass traditionelles Erzähl- und Liedgut Eingang in diese Druckschriften gefunden hat und mit ihnen erstmals Viten von Lokalheiligen wie dem Disentiser Abt Adalgott und den Klosterheiligen Placidus und Sigisbert in gedruckter Form vorlagen.134 Doch muss ebenfalls bedacht werden, dass die Produktion dieser Bücher in hohem Maße von außen beeinflusst wurde. Auf zwei Faktoren soll im Folgenden näher eingegangen werden: auf die fremde Herkunft der Autoren und auf die in den Vorworten sichtbar werdenden Protektionsverhältnisse.
Der Einfluss der italienischen Kapuziner auf die literarische Produktion muss als sehr bedeutend eingestuft werden. Selbst das vom Disentiser Benediktiner Carli Decurtins († 1712) verfasste Liederbuch Consolaziun della Olma devoziusa, das lange Zeit als Paradebeispiel des literarischen Selbstbewusstseins der (katholischen) Rätoromanen galt,135 lehnte sich stark an ein Liederbuch von Zacharias da Salò an.136 Letzterer kann gar als der »eigentliche Begründer der Surselvaner Barockliteratur«137 angesehen werden. Auch hinsichtlich der schieren Quantität der Buchproduktion war die literarische Betätigung der italienischen Kapuziner von herausragender Bedeutung: Ein Großteil der katholischen Bücher in rätoromanischer Sprache stammte aus der Feder der fremden Ordensbrüder.138 Wie wirkte sich dies auf die katholische Literatur der Rätoromanen insgesamt aus? Erstens kann festgestellt werden, dass viele rätoromanische Schriften Adaptionen italienischer Vorbilder darstellten, wie dies bei den gedruckten Bruderschaftsregeln139, bei mehreren Erbauungsschriften140 und auch bei den meisten Katechismen141 der Fall war. Voraussetzung hierfür waren Missionsbibliotheken, die mit den wichtigsten (kontrovers-)theologischen und katechetischen Schriften (in Latein und Italienisch) ausgerüstet waren. 1669 forderte beispielsweise der Präfekt der Mailänder Missionsabteilung, das Hospiz von Soazza solle aus Mailand mit genügend Büchern versorgt werden.142 Kulturell besehen wies die rätoromanische Schriftkultur katholischer Prägung damit zu einem guten Teil einen italienischen Hintergrund auf. Zweitens muss bedacht werden, dass die Verfasser dieser Schriften keine Muttersprachler waren, was sich auch in der Sprache (Grammatik und Orthographie) bemerkbar gemacht haben dürfte. Erstaunlicherweise wurde dieser Punkt von der literaturwissenschaftlichen Forschung bisher übersehen, was insofern problematisch ist, als man diesen Werken landläufig einen enormen Einfluss auf die Weiterentwicklung der rätoromanischen Sprache zugestanden hat.143 An dieser Stelle kann diese Fragestellung – mangels sprachwissenschaftlicher Kompetenz des Autors – nicht weiterverfolgt werden, stattdessen soll anhand von Archivquellen kurz gezeigt werden, dass die Kapuziner großen Wert auf die sprachliche Ausbildung ihrer Missionare legten.