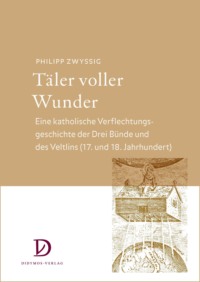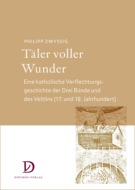Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 7
Das Erlernen der rätoromanischen Sprache sei äußerst schwierig, schrieben die Kapuzinermissionare 1661 nach Rom.144 Nicht nur von Tal zu Tal, auch von Dorf zu Dorf unterscheide sich das gesprochene Wort, sodass es mehrere Jahre dauere, bis die Missionare die Sprache beherrschten. Dennoch seien rätoromanische Sprachkenntnisse für die Missionare unabdingbar, um Christenlehre zu erteilen, Beichten abzunehmen und Predigten zu halten.145 Um den »Schwierigkeiten mit der derben Sprache«146 vorzubeugen, wurde deshalb ein besonderes Augenmerk auf die sprachliche Ausbildung der Missionare gelegt. Das Provinzkapitel von Brescia bestimmte 1661, dass die beiden Novizen Gioseffo da Pontenico und Francesco da Bagolino nicht nur in Philosophie und Theologie, sondern auch in der Sprache des Landes unterrichtet werden sollten.147 Letzteres geschah direkt vor Ort – im Falle der genannten Kapuziner im Hospiz von Tiefencastel, im 18. Jahrhundert scheint das Hospiz von Savognin als Sprachschule für angehende Missionare gedient zu haben.148 Seit 1729 stand für die sprachliche Ausbildung eigens ein gedrucktes Werk zur Verfügung, das den »Italienern, insbesondere aber den jungen Kapuzinern, die von der Kongregation de Propaganda Fide in diese Gegend geschickt wurden, zum leichten Erlernen der rätischen Sprache«149 dienen sollte. Das von Flaminio da Sale (1667–1733), dem Vizepräfekten der rätischen Mission, verfasste Werk ist das erste gedruckte bündnerromanische Grammatik- und Wörterbuch überhaupt,150 was nochmals unterstreicht, wie stark die Ausbildung einer rätoromanischen Schriftkultur von externen Einflüssen geprägt war.
Es gab noch einen weiteren Faktor, der die Produktion rätoromanischer Bücher maßgeblich vom Ausland abhängig machte: die kirchliche Zensur respektive die kirchliche Druckerlaubnis. Angesichts der großen Bedeutung des gedruckten Wortes für die Glaubensunterweisung forderte die tridentinisch erneuerte Kirche strikte Kontrollen der Buchproduktion ein.151 Wollte ein Missionar wie Zacharias da Salò ein für die Mission bestimmtes Werk drucken, so musste er die entsprechenden Bewilligungen verschiedenster kirchlicher Instanzen einholen und mitunter eine Jahre dauernde Wartezeit bis zum definitiven Entscheid in Kauf nehmen. Schon 1677 hatte sich Pater Zacharias an die Propagandakongregation in Rom gewandt und um die Erlaubnis gebeten, sein zuerst auf Italienisch verfasstes Manuskript la lucerna accesa sopra il Candeliere drucken zu dürfen.152 Doch erst 1685 konnte die Drucklegung des la Glisch sin il chandelier invidada erfolgen, nachdem im Dezember 1683 und im Januar 1684 die Missionsoberen der Provinz Brescia, im März 1684 der Generalminister der Kapuziner und schließlich im Juni 1685 der Bischof von Chur die entsprechenden Lizenzen erteilt hatten.153 Der Grund für die lange Phase vom Antrag bis zur Veröffentlichung war also, dass eine ganze Reihe von kirchlichen Erlaubnissen nötig war: Nebst der eigentlichen Druckgenehmigung der genannten Stellen brauchte es eine separate Erlaubnis der Propagandakongregation, um die Bücher in der Bevölkerung verteilen zu dürfen.154 Werke wie der ebenfalls von Pater Zacharias verfasste Spieghel de Devotiun, die explizit der Unterweisung der Jugend dienten, mussten zusätzlich von der Inquisition – in diesem Fall von den Inquisitoren in Verona und Venedig155 – auf ihre konfessionelle Regelkonformität hin überprüft werden. Daneben verzögerte auch die Suche nach einer Finanzierungsquelle die Drucklegung religiöser Schriften. Zacharias da Salò beabsichtigte, seine Bücher gratis der »armen Bevölkerung«156 abzugeben, weshalb es eines externen Mäzens bedurfte, der für die Kosten aufkam. Auch hier zeigte sich, dass ohne Hilfe von außen an eine umfassende Buchproduktion kaum zu denken war.
Dass die Amtskirche die Drucklegung von katechetischen Traktaten wie den genannten zuweilen sehr restriktiv handhabte, zeigt das Beispiel einer von Carlo Giuseppe Mengotti aus Poschiavo verfassten Christenlehre. Mengotti bat 1719 die Propagandakongregation um die Druckerlaubnis für sein Buch Metodo teorico pratico d’insegnare la dottrina cristiana.157 Man hätte meinen können, diese sei für Mengotti leicht zu erhalten, hatte er doch selbst am Kollegium der Propaganda Fide studiert.158 Trotzdem hielt sein Werk der Überprüfung der Inquisition159 nicht stand. Zwar sei die Absicht Mengottis lobenswert, seine Schrift jedoch voller Fehler, wohl auch, weil der Autor es nicht gewohnt sei, sich in Italienisch auszudrücken, hieß es im Protokoll der Propagandakongregation.160 Dass Mengotti aus dem italienischsprachigen Poschiavo stammte, hatte man offenbar bereitwillig übersehen.161 Mengotti ließ sich vom negativen Entscheid jedoch nicht entmutigen. 1725 legte er der Propagandakongregation ein neues kontroverstheologisches Buch zur Prüfung vor.162 Doch auch dieses hielten die Experten der Propagandakongregation für nicht druckwürdig. Erst 1741 hatte Mengotti, mittlerweile Dompropst der Kathedrale von Chur, mit einem abermals anderen Werk Erfolg: Es wurde für richtig und »nützlich« befunden. Für die Drucklegung sicherte die Kurie 350 doppie di Spagna zu, bezahlt entweder aus der Kasse des »künftigen Papstes«, über die »spanische Pension« oder aus einer anderen Quelle.163 Hier zeigte sich also, dass auch in der Buchproduktion die (finanziellen) Verflechtungen mit der spanischen Krone zum Tragen kamen.
Erfahrungen mit den römischen Zensurbehörden, wie sie Carlo Giuseppe Mengotti gemacht hatte, ließen jeden Geistlichen, der in Erwägung zog, ein Buch oder andere Druckschriften zu veröffentlichen, nach einem möglichst einflussreichen Protektor suchen. Die Vorworte und Widmungen der Bücher zeigen, von welchen Personen sich die Autoren Fürsprache bei den Zensurbehörden oder aber Druckkostenbeiträge und andere Unterstützung versprachen – und wohl auch erhielten. Die Kapuziner der rätischen Mission bedankten sich in den Widmungen ihrer Bücher, die auch als öffentliche Ehrerweisung gegenüber den Adressaten zu verstehen sind, in erster Linie bei kirchlichen Prälaten. Flaminio da Sale, Gabriele Maria da Brescia und Giuseppe Maria da Tresivio widmeten ihre Schriften dem jeweils gerade amtierenden Abt von Disentis.164 Flaminio da Sale beispielsweise beschrieb Abt Marian von Castelberg (1724–1742) als großzügigen Patron, wobei er betonte, dass der Abt ihn die Klosterbibliothek benutzen ließ und ihm für die Produktion seines rätoromanischen Grammatik- und Wörterbuches die Druckerei des Klosters zur Verfügung stellte.165 Andere Kapuziner nahmen in ihren Widmungen Bezug auf die Unterstützung vonseiten der Bischöfe von Chur und Como,166 von Kardinälen in Rom167 sowie vom Nuntius in Luzern168. Auf einen weltlichen Patron konnte sich die von Flaminio da Sale verfasste rätoromanische Vita des Kapuzinerheiligen Fidelis von Sigmaringen berufen. Sie war Antonius von Rost, dem österreichischen Gesandten bei den Drei Bünden, gewidmet.169 Zacharias da Salò wiederum ehrte im Vorwort des la Glisch sin il chandelier invidada die »Signurs Grigiuns Catholics della Eccelsas Treis Ligias della Rhetia«, also die katholischen (Rats-)Herren der Drei Bünde.170
Was die weltlichen Protektoren anbelangt, so ist anzunehmen, dass sie sich finanziell an den Kosten der Buchproduktion beteiligten und womöglich ein gutes Wort bei den entsprechenden Zensurbehörden einlegten. Insofern verdankten die Vorworte konkrete, bereits geleistete Gefälligkeiten. Nicht minder wichtig dürfte aber der symbolische Aspekt der Widmungen gewesen sein.171 Ein religiöses Werk, das einem katholischen Fürsten respektive einem seiner Vertreter gewidmet war, mahnte diese an ihre Rolle als Protektoren des katholischen Glaubens und unterstrich gleichzeitig eine gewünschte oder auch eine reale Bindung des Autors, der Mission oder der katholischen Kirche Graubündens an diesen Patron. Dass Ehrerweisungen gegenüber weltlichen Akteuren vor allem in Büchern aus den Bündner Untertanengebieten auftauchen, wo sich die katholischen Bewohner von 1620 bis 1639 die Unabhängigkeit von den mehrheitlich protestantischen Drei Bünden mit militärischer und politischer Unterstützung fremder Fürsten erkämpft hatten, erstaunt daher nicht. Diese Widmungen sollen am Schluss dieses Kapitels Anlass geben, um einen Blick auf die Schriftkultur in den Untertanengebieten zu werfen und diese derjenigen der rätoromanischen Gebiete gegenüberzustellen.
Auffallend an den aus dem Veltlin stammenden Druckschriften religiös-kirchlichen Inhalts ist zunächst, dass ihre Urheber großmehrheitlich Einheimische waren, das heißt aus dem Veltlin, aus Chiavenna oder Bormio stammten. Auch hier gehörten sie meistens dem geistlichen Stand an, doch gab es vereinzelt auch einheimische Ärzte172 oder Notare173, die sich als Autoren betätigten. Während die rätoromanischen Schriften der religiösen Gebrauchsliteratur zuzurechnen sind, also für die theologische Unterweisung und die persönliche Andacht gedacht waren, beschäftigten sich die Veltliner Drucke überwiegend mit den lokalen religiösen Traditionen und kulturellen Eigenheiten.174 Das Augenmerk lag auf der Geschichte bestimmter Pfarreien und Kirchen175, auf den lokalen Fest- und Feiertagen176 sowie ganz besonders auf den Marienerscheinungen von Tirano und Gallivaggio mit den dort bezeugten Mirakelgeschichten177. Die Veltliner Druckschriften strichen damit allesamt die typisch katholischen Elemente von Kultur und Gesellschaft des Tales heraus und verorteten deren Ursprünge in einer weit zurückliegenden Vergangenheit. Sie taten dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich die Untertanengebiete durch die katholische Konfession von den herrschenden Drei Bünde abgrenzen konnten. So kam etwa der mit den Archivbeständen seiner Zeit bestens vertraute Notar Carlo Giacinto Fontana in seiner Geschichte der Pfarrei Morbegno zu folgendem Schluss:
»Aus dem, was ich dargelegt habe, kann man schließen, dass Morbegno nicht nur Heimat von berühmten und gelehrten Personen war und ist, sondern dass man Morbegno gleichsetzen kann mit einer katholischen Stadt, sei es wegen der Menge der Kirchen, Kanonikate, Benefizien, Konvente, frommen Stiftungen und Bruderschaften, sei es weil Morbegno schon immer Sitz des Richters war und wegen des Adels, der dort wohnt, auch wegen der Kaufmannschaft und zahlreichem [weiterem] Volk, welche immer der wahren Religion angehörten, diese bewahrt haben und beigetragen haben zur weiteren Verbreitung der katholischen Kirche und des Dienstes gegenüber Gott, dem in Ewigkeit jede Ehre und Ruhm gebührt.«178
Liest man zwischen den Zeilen, so erkennt man, dass Fontana sich gegen jedwedes Ausbreiten der protestantischen Konfession richtet und damit gewissermaßen die durch das Mailänder Kapitulat von 1639 garantierte katholisch-konfessionelle Einheit der Bündner Untertanengebiete herausstreicht. Fontana ist kein Einzelfall. Auch andere Autoren betonten die katholische Tradition der Untertanengebiete, um daraus Argumente für eine antiprotestantische und damit gleichsam antibündnerische Politik abzuleiten. Francesco Saverio Quadrio (1695–1756) beispielsweise entwarf in drei Bänden eine umfassende Geschichte der Veltliner Gesellschaft, in welcher er unter anderem auch ausführlich auf die lange Tradition von lokalen Heiligen und anderen berühmten Männern und Frauen der Kirche einging.179 Quadrio zeichnete so das Bild einer einheitlichen, katholisch geprägten Kulturlandschaft, die sich in seinen Augen deutlich von den über das Veltlin herrschenden Drei Bünden unterschied.
Diese Beispiele zeigen, dass für die Entstehung und Ausformung der Veltliner Schrift- und Gelehrtenkultur das Streben nach einer klaren Abgrenzung gegenüber den (mehrheitlich protestantischen) Bündner Herren – gipfelnd in der Unabhängigkeitsbewegung der 1620er-Jahre – sehr zentral war. Damit einher ging eine stärkere Anbindung an den katholischen Süden, was sich bezeichnenderweise in den Widmungen der Druckwerke niederschlug. Giovanni Antonio Cornacchi schrieb beispielsweise 1621, er könne sein Buch über die Madonna von Tirano keinem anderen widmen als dem Gouverneur von Mailand, denn dieser habe Tirano in den jüngsten kriegerischen Auseinandersetzungen gegen die protestantischen Bündner verteidigt.180 Auch spätere Autoren hoben in ihren Vorworten die Verdienste spanisch-mailändischer Amtsträger für den katholischen Glauben im rätischen Alpenraum hervor. Guglielmo Chiaverini widmete sein Werk über die religiöse Kultur des Val San Giacomo von 1663 Francesco Casati, dem Gesandten Mailands in der Eidgenossenschaft, und Giovanni Giacomo Macolino ehrte in seinem Buch zu den Kirchen des gleichen Tals (1686) Enea Crivelli, ebenfalls mailändischer Ambassador bei der Eidgenossenschaft und den Drei Bünden.181 Dank Quellen aus dem Diözesanarchiv Como wird deutlich, dass genau diese Mailänder Akteure die genannten Werke respektive die Autoren finanziell unterstützten. Guglielmo Chiaverini stand offenbar seit seinem Studium in Mailand in Kontakt mit der Familie Casati,182 später bezog er aus Mailand eine jährliche Pension in der Höhe von 99 scudi183. Auch die Schriftkultur in den Bündner Untertanengebiete war also sowohl von symbolischen als auch von personalen und finanziellen Verflechtungen mit dem Herzogtum Mailand geprägt.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die grenzüberschreitenden Beziehungen sowohl die Produktion romanischsprachiger Gebrauchsliteratur (Lieder- und Legendensammlungen, Heiligenviten, Bruderschafts- und Erbauungsbücher, Predigtsammlungen etc.) als auch die Entstehung von Druckschriften über die religiöse Kultur der Untertanengebiete begünstigten. Es lassen sich zwei historische Schlüsselmomente dieser Entwicklung ausmachen: erstens die endgültige Verschiebung der rätischen Mission von den protestantischen in die katholischen Gemeinden in den 1640er-Jahren, die zu Initiativen im Schulwesen und in der Christenlehre und damit zu einer gesteigerten Nachfrage nach volkssprachlicher Unterweisungsliteratur führte; zweitens das Einstehen der spanischen Krone für die Interessen der Veltliner während der Bündner Wirren, das sich nicht zuletzt in der Förderung von Buchproduktionen, die das Bewusstsein für die kulturell-religiöse Eigenheit der Untertanengebiete stärkten, bemerkbar machte. Insgesamt ist es also angebracht, die sich im konfessionellen Zeitalter auch im rätischen Alpenraum entwickelnde Schriftkultur nicht als autonome Kulturleistung der lokalen Gesellschaft zu begreifen,184 wie dies insbesondere die literatur- und kulturwissenschaftliche Forschung der Rätoromanen lange Zeit getan hatte. Betont werden muss stattdessen, dass die grenzüberschreitenden Austauschbeziehungen erst die Voraussetzungen für eine intensivierte volkssprachliche Literaturproduktion schufen: Gerade im Falle der rätoromanischen Andachtsbücher stammten die literarischen Vorlagen, die Autoren und teilweise auch die benötigten Finanzmittel aus Italien; zudem war bei landesfremden Akteuren wie den Kapuzinermissionaren der Anreiz am größten, sich mit den Eigenheiten der (fremden) Volkssprache auseinanderzusetzen. Hier zeigt sich, dass selbst so lokalspezifische Vorgänge wie die Konsolidierung der rätoromanischen Schriftsprache nur in ihren Wechselwirkungen mit äußeren Einflüssen adäquat zu erfassen sind.
2.2.4. Institutionelle Verflechtung: Missionsfakultäten und Bruderschaftsprivilegien
Nachdem bis hierhin vor allem die Verflechtungen von weltlicher Bündnispolitik, katholischer Kultur und rätischer Mission in den Blick gekommen sind, ist es nun an der Zeit, sich den Beziehungen zwischen Rom, dem Zentrum der katholischen Christenheit, und der katholischen Gesellschaft im rätischen Alpenraum zuzuwenden. Die Papstkirche zeigte sich seit dem Konzil von Trient (1545–1563) bemüht, die Banden zu den »lokalen Kirchen«185 zuerst in Italien, später auch im übrigen Europa und in den Missionsgebieten enger zu knüpfen. Mit neugeschaffenen Institutionen sollte dem Universalitätsanspruch der römischen Kirche zunehmend Geltung verschafft, die Kultgemeinschaften in den verschiedenen Kirchenprovinzen stärker als je zuvor von Entscheiden an der römischen Kurie abhängig gemacht werden.186 Zwei Mittel dieser institutionellen Verflechtung zwischen Rom und den lokalen Kultgemeinschaften im rätischen Alpenraum werden auf den nächsten Seiten beschrieben: die von der Kurienkongregation de Propaganda Fide vergebenen Missionsfakultäten sowie die Privilegien der Erzbruderschaften. Vorausgeschickt werden muss, dass man sich diese institutionellen Verflechtungen nicht als zu »modern« vorstellen darf: In typisch frühneuzeitlicher Manier schufen sie nie vollumfänglich formalisierte Abhängigkeiten nach dem top-down-Prinzip, sondern erlaubten vielmehr situatives und zweckgebundenes Handeln auch auf der untergeordneten Ebene.
Die Kurienkongregation de Propaganda Fide war eine dieser neuen Institutionen, mit denen der römische Zugriff auf die kirchliche Peripherie intensiviert werden sollte. Mit ihr sollten die inner- wie außereuropäischen Missionen einer zentralen Verwaltung unterstellt werden. Sie beanspruchte für sich, allein über die Einsetzung und Aufhebung einer Mission, über deren Kompetenzen und Privilegien sowie über fehlerhaftes Verhalten des Missionspersonals bestimmen zu können. Das entsprechende Instrument dazu waren die sogenannten »Fakultäten« (facultates). Es handelte sich dabei um von der Propagandakongregation delegierte Missionskompetenzen unterschiedlichster Art und Reichweite. Sie wurden nicht in corpore für eine Mission in einem bestimmten Gebiet vergeben, sondern waren an Personen gebunden oder wurden für einen begrenzten Zeitraum – etwa für die Advents- oder Fastenzeit – ausgestellt. Eine Mission wie die rätische bestand kirchenrechtlich gesehen aus einem ganzen Konglomerat solcher Fakultäten. Die wichtigste und grundlegendste Fakultät der rätischen Mission war diejenige, die der jeweilige Vorsteher der an der Mission beteiligten Kapuzinerprovinzen erhielt. Sie erlaubte es ihm, Ordensmitgliedern aus der eigenen Provinz den Missionarsstatus zu verleihen und über deren Ein- und Absetzung als Missionare zu entscheiden.187 Da der Provinzial jedoch die operative Leitung der rätischen Mission meistens einem selbst in der Mission tätigen Vizepräfekten übergab, musste bei der Propagandakongregation zusätzlich eine spezielle Fakultät eingeholt werden, die dem Vizepräfekten die Kompetenzen des Provinzials übertrug.188 Der Vizepräfekt wiederum war dadurch in der Lage, die Missionsfakultäten den ihm unterstellten Kapuzinern und – zumindest bis in die 1640er-Jahre – auch Weltpriestern zu delegieren.189 Dieselbe Befugnis besaßen seit etwa 1652 auch die aus dem Misox stammenden und im Missionskolleg der Propaganda Fide ausgebildeten Weltpriester Antonio Maria Laus und Taddeo Bolzoni (oder Bolzone).190 Geknüpft an solche Missionsfakultäten waren meistens spezifischere Fakultäten, die dem Inhaber des Missionarsstatus gewisse Privilegien gewährten respektive ihn von bestimmten Vorschriften befreite (Dispensen). So erlaubte ein Dekret der Propaganda-kongregation vom 23. April 1635 allen Missionaren aus dem Kapuzinerorden, ihren Unterhalt mit den Einkünften aus dem Pfrundvermögen von Pfarreien zu bestreiten – mit anderen Worten: Sie durften fortan Geld verwenden, um damit Wein und Lebensmittel zu kaufen.191 Andere Dispensen betrafen etwa die strenge Kleiderordnung, das Verwenden von Reittieren sowie das Gebot der Barfüßigkeit und das Leben außerhalb der Klostergemeinschaft.
Dieses hierarchisch aufgebaute System der (mehrfachen) Delegation von Missionskompetenzen war für die um eine zunehmende Zentralisierung bemühte römische Amtskirche Segen und Fluch zugleich. Beginnen wir mit dem Fluch: Die Kontrolle der Propagandakongregation über die rätische Mission beschränkte sich auf die oberste Stufe der Vergabe von Missionsfakultäten. Auf die weitere Distribution der Missionserlaubnis hatte sie kaum Einfluss. So weitete etwa der Vizepräfekt der Mission in den frühen 1640er-Jahren die Mission eigenmächtig auf das Veltlin aus, indem er einigen Kapuzinern aus dem Kloster Tirano die Missionsfakultät übertrug.192 Durch den Nuntius davon in Kenntnis gesetzt, erlaubte die Propagandakongregation vorerst zwar die missionarische Aktivität im Veltlin für die Zeit von Weihnachten bis Ostern 1642/43, nahm danach aber das Veltlin ganz von der rätischen Mission aus.193 Man habe dem Vizepräfekten zwar die Erlaubnis erteilt, die Fakultäten zu delegieren, dies aber nur an Ordensangehörige im bestehenden Missionsgebiet; die Klöster im Veltlin seien davon ausgenommen, hieß es aus Rom. Zur unkontrollierten Ausbreitung der Mission kam hinzu, dass die personengebundene Vergabe von Missionsfakultäten einigen Konfliktstoff in sich barg. Kam es etwa zum Bruch zwischen dem Präfekten und dem Vizepräfekten der Mission wie 1674, so konnte daraus ein langwieriger Kompetenzstreit entstehen, weil sich im Prinzip beide Parteien auf eine durch die Propagandakongregation ausgestellte Fakultät berufen konnten. 1674 beorderte der Provinzial den Vizepräfekten Paolo d’Agnosegno in die Provinz zurück, vor allem wegen dessen Verstrickung in den sogenannten Tomilserhandel, bei dem ein blutiger Konfessionskonflikt kurz bevorstand.194 Der Vizepräfekt hingegen weigerte sich, die Mission zu verlassen und erhielt dabei Unterstützung vonseiten des Nuntius in Luzern. Während die Provinzoberen bereits einen neuen Vizepräfekten ernannt und bei der Propagandakongregation eine entsprechende Fakultät beantragt hatten, bat der Nuntius in Luzern die Kongregationskardinäle, man solle diesen verdienstvollen Vizepräfekten nicht ohne die Zustimmung der Nuntiatur absetzen.195 Für den streitbaren Paolo d’Agnosegno bedeutete dies, dass er »zwei Herren gleichzeitig hätte dienen«196 sollen, wie er es selbst ausdrückte; habe ihm der Nuntius etwas angeordnet, so habe ihm der Präfekt gerade einen gegenteiligen Befehl erteilt. Tatsächlich hatte der Nuntius dem Vizepräfekten offenbar sogar die Sospensione a divinis197 angedroht, falls er ohne Erlaubnis des Nuntius sein Amt aufgeben würde.198 Der Konflikt legte sich 1677, weil in Brescia ein neuer Provinzial gewählt wurde, der Paolo d’Agnosegno wohlgesinnt war. Nuntius Odoardo Cibo (auch Cybo), ab 1680 selbst Sekretär der Propaganda Fide,199 nutzte diese Gelegenheit sogleich, um für ihn bei der Propagandakongregation erneut die Fakultäten des Vizepräfekten zu erwirken.200 Doch bereits zwei Jahre später brach die Kontroverse erneut aus, diesmal mit noch schlechterem Ausgang für den Vizepräfekten. Als er sich 1680 auf Befehl der Propagandakongregation nach Brescia begab, wurde er dort auf Anweisung der Provinzoberen festgenommen und in ein Gefängnis nach Venedig deportiert.201 Auf Druck des Nuntius und der Propaganda Fide kam er schließlich wieder frei, kehrte in die Mission zurück und starb dort 1684 den Tod eines »heiligmäßigen« Mannes,202 was angesichts der Kontroverse um seine Person freilich nicht einer gewissen Ironie entbehrte. In dieser verworrenen Episode hatte sich offenbart, dass die Propagandakongregation nicht in der Lage war, ein Machtwort zu sprechen und einen unumstößlichen Entscheid zu fällen, den weder die eine noch die andere Seite hätte umgehen können. Dieses Hin und Her war nicht zuletzt möglich, weil auch innerhalb der römischen Amtskirche die Kompetenzen nicht trennscharf voneinander abgegrenzt waren: Auch der Nuntius machte Mitsprache in der Mission geltend,203 und außerdem war es zwar der Propagandakongregation vorbehalten, die erwähnten Fakultäten zu vergeben, für deren Prüfung auf Rechtmäßigkeit und die letztinstanzliche Ausstellung war jedoch das Heilige Offizium zuständig.204 War ein Akteur mit einem Entscheid der einen Instanz nicht zufrieden, so konnte er immer noch versuchen, die andere auf seine Seite zu ziehen.
Wenngleich sich hier die Grenzen des römischen Zugriffs auf die Akteure und Geschehnisse vor Ort bemerkbar machten, bot die von der Kurie ausgehende Distribution von Missionskompetenzen dennoch Anknüpfungspunkte für die praktische Umsetzung des römischen Suprematieanspruchs. Kommen wir nach dem Fluch also zum Segen der institutionellen Verflechtung via Missionsfakultäten. Gerade der so erbittert geführte Kampf verschiedenster Akteure um die Vizepräfekten-Fakultät machte offenkundig, dass die von der Propagandakongregation erteilten Fakultäten als Conditio sine qua non eines rechtmäßigen Missionsstatus verstanden wurden. Die Propagandakongregation selbst hatte dazu beigetragen, indem sie besonderen Wert auf die regelmäßige Erneuerung der Missionsfakultäten legte: im Falle der Kapuzinermission sicher jeweils beim Wechsel des Provinzials beziehungsweise des Vizepräfekten, bei den Weltpriestern im Rhythmus von drei Jahren. Meistens war die Erneuerung nur eine Formsache,205 der symbolische Aspekt, dass bei der Kurie explizit darum gebeten werden musste, wohl ungemein wichtiger. Die langfristige Wirkung dieser Politik war, dass die Propagandakongregation letztlich als unumgängliche Instanz angesehen wurde. Wollte eine Kirchgemeinde Missionare als Seelsorger verpflichten, so wusste sie, dass sie sich entweder über den Nuntius in Luzern oder direkt an die Propaganda Fide wenden musste. Dass viele Gemeinden diesen Weg einschlugen und so zunehmend auch lokale Angelegenheiten im Kardinalskollegium behandelt wurden, wird unten noch zu zeigen sein. An dieser Stelle genügt es festzuhalten, dass es einer externen kirchlichen Institution im Verlaufe des 17. Jahrhunderts gelungen war, sich innerhalb der lokalen Gesellschaft als ausschlaggebende, teilweise auch unumgehbare Instanz zu positionieren. Auch auf der institutionellen Ebene machten sich also grenzüberschreitende Verflechtungen bemerkbar.
Neben den in Rom ausgestellten Fakultäten sorgten auch die von den Missionaren gegründeten Kongregationen und Bruderschaften für eine zunehmende institutionelle Verflechtung mit der römischen Kurie. Diese wurden nämlich häufig an Erzbruderschaften in Rom angegliedert, wodurch ihre Mitglieder direkt von deren geistlichen Privilegien profitierten.206 Solche grenzüberschreitenden Verknüpfungen religiöser Laiengemeinschaften waren laut Peter Hersche sonst fast nur in mediterranen Ländern zu finden,207 was ein erstes Indiz ist, dass die katholischen Kultgemeinschaften im rätischen Alpenraum kirchlich-religiös betrachtet als Teil des südlichen Katholizismus zu verstehen sind. Weiter nördlich kam es vor allem dort zu Gründungen von Zweigstellen römischer Bruderschaften, wo reformkatholische Kräfte wie die Jesuiten eine romzentrierte Glaubenspraxis förderten, wie dies etwa in der von Trevor Johnson untersuchten Oberpfalz der Fall war.208 In Anbetracht dessen kann für den rätischen Alpenraum gefolgert werden, dass die von der römischen Kirche beabsichtigte und vom Süden her einsetzende translokale Verflechtung der katholischen Kultgemeinschaften hier weiter fortgeschritten war als in anderen Gebieten – womöglich auch weiter als in der sonst vergleichbaren katholischen Eidgenossenschaft, wo die Erzbruderschaften scheinbar weniger präsent waren209. Zwei Beispiele sollen diesen Befund illustrieren: das von den Weltpriestern Antonio Maria Laus und Taddeo Bolzoni zunächst im Misox und dann in Chiavenna gegründete Oratorium des Filippo Neri sowie die Christenlehrbruderschaft der Kapuziner in Obervaz.
Das Band, das die in der rätischen Mission tätigen Weltpriester sowohl organisatorisch als auch personell zusammenhielt, war das Oratorium des heiligen Filippo Neri. Ihm gehörten zunächst die von der Propagandakongregation als Apostolische Missionare eingesetzten Priester Antonio Maria Laus und Taddeo Bolzoni an. 1652 erreichten sie, dass auch Sebastian Rüttimann in Vals (und zeitweise in Untervaz) und Christian Arpagaus in Cazis »unter dem Titel der Mission des Oratoriums [des heiligen Filippo Neri]« agieren konnten.210 Zwei Jahre später versuchten sie, die Mission der Oratorianer über den ebenfalls im Collegio Urbano zum Missionar ausgebildeten Francesco Ratis auf Chiavenna auszudehnen,211 stießen dabei jedoch auf erheblichen Widerstand des Bischofs von Como.212 Dank der persönlichen Intervention des Luzerner Nuntius Federico Borromeo (1654–1665) gelang das Vorhaben 1664 aber doch. Anlässlich seiner Visitation Chiavennas stellte Borromeo klar, dass das Oratorium von ihm, dem Nuntius, rechtmäßig errichtet und eingeführt worden sei. Um Konflikten vorzubeugen, stellte er allerdings strenge Regeln auf, etwa, dass der Vorsteher des Oratoriums jederzeit abgesetzt werden könne, falls er die Jurisdiktion des Bischofs von Como unterminiere.213
Die Unterstützung des Nuntius war nicht zufällig. Das römische Oratorium des Filippo Neri, 1575 vom Papst als Kongregation anerkannt, war eines der Aushängeschilder der von Rom ausgehenden spirituellen Erneuerung des Katholizismus.214 Das Besondere an der oratorianischen Frömmigkeit lag in der »Hinwendung zur Welt und zum Menschen«215. Es ging Filippo Neri und seinen Anhängern weniger um eine asketische Lebensführung als vielmehr um den (karitativen und seelsorgerischen) Dienst am Menschen, um den Aufbau einer spirituellen Gemeinschaft unter den Menschen, ausgedrückt in gemeinsamen Andachten, Gebeten und Prozessionen, sowie um die verstärkte Miteinbeziehung der (männlichen) Laien in diese Gemeinschaft. Die Oratorien des Filippo Neri ermöglichten damit eine intensivierte Beziehung zwischen Laien und Geistlichen und waren daher Ausdruck einer von Italien ausgehenden, die ganze Gesellschaft erfassenden katholischen Reformbewegung, die sich im 17. Jahrhundert nun auch in die Täler im rätischen Alpenraum erstreckte.216 Im Misox führten die Oratorianer-Missionare Laus und Bolzoni regelmäßige Andachten durch, zu welchen sich viele Weltpriester der Umgebung einfanden.217 Dahinter kann eine disziplinierende Absicht vermutet werden. So ermahnten die »Regeln der Brüder der Kongregation des Oratoriums des heiligen Filippo Neri« etwa die Mitglieder, nicht mit »schlechten Menschen« zu verkehren, nach Möglichkeit keine »vertraulichen Gespräche mit Frauen« zu führen und nicht an Glücksspielen, Lotterien und Theatern teilzunehmen.218 Zudem bestanden strenge Aufnahmekriterien: Während einer 15-tägigen Probezeit mussten insbesondere die Laien unter Beweis stellen, dass sie eine für die Kongregation würdige Frömmigkeits-haltung an den Tag legten. Sie mussten an allen Exerzitien der Bruderschaft – bestehend aus Lesungen, Ermahnungen, Meditationen und Litaneien219 – teilnehmen, an den Sonntagen zur Kommunion gehen und Beichten ablegen; zudem waren sie angehalten, jeden Tag nach dem Aufstehen kniend zu Maria und Filippo Neri zu beten.220 Nach der Probezeit stimmten die bereits eingeschriebenen Mitglieder über die Aufnahme ab. Während sich die Priester wahrscheinlich täglich, sicher aber jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags zu gemeinsamen Andachten trafen, standen für die Laien vor allem die Sonn- und Feiertage, insbesondere die Feste von Filippo Neri, Antonius Abt (der Patron Chiavennas) sowie die Adventswochen im Zentrum der bruderschaftlichen Frömmigkeitspraxis. An solchen Tagen kamen laut Antonio Maria Laus im Misox bis zu dreihundert Personen zusammen, um die Predigten der Oratorianer zu hören und mit ihnen gemeinsame Andachten zu feiern.221