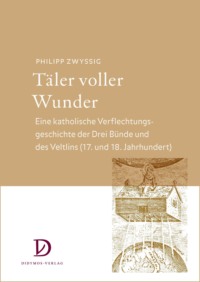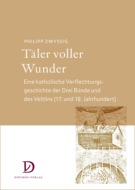Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 8
Die Beliebtheit der Kongregation des Filippo Neri bei den Laien beruhte auf zwei Faktoren: Erstens gelangten über das Oratorium Reliquien des Titelheiligen ins Missionsgebiet. Mit den Neri-Reliquien führten die Oratorianer Konversionsrituale durch, heilten Krankheiten, vertrieben böse Geister und bekämpften Hexerei und Schadenzauber.222 Die Laien schätzten solche Praktiken sehr, versprachen sie doch einen ganz konkreten Nutzen und Hilfe in prekären Lebenssituationen. Zweitens profitierten die in der Kongregation eingeschriebenen Laien von den Ablässen, die Papst Gregor XV. (1621–1623) den im Herrschaftsgebiet der Republik Venedig errichteten Neri-Bruderschaften gewährt hatte:223 Am Tag des Eintritts in die Bruderschaft erhielten die Mitglieder einen vollkommenen Ablass, einen ebensolchen bei ihrem Tod, sofern sie die Sakramente empfingen oder wenigstens den Namen Jesu aussprachen; einen vollkommenen Ablass bekamen diejenigen, welche an Mariae Himmelfahrt (15. August) beichteten und die Kommunion empfingen; weitere Ablässe von einigen Jahren gab es als Belohnung für den Besuch von Kranken oder für bestimmte Gebete.
Mithilfe dieser vom Papst gewährten und bei den Laien sehr beliebten Ablässe vermochten die Oratorianer einerseits die Frömmigkeitspraxis und das kirchliche Leben mitzubestimmen. Andererseits konnten sie mit ihnen eine Bindung der lokalen Kultgemeinschaften an den katholischen Süden (hier Venedig), besonders aber an die römische Kurie aufbauen.224 Ähnliche Mechanismen lassen sich auch bei den von den Kapuzinern in den Drei Bünden errichteten Bruderschaften erkennen. Wie oben gesehen, entstanden im Missionsgebiet zahlreiche Christenlehrbruderschaften, die ihren Funktionären und Mitgliedern zu Ablässen verhalfen. Voraussetzung dafür war ein hierarchisch aufgebautes System der Privilegiendistribution: Um 1680 gliederte der Kapuziner Bernardo da Marone die Christenlehrbruderschaft von Obervaz mit Erlaubnis des Churer Bischofs an die entsprechende Erzbruderschaft in Rom an.225 Dadurch kamen ihre Mitglieder automatisch in den Genuss jener »Ablässe, Gnaden und Privilegien«226, die der Papst der römischen Erzbruderschaft zugebilligt hatte, ohne dass an der Kurie eigens darum hätte gebeten werden müssen. Außerdem erhielt die Obervazer Bruderschaft die Erlaubnis, in den Drei Bünden selbst Zweigniederlassungen zu errichten.227 In der Folge gründeten die Kapuziner solche Filialbruderschaften 1689 in Tiefencastel und Alvaneu, 1690 in Sumvitg, Riom und Savognin, 1693 in Cumbel, 1695 in Trimmis (durch einen Weltpriester), 1724 in Disentis, 1725 in Sagogn, 1744 in Camuns und 1751 in Bivio und Marmorera.228 Sie alle profitierten von den Privilegien und Ablässen der Obervazer Bruderschaft.
An dieser organisatorischen Verschränkung und Vernetzung der Christenlehrbruderschaften sind mit Blick auf die Leitfrage nach den translokalen Verflechtungen des Katholizismus im rätischen Alpenraum zwei Elemente bemerkenswert: Erstens waren die Kapuziner aus der Ordensprovinz Brescia die treibenden Kräfte dahinter. Dies zeigte sich unter anderem darin, dass die gedruckten Bruderschaftsregeln nichts anderes als rätoromanische Übersetzungen der in der Provinz Brescia gebräuchlichen Bruderschaftsbücher waren.229 Mit den engen Beziehungen der rätischen Mission nach Brescia dürfte es denn auch zu erklären sein, dass die Vielzahl von Christenlehrbruderschaften in Graubünden ihrem Fehlen in der katholischen Innerschweiz gegenübersteht.230 Zweitens ist die ausdrückliche Betonung der von Rom ausgehenden Kirchenhierarchie augenfällig. In den Bruderschaftsbüchern wird die Aufmerksamkeit des Lesers auf die päpstlichen Bewilligungen gelenkt und diejenigen Kardinäle und hohen Prälaten aufgezählt, die den Anschluss der Obervazer Christenlehrbruderschaft an die Erzbruderschaft in Rom ermöglicht hatten.231 Außerdem wird betont, dass die Bruderschaft erst als rechtmäßig errichtet gelte, wenn der Bischof sie offiziell bewilligt habe.232 In der Praxis bedeutete dies, dass die eigentliche Gründung vom Ortsbischof ausgehen musste. Erst nach dem bischöflichen Gründungsakt galt die Bruderschaft offiziell als errichtet und konnte nach einer Bezahlung eines bestimmten Geldbetrages an die römische Erzbruderschaft aggregiert werden.233 Wie die Visitationsprotokolle234 und die vom Bischof bestätigten Bruderschaftsurkunden235 zeigen, legten die Bischöfe in der Tat großen Wert auf die Kontrolle des Bruderschaftswesens. Weil bei der Angliederung lokaler Bruderschaften an die römischen Vorbilder auch auf diese jurisdiktionellen Befindlichkeiten des Ortsbischofs Rücksicht genommen wurde, waren die Ablässe und Privilegien der Christenlehrbruderschaften besonders geeignete Mittel, um institutionelle Verbindungen zwischen den katholischen Gemeinden, der Bistumsleitung und der römischen Amtskirche aufzubauen.
2.2.5. Fazit: Intensivierte Verflechtung
Als der Churer Bischof 1643 die Pfarreien in seiner Diözese visitierte, stieß er in so mancher Kirche im Bündner Oberland auf Tabernakel, die mit roter Seide ausgeschlagen waren.236 Dies ist bemerkenswert, weil das Rituale Romanum hierfür eigentlich weißen Seidenstoff vorsah. Man könnte dies mit einer noch unvollständigen Durchsetzung der römischen Liturgiereform interpretieren. Der Umstand aber, dass die rote Seide dem ambrosianischen, das heißt mailändischen Ritus entsprach, lässt eine andere Erklärung zu. Demnach wäre die katholische Kirche in den Drei Bünden und in ihren Untertanengebieten als integraler Bestandteil eines oberitalienischen Kultur- und Lebensraums237 zu verstehen. Tatsächlich zeigen die Befunde der vorangegangenen Kapitel, dass die katholische Kultur und Gesellschaft im rätischen Alpenraum in mancherlei Hinsicht tiefgehende Verflechtungen mit dem katholischen Süden aufwies. Auch wenn die Drei Bünde als Land der Pässe natürlich schon vorher rege wirtschaftliche, politische und wohl auch kulturelle Beziehungen über die Grenzen hinweg unterhielten, lassen sich die intensivierten katholischen Verflechtungen mit Norditalien in einer bestimmten historischen Phase in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts verorten. Damals wetteiferten verschiedene fremde Mächte um Einfluss im strategisch wichtigen rätischen Alpenraum und sie taten dies vor allem auch mit einer religiös-konfessionellen Argumentation: Sowohl die Habsburger als auch Frankreich und die Republik Venedig stellten sich als Verteidiger des durch das Ausbreiten der Reformation bedrohten Katholizismus dar, um ihr Eingreifen in die politischen Verhältnisse der Drei Bünde zu rechtfertigen. Unter der schützenden Hand dieser europäischen Großmächte kamen Kapuziner aus der helvetischen und Brescianer, später auch aus der Mailänder Ordensprovinz in die Drei Bünde und nahmen die Rekatholisierung protestantischer Täler in Angriff. Im Veltlin lehnten sich die katholischen Untertanen mit tatkräftiger Unterstützung von außen gegen die Bündner Herren auf. Unter diesen Bedingungen waren die politisch-herrschaftlichen Grenzziehungen in der Zeit von 1620 bis etwa 1640 insgesamt fluid: Das Unterengadin und Prättigau sahen sich zeitweilig unter österreichische Herrschaft, das Veltlin unter spanische beziehungsweise französische Protektion gestellt.
In der Geschichtsschreibung hat man lange angenommen, dass die in dieser Zeit aufgebauten Beziehungen gegen außen mit der Wiederherstellung der politisch-rechtlichen Verhältnisse bis spätestens um 1650 endeten.238 Demgegenüber haben die vorangehenden Ausführungen auf eine bemerkenswerte Kontinuität des auswärtigen Einflusses hingewiesen. Gerade auf der personellen Ebene brachen die in der gegenreformatorischen Ära aufgebauten Verbindungen nicht ab: Viele der italienischen Kapuziner, die in den 1620er- und 1630er-Jahren den Protestantismus mittels einer strikten Konversionspolitik aus dem Engadin zu vertreiben suchten, betreuten später katholische Pfarreien und waren um eine Erneuerung des katholischen Glaubenslebens besorgt.239 Einige ihrer Nachfolger verfassten religiöse Lieder-, Gebets- und Andachtsbücher in rätoromanischer Sprache und trugen so Entscheidendes zur Ausbildung einer spezifisch katholischen Konfessionskultur bei. Unterstützt wurden sie dabei von der Kurienkongregation de Propaganda Fide, die sich 1622 der rätischen Mission annahm, zunächst mit dem Ziel, eine Rückgewinnung protestantischer Gebiete in die Wege zu leiten, ab den späten 1630er-Jahren in der Absicht, den Katholizismus im rätischen Alpenraum konfessionell zu festigen. Noch im 18. Jahrhundert protegierte, finanzierte und organisierte sie die (innerkatholischen) Missionstätigkeiten in den Drei Bünden. Sie sorgte für eine stetige und teilweise institutionalisierte Verbindung zwischen Rom und der katholischen Gesellschaft im rätischen Alpenraum. Darüber hinaus traten jene politischen Akteure, die zuvor den Kampf gegen den protestantischen Einfluss forciert hatten, nach der Mitte des 17. Jahrhunderts als finanzielle Unterstützer von katholischen Schulen, Kirchenbauprojekten und Kapuzinerhospizen in Erscheinung, wie am Beispiel des Mailänder Senators Francesco Maria Casnedi gezeigt werden konnte. Casnedi und Konsorten unterstrichen damit auch auf der kulturellen Ebene die Machtstellung Mailands in der Region, die mit dem Mailänder Kapitulat von 1639 auf lange Zeit festgeschrieben werden konnte. Weder Frankreich noch Österreich (zumindest bis zum Herrschaftswechsel im Herzogtum Mailand 1714) konnten in der Folgezeit ähnlichen Einfluss im rätischen Alpenraum geltend machen, was sich bezeichnenderweise auch in der Ausrichtung des Bündner und – noch stärker – des Veltliner Katholizismus nach Süden niederschlug.
Alle die genannten Akteure sorgten dafür, dass die katholische Kultur und Gesellschaft im rätischen Alpenraum grenzüberschreitend verflochten war, es also vielschichtige Interdependenzen mit externen Einflusssphären gab. Selbst Bereiche wie die rätoromanische Schriftkultur, das ländliche Schulwesen oder die Laienbruderschaften, die bisher stets unter dem Gesichtspunkt ihrer lokalen Spezifika untersucht wurden, standen ganz im Zeichen von grenzüberschreitenden Interaktionen. Letztere hätten kaum ihre Wirkung entfaltet, wären sie einmalig geblieben. Entscheidend war, dass die einmal aufgenommenen translokalen Beziehungen immer wieder aktiviert wurden – sei es aus Gewohnheit, sei es aus Opportunität oder aus Kosten-Nutzen-Erwägungen. Die Folge war, dass eine Entscheidung in Rom, Mailand, Innsbruck oder anderswo sich unmittelbar auf die Kultur und die Gesellschaft einer katholischen Gemeinde in den Drei Bünden auswirken konnte. Auf der anderen Seite mochten auch Diskurse und Ereignisse im rätischen Alpenraum zuweilen zu Anpassungsleistungen von außerhalb des rätischen Alpenraums angesiedelten Instanzen führen, insbesondere was deren Strategien, Entscheidungsfindungsprozesse und kommunikativen Praktiken anbetraf. Am Beispiel der Drei Bünde mit ihren Untertanengebieten lässt sich somit vortrefflich zeigen – so das Hauptargument der vorliegenden Arbeit –, dass die katholische Glaubensgemeinschaft in der Frühen Neuzeit translokal verflochten war. Im nachfolgenden Kapitel wird versucht, diese translokale Verflechtung katholischer Spielart als zunehmende Verdichtung von Kommunikationszusammenhängen zu beschreiben.
2.3. Verdichtete Kommunikation: Akteure und Praktiken der grenzüberschreitenden Informationsbeschaffung
Die vor Ort wirksam werdenden, aber weit über das lokale Umfeld hinausreichenden personellen, kulturellen und politischen Beziehungen der katholischen Gesellschaft der Drei Bünde und ihrer Untertanengebiete, von denen wir bis hierhin ein klares Bild erhalten haben, waren nur die eine Seite einer Entwicklung, die in der vorliegenden Arbeit als translokale Verflechtung beschrieben wird. Wortwörtlich auf der anderen Seite anzusiedeln sind Akteure in Rom, Mailand oder anderen katholischen Machtzentren, welche diese Beziehungen zu bestimmten Zwecken herstellten, aufrechterhielten und verwalteten. Ansatzweise sind diese Vorgänge zumindest für die weltlichen Mächte, insbesondere für die Veltlin- und Graubündenpolitik der spanischen Krone bekannt.240 Noch weitgehend unerforscht hingegen sind in dieser Hinsicht die Versuche zentraler Kircheninstanzen, Einfluss auf Religion und Gesellschaft in den Drei Bünden und im Veltlin zu nehmen. Das vorliegende Kapitel nimmt dieses Desiderat auf und wertet römische Quellenbestände mit Blick auf die Frage aus, inwiefern die päpstliche Kurie, insbesondere die Kongregation de Propaganda Fide, in der Lage war, langfristig wirksame Kommunikationszusammenhänge zwischen dem rätischen Alpenraum und Rom zu etablieren. Der Begriff »Kommunikationszusammenhang« dient dabei als Kategorie der Beschreibung und bedarf, da er in die Geschichtswissenschaft bisher noch nicht systematisch eingeführt wurde, an dieser Stelle einer Erläuterung.241 Ein Kommunikationszusammenhang stellt sich ein, wenn in unterschiedlichen Kontexten dieselben Begrifflichkeiten, Argumentationsmuster und Topoi geteilt und zur Grundlage von Handlungen und Handlungserwartungen gemacht werden. Es handelt sich um einen prozessualen Vorgang, der idealtypisch in etwa die folgenden Etappen aufweist: Am Anfang steht die Errichtung eines oder mehrerer Kommunikationskanäle, über die Informationen ausgetauscht, Argumentationen vermittelt und personale Beziehungen aufgebaut werden. Je häufiger ein Kommunikationskanal genutzt wird und je länger er aktiv ist, desto effektiver erscheint er.242 In der Folge greifen weitere Akteure auf ihn zurück, indem sie die über ihn transportierten Argumentationsmuster und die ihn auszeichnenden kommunikativen Codes übernehmen. Sie tun dies zwar mit eigenen Interessen und Handlungslogiken, doch führt allein schon diese (instrumentalisierende) Aneignung dazu, dass die entsprechenden Argumentationsmuster sich verfestigen und immer verbindlicher werden. Für den Historiker ist entscheidend, dass die so entstehenden Kommunikationszusammenhänge »pfadabhängig«243 sind, das heißt sich aus einer bestimmten historischen Konstellation heraus entwickelt und entsprechend bestimmter Interessenlagen weiter ausdifferenziert haben. Hier setzten die nachfolgenden Quellenstudien an. In einem ersten Schritt soll es darum gehen, die Etablierung von Kommunikationskanälen nachzuzeichnen (3.1.). Es wird gefragt, über welche Akteure und mit welchen kommunikativen Praktiken sich die Kurienkongregation de Propaganda Fide Kenntnisse über die politischen, kulturellen und religiösen Verhältnisse im rätischen Alpenraum verschaffte. Für diese Untersuchung eignet sich das von Arndt Brendecke in seiner Studie zur Verwaltung des spanischen Kolonialreichs entwickelte Konzept des »kommunikativen Settings«. Es geht davon aus, dass sich Kommunikation innerhalb eines bestimmten »Gefüge[s] an Bedingungen«244 abspielt, also von jeweils spezifischen Situationen und Akteurskonstellationen bestimmt wird. Das »kommunikative Setting« stellt »weder Ideen, noch Verfahren, noch Medien an den Anfang«, sondern »zentriert Akteure und beschreibt deren Optionen, zu kommunizieren, zu handeln oder zu wissen«245. Für die vorliegende Untersuchung bedeutet dies, den Aufbau von grenzüberschreitenden Kommunikationskanälen als soziale Praxis der daran beteiligten Akteure beziehungsweise als Praxis der sozialen Verflechtung zu beschreiben. In einem zweiten Schritt soll dann gezeigt werden, wie es der Propagandakongregation in diesen »kommunikativen Settings« gelang, administratives Wissen über die kirchlich-religiösen Verhältnisse im rätischen Alpenraum zu generieren (3.2.). Wir werden sehen, dass dieses Wissen nicht unabhängig von spezifischen Akteurskonstellationen und Kontextbedingungen war und daher als Hervorbringung bestimmter »epistemischer Settings«246 zu betrachten ist. Es wird folglich darum gehen, die Diskurse und kontextspezifischen Sprechweisen dieser »epistemischer Settings« zu beschreiben und in den jeweiligen Handlungskontexten zu verorten.
2.3.1. Informanten und Agenten
Um den Nutzen von Missionen in katholischen Gemeinden einschätzen und über ihre strategische Ausrichtung befinden zu können, war die Propagandakongregation auf Informationen über die Verhältnisse vor Ort angewiesen. Sie baute deshalb ein Netz von Informanten und Agenten auf, über das sie sich Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten aneignen konnte.247 Mit Informanten sind hier namentlich im Missionsgebiet agierende Akteure gemeint, die in Briefen und Relationen von ihren Beobachtungen berichteten. Dazu kann in gewissem Sinne auch der Nuntius in Luzern gezählt werden, zumal er dazu angehalten war, in regelmäßigen Abständen das Veltlin, die Churer Diözese und insbesondere die rätische Mission zu visitieren. Als Agenten werden demgegenüber Personen verstanden, die an der römischen Kurie die Interessen der Bischöfe von Chur und Como, des Kapuzinerordens oder einer Bündner Gemeinde vertraten. In ihrer Funktion als »Beziehungsmakler« hielten auch sie die »Kommunikation zwischen Zentrum und Peripherie«248 aufrecht und formten auf diese Weise die römische Wahrnehmung des rätischen Alpenraums entscheidend mit.
2.3.1.1. Netzwerke der römischen Amtskirche
In ihrem Bemühen, einen umfassenden Wissensbestand über die kirchlichen, kulturellen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im rätischen Alpenraum aufzubauen, griff die Kurienkongregation de Propaganda Fide auf zwei grundverschiedene Verfahrensweisen zurück, die dem modernen Betrachter als nicht miteinander vereinbar erscheinen mögen, in der Logik frühneuzeitlicher Akteure aber durchaus sich ergänzende Wege der Informationsgewinnung darstellten. Erstens versuchten die Kardinäle in Rom so etwas wie einen formellen Instanzenweg aufzubauen, indem sie bemüht waren, sämtliche, den Bischof von Chur und die rätische Mission betreffenden Informationsflüsse über die Nuntiatur in Luzern oder andere hohe Prälaten wie den Erzbischof von Mailand laufen zu lassen. Zweitens verfügte die römische Kurie wie andere Fürstenhöfe über ein breites Repertoire an symbolischen Ressourcen, mit denen sich unabhängig von institutionalisierten Außenstellen (z. B. einer Nuntiatur) informelle Beziehungen oder Kanäle zu einzelnen Akteuren vor Ort aufbauen ließen,249 die sich dann im Idealfall zu einer Gegenleistung in Form von Informationen oder anderen informellen Dienstleistungen verpflichtet sahen.250 Im Folgenden soll es darum gehen, in der gebotenen Kürze Beispiele für beide Arten der Informationsbeschaffung zu schildern und auf die wichtigsten Akteure aufmerksam zu machen.
Obschon die Kapuzineroberen in Brescia und Mailand in der Regel der ihnen auferlegten Pflicht nachkamen, die Propagandakongregation mit regelmäßigen Berichten über die Vorgänge in der rätischen Mission zu informieren,251 legten die Kurienkardinäle besonderen Wert auf die diesbezüglichen Einschätzungen des Nuntius in Luzern. Von Zeit zu Zeit wurden die päpstlichen Vertreter in der Eidgenossenschaft angehalten, die Mission persönlich zu visitieren. Während dies im 17. Jahrhundert vor allem situationsabhängig geschah, wenn also die Visitation aufgrund bestimmter Konflikte in und um die Mission notwendig wurde,252 scheint es im 18. Jahrhundert zu einer gewissen Institutionalisierung dieses Informationskanals gekommen zu sein. Das Protokoll der Propagandakongregation vom 18. Dezember 1724 hielt fest, dass Nuntius Domenico Passionei, selbst ehemaliger Sekretär der Propaganda Fide,253 eine Visitation im Missionsgebiet der Kapuziner aus Brescia durchgeführt und anschließend einen ausführlichen Bericht nach Rom gesandt habe. Beeindruckt von der »sehr differenzierten und exakten Relation samt einer angefügten geographischen Karte, sodass die Kardinäle mit aller Klarheit und Leichtigkeit sich die Situation vor Augen führen konnten«254, erließen die Kongregationskardinäle die Weisung, in Zukunft solle jeder Nuntius mindestens einmal in seiner Amtszeit die Mission visitieren und darüber einen Bericht nach Passioneis Vorbild verfassen. Nur so könne man nämlich adäquate Befehle erteilen, was besonders wichtig sei, weil das Missionsgebiet gewissermaßen als »Vormauer und Tor zu Italien«255 fungiere.
Solche ausführlichen Berichte der Nuntien hatten einen großen Einfluss darauf, welchen Stellenwert der rätische Alpenraum in der Konfessionspolitik der päpstlichen Kurie erhielt. Sie waren folglich für Grundsatzentscheide der Propagandakongregation über die Ausrichtung und die Organisation der Mission eminent wichtig. Darüber hinaus sollte die Luzerner Nuntiatur nach Meinung der Propagandakongregation aber auch im »Alltagsgeschäft«, das heißt bei konkreten Fragen wie der Absetzung von Missionaren als Informationskanal dienen und, wenn nötig, aktiv mitentscheiden. Im April 1641 wies Francesco Ingoli (1578–1649), Sekretär der Propagandakongregation, den Vizepräfekten der Kapuzinermission an, seine Briefe nach Rom ausschließlich über den Nuntius in Luzern zu senden.256 Notwendig wurde dies, weil der Bischof von Chur sich gegen einen Entscheid der Missionsleitung auflehnte und Ingoli offenbar befürchtete, der Bischof könnte die ihm unliebsame Korrespondenz abfangen oder verfälschen. Tatsächlich bat Pater Ireneo bei anderer Gelegenheit, man solle gut überlegen, an wen man die für ihn bestimmten Briefe adressiere, denn in Chur gebe es »gute Hände, die Briefe zu öffnen, auch solche von Prälaten«257. In der Sache ging es um die Abberufung zweier Missionare aus dem gemischtkonfessionellen Cazis, die der Vizepräfekt der Mission mit Zustimmung der Propagandakongregation angeordnet hatte, weil nach seiner Einschätzung besonders einer von ihnen, Pater Francesco Maria da Velletri, »fehlerhaft« war.258 Letzterer wehrte sich jedoch gegen den Entscheid und erhielt Unterstützung vonseiten des Bischofs und des Dompropsts der Churer Kathedrale. Beide schrieben an Ingoli, Pater Francesco Maria sei ein ausgezeichneter Missionar und derart beliebt bei der Bevölkerung, dass sein Abzug große Unruhen auslösen würde.259 In Rom war man also mit zwei unterschiedlichen Meinungen über ein und dieselbe Person konfrontiert. Auf welcher Grundlage sollte man entscheiden? Die Propaganda Fide unterstützte letztlich den Vizepräfekten. Ingoli wies den Nuntius an, er solle »kraft seines Amtes entweder mündlich oder per Brief«260 ein Machtwort sprechen und dem besagten Kapuziner die Missionsfakultät entziehen. Der Nuntius habe die entsprechende Befugnis, dies jederzeit zu tun, schrieb er als Begründung dem Missionspräfekten.261 Ausschlag gegeben haben mochte, dass die Kurienkongregation die selbst definierten Zuständigkeitsbereiche nicht infrage stellen wollte. Der Vizepräfekt hatte von der Propaganda Fide die Fakultät erhalten, genau solche Entscheidungen zu fällen,262 etwas dagegen einzuwenden wäre nur dem Nuntius vorbehalten gewesen. Dass der Churer Bischof den Nuntius umging und sich über zwei ihm loyal ergebene Kapuziner direkt in Rom in die Angelegenheit einmischte,263 mochten die Kardinäle nicht goutieren. Zudem zeigte sich hier deutlich, dass Bischof und Nuntius sich in einem gewissen Konkurrenzverhältnis befanden, wenn es darum ging, als Informationskanal für römische Kongregationen zu dienen. Beide beanspruchten mit Verweis auf ihr Amt für sich, erster Ansprechpartner für Nachrichten und Beurteilungen der Situation vor Ort zu sein.
Für die Luzerner Nuntiatur waren solche konkurrierenden Kommunikationskanäle an die päpstliche Kurie ein ständiges Problem. Es sei wahrhaft untragbar, gestand man in Rom ein, dass sich die Bündner Gemeinden jedes Mal »heimlich mit ihren Briefen« an die Propagandakongregation wenden, wenn der Nuntius den Abzug von Missionaren aus einer Gemeinde beschlossen habe.264 Damit war die Kurienkongregation de Propaganda Fide gewissermaßen Opfer des eigenen Anspruchs geworden, auch in peripheren Gebieten als maßgebende Instanz aufzutreten, deren Entscheide als Akt der »Gnade«265 zu verstehen waren. Die Folge war, dass verschiedenste, häufig auch disparate Anliegen an sie herangetragen wurden. Nicht selten widersprachen die in Rom eingegangen Informationen von direkt betroffenen Akteuren oder Gemeinden den vom Nuntius an die Kurie gesandten Berichten. Sich dessen bewusst, wandte sich Nuntius Francesco Boccapaduli (1647–1652) proaktiv an einen einflussreichen Kardinal, wahrscheinlich den Präfekten der Propagandakongregation, und gab zu verstehen, dass die Informationen, die er zu geben habe, wahrscheinlich konträr zu denjenigen seien, welche andere Berichterstatter der Kongregation zukommen ließen.266 In der betreffenden Angelegenheit ging es um kirchliche Jurisdiktionsrechte in Thusis, welche der Churer Bischof offenbar zu veräußern bereit war. Dies sei hier erwähnt, weil es charakteristisch für jene Informationen ist, welche die Luzerner Nuntiatur zu liefern in der Lage war: In der Hauptsache waren es Auskünfte über kirchenrechtliche Verhältnisse und religionspolitische Entscheidungen auf den Bundestagen der Drei Bünde, über die finanziellen Zustände des Bistums, den organisatorischen Aufbau der rätischen Mission und über einzelne Personen. Die Religion beziehungsweise die Glaubenspraxis oder die religiöse Kultur wurden in den Briefen und Berichten der Nuntien nur sehr selten verhandelt.
Auch in der direkten Korrespondenz der Bischöfe von Chur mit der Propagandakongregation waren kirchenpolitische Angelegenheiten die bestimmenden Themen. Der Churer Ordinarius unterlag in gewisser Hinsicht einer Informationspflicht gegenüber Rom. Johann VI. Flugi von Aspermont (1636–1661) beispielsweise wurde mehrfach aufgefordert, die Rechnungsführung des Churer Hochstifts offenzulegen.267 Nur so könnten die Kurienkardinäle und der Nuntius Maßnahmen zum Abbau der Bistumsschulden ergreifen. Gerade so selbstbewusst auftretende Bischöfe wie Johann VI. kamen dieser Pflicht allerdings nur zögerlich nach und fanden Mittel und Wege, selektive Informationen zu streuen.268 Johann VI. setzte hierfür eigens Agenten ein, die in Rom dafür sorgten, dass sich die bischöfliche Berichterstattung gegenüber anderen Informationsquellen durchsetzte. Ganz bewusst umging er mit seinen Agenten in gewissen Angelegenheiten den Weg über den Nuntius,269 der auch für den Bischof verbindlich war und den er in weniger kontroversen Angelegenheiten vielfach auch einhielt.
Von den Bischöfen von Como lässt sich Ähnliches sagen. Auch von ihnen versprach man sich in Rom genaue Kenntnisse über die Verhältnisse vor Ort: »Es wäre gut, wenn der Bischof jeden Monat einen Bericht über das Veltlin, Chiavenna, Bormio und Poschiavo nach Rom senden würde«, empfahl der Kapuziner Cristoforo da Toscolano der Propagandakongregation.270 Und auch sie waren nicht verlegen, selektive Informationen zu liefern, gerade so, dass weder ihre Integrität noch ihre Autorität tangiert wurden. Als in Rom in den frühen 1670er-Jahren die Forderung eintraf, in Chiavenna solle die Mission eingeführt werden, weil dort Fehler in Glaubensdingen vorherrschten, sah sich der Bischof von Como veranlasst, diese Information zu korrigieren, indem er darauf hinwies, dass er Rom gewiss informiert hätte, wenn er auf seinen Visitationen dergleichen hätte feststellen müssen.271 Für den Bischof galt es infolgedessen, mit einer entsprechenden Darstellung der Situation den impliziten Vorwurf, er sei ein schlechter Hirte seiner Schafe, zu entkräften. Angesichts solcher Beispiele kam weiteren Akteuren, die nicht direkt in die Geschehnisse vor Ort involviert waren, eine wichtige Funktion als Informationsquellen zu. An erster Stelle zu nennen sind hier die Erzbischöfe von Mailand. Das folgende Beispiel aus den 1650er-Jahren soll zur Illustration genügen.
Im März 1656 erkundigte sich die Propagandakongregation beim Mailänder Erzbischof Alfonso Litta (1652–1679), was er über einen gewissen Crisostomo Guccia (auch Guggia oder Gugia) wisse.272 Guccia wirkte zu diesem Zeitpunkt als Missionar im Misox, offenbar ohne dass man in Rom davon Kenntnis hatte; eine entsprechende Fakultät im Archiv der Propagandakongregation konnte der Kongregationssekretär jedenfalls nicht finden. Erzbischof Litta nahm sich dieser Sache an und schickte eine »vertrauenswürdige Person« ins Misox, um vor Ort Erkundigungen über Guccia einzuziehen.273 Der Bericht, den der Erzbischof daraufhin nach Rom sandte, offenbart, wie schwierig es für die römische Kongregation effektiv war, die Vorgänge in der Mission im Blick zu halten und »sicheres« administratives Wissen zu generieren: Guccia sei gar kein Kapuziner, wie es den Anschein gemacht habe, sondern ein Franziskaner. Er selbst habe angegeben, aus der Mailänder Ordensprovinz zu stammen, was aber nicht stimme, denn laut einer Auskunft eines Ordensoberen sei er in der römischen Provinz eingekleidet worden. Was die Missionserlaubnis betreffe, so habe Guccia sie eigenen Angaben zufolge von Nuntius Federico Borromeo erhalten.274 Doch auch diese vom Agenten des Erzbischofs eingeholte Information stimmte nicht restlos. Borromeo klärte die Propagandakongregation auf, er habe die von Guccia vorgezeigten Fakultäten für ungenügend befunden und schätze den Lebenswandel Guccias außerdem als sehr bedenklich ein.275 Damit nicht genug: Offenbar gab es nicht einmal gesichertes Wissen über die Herkunft Guccias. Während Littas Bericht ihn als Bündner beschrieb, ist in einer späteren Relation zu lesen, Guccia sei eigentlich ein Italiener, beherrsche aber unterdessen die rätoromanische Sprache des Landes wie ein Einheimischer.276
Um solchen Unklarheiten vorzubeugen, wurden die von der Propagandakongregation im Collegio Urbano ausgebildeten Apostolischen Missionare mittels eines »feierliche[n] Eid[es]«277 verpflichtet, jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht nach Rom zu senden. Nicht zuletzt aus »Dankbarkeit für die weise und ausgezeichnete Bildung […] am Collegio Urbano«278 kamen die Alumni dieser Pflicht nach, taten dies aber in sehr unterschiedlicher Weise. Die Berichte, die aus dem Veltlin in Rom eintrafen, waren meistens sehr kurz gehalten und reichten kaum über eine grobe Beschreibung der Seelsorgeaufgaben hinaus. Ein gewisser Martino Gurini beispielsweise berichtete 1746 aus Pedenosso im Valdidentro (Bormio), was er tue, sei predigen, geistige Exerzitien anleiten, Beichten abnehmen, Christenlehre unterrichten und den Sterbenden die Sakramente spenden.279 An den jährlichen Berichten des in Ardenno und Caspano als Seelsorger wirkenden Santi Pradè fällt überdies auf, dass sich ihr Wortlaut über mehrere Jahre, ja gar Jahrzehnte kaum veränderte.280 Für die Propagandakongregation dürfte in diesem Fall der Informationsgehalt weniger wichtig gewesen sein als die symbolisch zum Ausdruck kommende Aufrechterhaltung der Rombindung.281 Die Informantentätigkeit war hier vor allem auch Ausdruck einer sozialen Bindung, gewissermaßen die informelle Gegenleistung für die erhaltene Bildung in Rom.