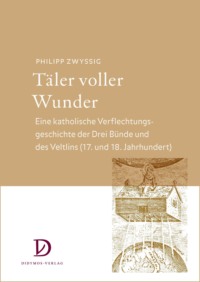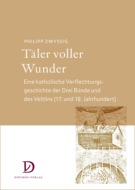Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 9
Anders verhielt es sich mit den Missionsberichten aus dem Misox, verfasst vom ebenfalls am Collegio Urbano ausgebildeten Priester Antonio Maria Laus und seinem Gefährten Taddeo Bolzoni282. Sie kommentierten einerseits die politischen Vorgänge in den Drei Bünden,283 enthielten andererseits detaillierte Schilderungen von Konversionen, Exorzismen, Wundergeschichten und Kirchenbautätigkeiten.284 Aus ihnen geht deutlich hervor, welche religiösen, moralischen und sittlichen Zustände die Missionare als unhaltbar erachteten und wie sie dagegen vorzugehen gedachten – etwa mittels Förderung des Ablasswesens, Gründung von Bruderschaften oder der Einführung neuer Frömmigkeitspraktiken wie zum Beispiel des Vierzigstundengebets.285 Dank dieser Berichte nahm in Rom das Wissen über die religiösen Verhältnisse im Misox zu, auch wenn die Kardinäle wohl wussten, dass die von Laus und Bolzoni gelieferten Informationen in gewisser Hinsicht zu relativieren waren: Bekanntermaßen waren beide erbitterte Gegner der Kapuzinermission im Misox, ihre Schilderung der religiösen Missstände und die Hervorhebung der eigenen Verdienste demzufolge auch als Argumente für die Ausweisung der Ordensbrüder zu werten. Kam hinzu, dass Laus und Bolzoni die Interessen des römischen Oratoriums von Filippo Neri vertraten, über dessen Vorsteher Giovanni Giovanucci sie in der Regel die Briefe und Berichte der Propagandakongregation zukommen ließen.286 Sie schilderten darin jeweils ausführlich die Konversionen, die sie mithilfe der Reliquien des heiligen Filippo Neri herbeigeführt hatten, und untermauerten damit die Notwendigkeit, das Oratorium im Misox, aber auch in Chiavenna einzuführen.
Was die Situation in Chiavenna betraf, war die römische Kurie aus anderer Quelle bestens informiert. Ein gewisser Carlo Pestalozza287 aus Chiavenna, seit mehreren Jahren angeblich im Amt eines »Vikars der obersten Inquisitoren Roms«288, versorgte die Propagandakongregation im Zeitraum von 1641 bis 1655 regelmäßig mit Informationen über die politischen Vorgänge im Veltlin, insbesondere über die Bündner Amtsträger (Podestà) und Entscheidungen auf den Bundestagen, über die Durchreisen des mailändischen Ambassadors, über die Ankunft von protestantischen Flüchtlingen aus Italien und über die Geschichte der protestantischen Kirchen im Veltlin.289 Er tat dies zunächst aus Chiavenna, ab 1644 dann direkt in Rom.290 Im April 1652 legte er dem Papst eine Relation vor, die im Stile einer geographisch-politischen Beschreibung ein umfassendes Panorama der Grafschaft Chiavenna zeichnete.291 Zu lesen war darin von den politischen Grenzen Chiavennas und des Veltlins mit Mailand, Venedig, Österreich und den Drei Bünden, von den Verkehrs-, Handels- und Postwegen und von der Ausbreitung der protestantischen Kirche in der Region. Auf den letzten Punkt legte Pestalozza besonderen Wert. Der Protestantismus könne sich ungehindert in Chiavenna ausbreiten, weil weder die Bündner, bei denen ja bekanntlich die Protestanten in der Mehrheit seien, noch der Bischof von Como etwas dagegen unternehmen würden. Aus diesem Grund schlage er vor, so Pestalozza, die Propaganda Fide solle einen vom Bistum Como unabhängigen Missionar als »Visitator und apostolischer Kommissar« nach Chiavenna schicken.292 Laut Pestalozza waren von diesem Missionar insgesamt neun »Früchte« zu erwarten, die man der Einfachheit halber in zwei Gruppen einteilen kann: Zum einen weist Pestalozza darauf hin, dass so der Ausbreitung der reformierten Kirche südlich der Alpen entgegengewirkt und damit Italien vor der »Häresie« bewahrt werden könne. Zum anderen werde sichergestellt, dass der katholische Glaube in dieser Region sich verfestige. Diese Argumentation schien auf den ersten Blick nachvollziehbar und ganz im Sinne der römischen Konfessionspolitik zu sein. Ganz anderer Meinung war indessen der Bischof von Como. Gegenüber dem Sekretär der Propagandakongregation betonte er, die in Rom zur Kenntnis genommenen Berichte über die aktuellen religiösen Zustände in Chiavenna stammten nicht von dort selbst. Sie seien von einer Person verfasst worden, die in Rom wohne und aus »privaten Interessen« – getarnt als »öffentliche Interessen des Katholizismus« – absichtlich falsche Informationen liefere.293 So ganz aus der Luft gegriffen war dieser Vorwurf des Bischofs wohl nicht, denn offenbar versuchte Pestalozza tatsächlich die Kardinäle und den Papst mehrmals dazu zu bewegen, ihn gegen den Willen des Bischofs zum Erzpriester von Chiavenna zu ernennen.294 Hier kommt zum Vorschein, dass Pestalozza die Information oder Desinformation über eine weitab von Rom gelegene Region gezielt als Ressource einsetzte, um – in Umgehung des Ortsbischofs – an Sozial- und Ehrkapital der katholischen Kirche – hier an das Amt des Erzpriesters oder wenigstens an den Status eines Missionars – zu gelangen. Ob er damit Erfolg hatte, ist nicht restlos aufzulösen. Bekannt ist, dass er im September 1653 wieder in seiner Heimat war, dort im Haus des Erzpriesters wohnte und zumindest vom Sekretär der Propagandakongregation auch als »Arciprete Pestalozza di Chiavenna« angeschrieben wurde.295 In der sonst so erschöpfenden lokalhistorischen Literatur über Chiavenna und das Bistum Como ist allerdings nichts von einem Erzpriester Carlo Pestalozza zu lesen.296 Festzuhalten bleibt, dass Pestalozza erkannt hatte, wie sich mit gezielt platzierter Information die römische Kurie in einen eigentlich lokalen Konflikt mit dem Bischof miteinbeziehen ließ.
In dieser Hinsicht war Pestalozza kein Einzelfall. Auch Giovanni Antonio Paravicini (1588–1659), Erzpriester von Sondrio, versuchte sich gegenüber der römischen Kurie als integrer Informant darzustellen, um im Gegenzug Unterstützung für eine bereits seit Jahren dauernde Kontroverse mit dem Bischof von Como zu erhalten. Im März 1641 bat er die Propagandakongregation, sie möge nicht denen Gehör schenken, die »linkische Informationen« streuten; er hingegen habe in seinen Briefen noch nie Angelegenheiten als wahr dargestellt, obschon sie eigentlich falsch seien.297 Seine regelmäßig an die Propagandakongregation gesandten Berichte298 waren noch etwas umfassender als diejenigen von Pestalozza, mit letzterem teilte er indessen das konfliktive Verhältnis zum Bischof von Como. Der Grund hierfür lag in einem von den Drei Bünden forcierten Projekt, wonach das Veltlin aus der Diözese Como herausgelöst und stattdessen ein von Rom ernannter, aus dem Veltlin stammender Vicario Generale als Inhaber der kirchlichen Jurisdiktion eingesetzt werden sollte.299 Paravicini hegte Ambitionen auf dieses Amt und wurde so für den Bischof von Como zu einer Persona non grata. Umso enger war die Beziehung des Erzpriesters zur römischen Kurie, von welcher er 1653 zum Erzbischof von Santa Severina (Kalabrien) ernannt, damit aber in gewisser Hinsicht auch ruhiggestellt wurde.300 In der Tat hatte sich mit Paravicinis Versetzung der Exemtionsstreit vorerst erledigt. Bald darauf jedoch trat dessen Bruder Francesco in seine Fußstapfen – sowohl als Informant als auch als Anwärter auf das Vikariatsamt. Francesco Paravicini wurde 1671 von Rom als Vicario Generale des Veltlins eingesetzt, musste das Amt aber nach der Wahl des aus Como stammenden Papstes Innozenz XI. (1676–1689) wieder niederlegen.301
Sowohl Paravicini als auch Pestalozza, das sei hier abschließend betont, verfolgten mit dem Zuspielen von Information immer auch Eigeninteressen – und sie wussten, dass dies rivalisierende Akteure ebenfalls taten. Dementsprechend hoben sie jeweils den Wahrheitsgehalt der eigenen, die »Falschheit« anderweitiger Nachrichten hervor. Die Kurienkongregation de Propaganda Fide reagierte auf diese typisch frühneuzeitliche Verschränkung von Informalität und Instrumentalität, indem sie direkte Kommunikationskanäle zu Akteuren errichtete, die entweder aufgrund ihres Amtes (Nuntiatur, Missionspräfektur) oder über Patronageressourcen (Ausbildung, Titel, Missionarsstatus etc.) eng an die Kurie gebunden waren. Es war dies ein Versuch, eine Ordnung in die zunehmend häufiger in Rom eintreffenden, nicht selten disparaten Nachrichten aus dem rätischen Alpenraum zu bringen und so handhabbares administratives Wissen über eine peripher gelegene Region zu generieren. Einige der parallel und gleichzeitig nach Rom verlaufenden Informationskanäle der Propaganda Fide werden in den folgenden, Abschnitten beschrieben.
2.3.1.2. Ordensnetzwerke
Die Zusammenarbeit zwischen dem Kapuzinerorden und der Kurienkongregation de Propaganda Fide scheint in den ersten Jahrzehnten der rätischen Mission gut funktioniert zu haben,302 und dies obwohl Francesco Ingoli (1578–1649), der Denker und Lenker der Propagandakongregation,303 gegenüber Ordensgemeinschaften eher misstrauisch eingestellt war, weil er generell an ihrem Willen und ihrer Fähigkeit zu einer guten »Regierung« und Kontrolle der eigenen Missionare zweifelte.304 Entscheidend dürfte gewesen sein, dass die Interessen des Ordens in der Person des Kapuzinerkardinals Antonio Barberini (1569–1646), Bruder Papst Urbans VIII. (1623–1644) und Onkel des gleichnamigen Präfekten der Propagandakongregation Antonio Barberini (1607–1671), in der Propaganda Fide gut vertreten waren.305 In späterer Zeit fußte die Zusammenarbeit offenbar auf gegenseitigem (informellem) Entgegenkommen: Auf der einen Seite räumte die Propagandakongregation den Vorstehern der im rätischen Alpenraum tätigen Ordensprovinzen »eine größere Handlungsfreiheit ein als den Präfekten anderer Missionsgebiete«306. Auf der anderen Seite verstanden es die Kapuziner, mit regelmäßigen, detaillierten Berichten über die Vorgänge im Missionsgebiet die Kardinäle zufriedenzustellen. Form und Praktiken dieser Informantentätigkeiten sollen im Folgenden einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
Die zeitgenössische Dokumentation über die ersten Jahre der rätischen Kapuzinermission ist umfangreich.307 Sie umfasst ausführliche, zum Teil mehrere hundert Seiten lange Schilderungen über »den Anfang und den Fortgang der Mission«308, über »die bemerkenswertesten Erfolge in Sachen der Religion«309, über allgemeine »Erfolge« im Hinblick auf die »Erhaltung und Propagierung der katholischen Religion«310. Hervorgegangen sind diese Berichte einerseits aus dem Pflichtbewusstsein der Ordensleitung, gegenüber der Propagandakongregation Rechenschaft abzulegen. Andererseits gliederte sich das Missionsschrifttum ein in die ordenseigene Schriftkultur und das organisatorische Selbstverständnis der Kapuziner, das sich durch einen »straffen Zentralismus«311 auszeichnete. Jeder Ordensprovinz stand ein leitendes Gremium, bestehend aus einem Provinzial(minister) und vier Definitoren, vor, welches Informationen über Klöster, einzelne Patres und Missionare zu sammeln, aufzubereiten und bei Bedarf der obersten Ordensleitung (dem Generalminister respektive dem Generalprokurator in Rom) zur Verfügung zu stellen hatte. Ausdruck dieser schriftgebundenen Regierungspraktiken sind die Provinzchroniken, Nekrologen und Lebensbeschreibungen einzelner Kapuziner.312 Über diese Medien, aber auch über Missionare, die in ihre Heimklöster oder zu Ordensversammlungen reisten, zirkulierten Informationen über die rätische Mission innerhalb des Ordensnetzwerkes der Kapuziner.
Für die Propagandakongregation in Rom war das Netzwerk der Kapuziner ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Nachrichten und Informationen aus dem rätischen Alpenraum. In der Lebensbeschreibung des Kapuzinermissionars Cristoforo da Toscolano ist zu lesen, er habe sich »im Interesse der Mission nach Rom begeben«313, um den Kongregationskardinälen, wie von diesen gewünscht, Bericht zu erstatten. Pater Cristoforo war in der Tat einer jener Kapuziner der rätischen Mission, die als Boten und Abgesandte die Kommunikation zwischen den Bündner Tälern und den Machtzentren des Katholizismus aufrechterhielten. Er amtete mehrere Male als Provinzial der Brescianer Kapuziner und nahm als solcher auch an den Generalkapiteln des Ordens in Rom teil.314 1648 weilte er als (inoffizieller) Gesandter des Churer Bischofs auf dem Westfälischen Friedenskongress in Münster.315 Auch wenn Pater Cristoforo in dieser Hinsicht heraussticht, ein Einzelfall war er nicht. Weitere in den Drei Bünden tätige Missionare traten als Vermittler zwischen den Anliegen des Bündner Katholizismus einerseits und der Kurie in Rom, dem Gouverneur von Mailand, dem Erzherzog von Österreich und anderen katholischen Entscheidungsträgern andererseits in Erscheinung. Da diese Boten-, Informanten- und Agententätigkeiten der Kapuzinermissionare bereits an anderer Stelle behandelt wurden,316 soll hier der Hinweis auf zwei Figuren genügen, die im weiteren Verlauf der Untersuchung noch eine zentrale Rolle spielen werden: Der mit den religiös-kultischen Eigenheiten der Bündner Katholiken bestens vertraute Pater Stefano da Gubbio reiste mehrere Male nach Rom, wo er den Anliegen der Bündner Kirche, insbesondere aber jenen des Churer Bischofs, Gehör zu verschaffen vermochte.317 Zudem erhielt er Audienzen beim Erzbischof und beim Gouverneur von Mailand.318 Auch Francesco Maria da Vigevano, der von den Katholiken im Oberhalbstein nach seinem Tod als heiliger Wundertäter verehrt wurde, unternahm mehrere Reisen nach Mailand, an den Hof nach Innsbruck und wahrscheinlich auch nach Rom, stets mit der Absicht, durch Informationen aus erster Hand die katholischen Fürsten zu einer aktiven Unterstützung der katholischen Kirche im rätischen Alpenraum zu bewegen.319
Neben diesen von Zeit zu Zeit mündlich erhaltenen Auskünften stellten die Missionsberichte für die Propagandakongregation die wichtigste Entscheidungsgrundlage bei Missionsangelegenheiten dar. In den ersten Jahrzehnten der rätischen Mission wurden solche Berichte auf ausdrückliche Aufforderung verfasst.320 Sie besaßen eine als solche erkennbare narrative Struktur, waren unterteilt in Kapitel und glichen in ihrer Ausführlichkeit historiographischen Abhandlungen. Deutlich erkennbar ist die Absicht, die Geschichte der rätischen Mission als Erfolgsgeschichte, genauer: als Erfolgsgeschichte des Kapuzinerordens zu schreiben.321 Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts trafen die Missionsberichte dann regelmäßiger in Rom ein und scheinen eine zunehmend standardisierte Form angenommen zu haben. Der Fokus lag nun nicht mehr auf der narrativen Rechtfertigung der Mission insgesamt, sondern auf der detailgetreuen Beschreibung der Verhältnisse im Missionsgebiet. Gegliedert waren diese vom Präfekten der Mission redigierten Berichte nach Missionsstationen, wobei für jede zuerst allgemeine Informationen gegeben und dann sowohl die »körperlichen« beziehungsweise »materiellen« als auch die »geistlichen« beziehungsweise »spirituellen« »Früchte« der Mission aufgezählt wurden. Insofern blieben auch diese Berichte der wirkungsvollen Inszenierung des Missionserfolges verhaftet. Als Beispiel soll hier der Eintrag zu Riom, enthalten in der 1681 verfassten »Auskunft über den Zustand der Missionen der Kapuzinerprovinz Brescia in Rätien«322, angeführt werden. Die Kirchgemeinde Riom liege eine halbe Stunde von Savognin entfernt, sei ganz katholisch, in zwei Ortschaften unterteilt und habe eine Filialkirche, heißt es darin. Die Gemeinde bestehe aus 400 Seelen, die seit 43 Jahren von Kapuzinern betreut würden. Der »körperliche Nutzen« der Mission bestehe darin, dass drei neue Kirchen von Grund auf neu errichtet und kostbar ausgestattet worden seien. In der Kirche diene eine kupferne Lampe als ewiges Licht, das Allerheiligste sei in einem verschließbaren Wandtabernakel mit einem Sichtfenster aufbewahrt – was freilich der reformkatholischen Konzeption sakraler Räume entsprach.323 Zu den »geistigen Früchten« der Mission wird gezählt, dass der Christenlehrunterricht regelmäßig besucht werde, zwei Bruderschaften gegründet worden seien und sich eine Gruppe von Frauen zusammengefunden habe,324 die ihr Leben mit einem Gelübde Gott gewidmet hätten.
Solche Beschreibungen der von den Missionaren betreuten Pfarreien bildeten noch im 18. Jahrhundert den informativen Kern der Missionsberichte, ergänzt nun aber um die Antworten auf das seit 1678 von der Propaganda Fide (für sämtliche Missionen) vorgegebene Frageraster.325 Es handelte sich dabei um einen Fragebogen, bestehend aus 90 Fragen, die in verschiedene Kategorien unterteilt waren. Das erste Fragebündel diente der Erhebung der geografischen und kulturellen Eigenheiten des Missionsgebietes. Erwähnt wurden hier jeweils die karge, gebirgige Landschaft, die wichtigsten Handels- und Verkehrswege, die Schwierigkeiten der rätoromanischen Sprache sowie die rechtlich verbriefte Freiheit, die Konfession nach eigener Gewissensprüfung selbst wählen zu dürfen.326 Es folgten allgemeine Fragen zur Diözese und zur Mission, etwa, welche politischen Zentren es innerhalb der Diözese gebe und welches die einflussreichsten katholischen Familien seien. Weitere Fragekomplexe behandelten den organisatorischen Aufbau der Bistumsleitung sowie die »Riten, Fehler und Missbräuche« in Glaubensdingen. In diesem Zusammenhang interessierten die »häretischen« Bücher und das Gedankengut der Bündner Protestanten, aber auch die Ausstattung der katholischen Kirchen, wobei hier zum Beispiel danach gefragt wurde, ob das Allerheiligste sowie die geweihten Öle richtig aufbewahrt würden.327 Schließlich diente ein Großteil der Fragen der Erhebung des Klerus (Missionare, Ordensgeistliche, Domherren, Kanoniker etc.), wobei die entsprechenden Personen jeweils namentlich erwähnt und, wenn möglich, auch ihr Alter und Bildungsweg angegeben wurden. Insgesamt erhielt die Propagandakongregation in Rom dank des Fragerasters ein recht umfassendes Bild der kirchlich-religiösen und politischen Verhältnisse im rätischen Alpenraum. Es bildete die Basis eines Wissensbestandes, der für wegweisende Entscheidungen wie die Auflösung oder Neugründung von Missionsstationen herangezogen werden konnte.
Woher stammte dieses den Missionsberichten zugrunde liegende Wissen? Verantwortlich für die Relationen war der Präfekt der Mission respektive sein Stellvertreter, der Vizepräfekt. Sie waren verpflichtet, das Missionsgebiet in regelmäßigen Abständen zu visitieren und die gemachten Beobachtungen der Propagandakongregation zu übermitteln.328
Visitationen waren nicht von Anfang an vorgesehen, sondern erwuchsen aus den Erfordernissen der Praxis. Die erste Generalvisitation fand im Jahr 1639 statt. Genau in dieser Zeit wurden einerseits die Schwierigkeiten der auf die Konversion der Protestanten ausgerichteten Missionsstrategie evident, sodass es den Nutzen einer Verschiebung der Mission in katholische Gemeinden abzuwägen galt. Andererseits stand damals zur Diskussion, der Brescianer Kapuzinerprovinz die führende Stellung in der Mission zu entziehen und sie stattdessen den Mailänder Kapuzinern zu übertragen.329 Auch um die daraus entstehenden Konflikte zwischen den Ordensprovinzen beizulegen, setzte die Propagandakongregation den Kapuzinerpater Marino da Calvagese als Generalvisitator ein. Dieser reiste mit seinem Gefährten Timoteo da Brescia ab Juli 1639 von Missionshospiz zu Missionshospiz und fasste seine Beobachtungen in einem ausführlichen Bericht zusammen, der letztlich eins zu eins in die bekannte, von Clemente da Brescia redigierte Geschichte der rätischen Mission (1702) einfloss.330 Der im Umfeld dieser Visitation entstandene Briefverkehr bringt zum Vorschein, dass die Informationsbeschaffung vor Ort den lokalen Akteuren immer auch als Anlass diente, ihre Anliegen einzubringen. Caspar Frisch, der Landvogt des Oberhalbsteins331, schrieb beispielsweise Pater Marino, er bedauere es sehr, dass er nicht zuhause gewesen sei, als er, Pater Marino, seinen Wohnort Riom visitiert habe. Da er aber gehört habe, dass er mit dem Auftrag unterwegs sei, »Informationen über die Kapuzinerpatres zu sammeln«332, wolle er nun auf dem Briefweg seine Meinung über die Mission kundtun. Was folgt, ist eine Schilderung des Nutzens der Mission. So betonte der Landvogt etwa, die Oberhalbsteiner hätten vor der Ankunft der Kapuziner höchstens einmal im Jahr gebeichtet, jetzt seien es bis zu vier Male. Frisch strich also die Verdienste der Missionare für die Intensivierung des kirchlichen Lebens heraus, wohl im Wissen darum, dass die innerkatholische Mission selbst in kirchlichen Kreisen nicht unumstritten war.333 Die Informationen, die er dem Visitator lieferte und die auch in dessen Schlussbericht einflossen, sind daher auch als Versuch zu sehen, die Propagandakongregation von der Notwendigkeit der Mission in katholischen Gemeinden zu überzeugen. Weitere Korrespondenten, darunter der Dompropst der Churer Kathedrale334 und das Oberhaupt des Grauen Bundes (Landrichter),335 taten es ihm gleich.336 Hier zeigt sich, dass die in den Visitationsberichten enthaltenen Informationen mehr waren als nur wertneutrale Beobachtungen des Visitators. Sie fußten auf mehreren Quellen und Einschätzungen von Akteuren, die ihrerseits ein Interesse an der Mission hatten. Die Informationsbeschaffung war somit auch hier eingebettet in eine soziale Praxis.337
Den Visitationen der Kapuziner und ihren Missionsberichten kam eine Schlüsselrolle bei der Generierung von administrativem Wissen über den rätischen Alpenraum zu. Gerade die zuletzt gemachte Beobachtung warnt allerdings davor, diese Wissensbestände an Kategorien der objektiven Wahrheit zu messen. Auch die Informantentätigkeit der Kapuziner war mikropolitischen Handlungslogiken unterworfen, das heißt, auch die Kapuziner pflegten enge, auf personalen Loyalitäten beruhende Bindungen zu bestimmten Akteuren, mit deren Hilfe sie die Interessen ihres Ordens und zuweilen auch die der eigenen Person oder Familie338 durchzusetzen versuchten, indem sie Rom mit selektiven Informationen versorgten. Wohl nicht zufällig unterhielten der Kapuziner Cristoforo da Toscolano und Carlo Pestalozza, der – wie oben gesehen – nicht abgeneigt war, gegen den Willen des Bischofs in Chiavenna die Mission einzuführen, ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander:339 Pater Cristoforo machte sich in Rom für die von Pestalozza angestrebte Ernennung zum Erzpriester von Chiavenna stark; im Gegenzug argumentierte Pestalozza mit seinen Schilderungen der bedenklichen religiös-sittlichen Zustände in Chiavenna für eine von Cristoforo da Toscolano geleitete Einführung der Mission. Selektive Information war also auch im Falle der Kapuziner ein Mittel, um personale Bindungen aufzubauen und Unterstützung für die Mission zu generieren.