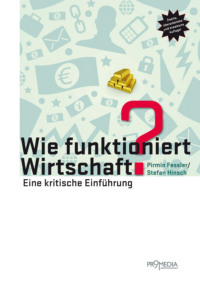Kitabı oku: «Wie funktioniert Wirtschaft?», sayfa 2
Homo œconomicus
Die erste Anmerkung betrifft die »Natur« des Menschen. Dieser ist kein rein egoistischer Nutzenmaximierer, kein »Homo œconomicus«.
Es gibt etwa einen tiefen Sinn für Fairness, sodass wir davon ausgehen können, dass einige Bauern nicht bereit sind, einen Marktpreis für Hämmer zu bezahlen, den sie als ungerecht und zu hoch empfinden – selbst wenn der Verzicht auf einen Hammer größere Kosten verursacht. In dieser Richtung gibt es eine Reihe von Untersuchungen und Gedankenexperimenten. Allen voran können Ergebnisse ökonomischer Experimente genannt werden. Das so genannte Ultimatum-Spiel funktioniert einfach: Ein Spieler bekommt, sagen wir, 100 Euro. Die kann er oder sie nun zwischen sich und einem anderen Spieler aufteilen. Ist der andere Spieler mit der Aufteilung einverstanden, bekommen beide ihren Anteil. Ist er oder sie es nicht, bekommen beide gar nichts. Wäre der andere Spieler ein Homo œconomicus, würde er sich mit jeder Aufteilung abfinden. Ein Euro ist schließlich besser als keiner – ganz rational betrachtet. Selbst dann, wenn es bedeutet, dass der andere Spieler sich selbst 99 zukommen lässt. In den Experimenten kann aber festgestellt werden, dass sich SpielerInnen nicht so billig abspeisen lassen und im Zweifelsfall lieber gar nichts haben. Die Bestrafung des Spielers, der so ungerecht aufgeteilt hat, scheint ihnen wichtiger zu sein. Gleichzeitig wird auch beobachtet, dass jene SpielerInnen, welche die Anteile bestimmen, dem Gegenüber meist höhere Anteile zukommen lassen als nur einen Euro, also gar nicht damit rechnen, dass sie es mit einem Homo œconomicus zu tun haben. Auch in der realen Welt beobachten wir vom Homo œconomicus abweichendes Verhalten. ArbeitnehmerInnen, die eine Entwertung ihrer Löhne durch Inflation murrend akzeptieren, aber gegen eine Kürzung des Nominallohnes (der Zahl, die auf dem Lohnzettel steht) streiken würden.
Es gilt auch die einfache Beobachtung, dass Menschen im Allgemeinen nicht nur auf Basis unmittelbarer materieller Vorteile handeln. In Österreich ist es etwa für den Verdienst eines Lehrers de facto unbedeutend, wie gut er unterrichtet oder wie lange er sich vorbereitet. Dennoch gibt es sehr viele engagierte PädagogInnen. Einstein hat die Relativitätstheorie nicht wegen eines Versprechens auf Gewinnbeteiligung an Atomkraftwerken entwickelt. Wir sind uns sicher, dass die Londoner InvestmentbankerInnen genauso verbissen arbeiten würden, wenn ihre Boni nur die Hälfte betragen würden – vorausgesetzt natürlich, die anderen InvestmentbankerInnen bekommen auch nicht mehr Geld und die Boni waren nie höher. Wäre das der Fall, würden sie sich ungerecht behandelt fühlen.
Ebenso wenig handeln Menschen in allen Situationen immer rational – weder allein und schon gar nicht in Gruppen. Finanzmärkte weisen etwa ein ausgeprägtes Herdenverhalten auf. Phasen des Booms wechseln sich ab mit Phasen der Panik, und oft laufen viele Investoren in die gleiche Richtung. Selbst Alan Greenspan, damals Chef der amerikanischen Notenbank und ein wirklich marktfreundlicher Wirtschaftsliberaler, bezichtigte die Finanzmärkte in den 1990er Jahren des irrationalen Überschwangs. Da hat er Recht gehabt, könnte angemerkt werden. Solche Beobachtungen stimmen nicht nur für den Aktienmarkt: Anfang des neuen Jahrtausends wurden Hauspreissteigerungen in Ländern wie Spanien, Irland, Großbritannien oder den USA über lange Zeiträume hinweg fortgeschrieben. Die entstandene spekulative Blase trug dann zur größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg bei. Über einige Rohstoffmärkte ließe sich Ähnliches sagen, oder über die Schwankungen von freien Währungskursen, die oft erst in die eine, dann in die andere Richtung überziehen.
Zusammengefasst: Menschen sind weder reine NutzenmaximiererInnen, noch handeln sie immer rational. Menschen sind auch nicht nur Individuen, sondern soziale Wesen. Sie sorgen sich um ihre Nächsten. Sie machen sich Gedanken über den Sinn des Lebens, ohne bis jetzt zu einem definitiven Ergebnis gekommen zu sein, aber oft mit der Vorstellung, dass jener nicht nur im Geldverdienen liegt. Kurz gesagt: Den »Homo œconomicus« gibt es nicht.
Die Kritik am Homo œconomicus muss jedoch darauf achten, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Auf welcher Grundlage kann vom »irrationalen Überschwang« des Aktienmarktes gesprochen werden? Warum konnten viele BeobachterInnen schon im Jahr 2005 oder 2006 sagen, dass die Hauspreise in Spanien oder Irland zu hoch angestiegen wären und wieder fallen müssten? Zu hoch im Vergleich wozu? Der rationale Homo œconomicus dient also als »Benchmark«, als Referenzpunkt für reale Märkte. Und an der Tatsache, dass sowohl der Aktienmarkt der 1990er als auch der spanische Häusermarkt schließlich nach unten korrigiert haben, zeigt sich auch, dass reale Märkte sich nicht völlig von rationalen Grundlagen entkoppeln können. Wenn der Häuser- oder Aktienmarkt eine völlig irrationale Angelegenheit wäre, dann könnten Preise nicht »zu hoch« sein, sie wären je nach Stimmung einfach irgendwo.
Das Gleiche gilt grundsätzlich für alle Preise. Würden die Menschen Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen, die ausschließlich an wechselnden, nicht rationalen Motiven hängen, könnte sich kein auch nur halbwegs stabiler Preis bilden. Stabile Preise wären allerdings auch schon egal, da Angebot und Nachfrage ohnehin nicht auf Preissignale reagieren würden. Die Wirtschaft fiele in totalem Chaos einfach auseinander. Wir bemerken, dass so etwas nicht vorkommt oder wenigstens nicht ununterbrochen.
Der rationale Homo œconomicus ist dabei eine Abstraktion, aber keine völlig absurde. Mit der Neuzeit beginnt sich in Europa die Logik des Kapitalismus durchzusetzen und diese lautet: investieren, aus Geld mehr Geld machen.
Die Profitmaximierung ist keineswegs die einzige Logik, die der Mensch verfolgt, und die persönliche Bereicherung nicht seine einzige Ethik, aber beide sind wichtig. Für viele Menschen ist Geld nicht das einzige Motiv, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen. Viele Menschen streben etwa auch nach gesellschaftlicher Anerkennung. Allerdings wird gesellschaftliche Anerkennung oft in Geld ausgedrückt. Wer nichts verdient, verdient auch keine Anerkennung.
Stellen wir einer beliebigen Gruppe von Menschen die Frage: »Angenommen, ich schenke Ihnen 500 Millionen Euro. Was würden Sie tun?« Ganz wenige würden so viel Geld nicht wollen oder das meiste spenden. Einige würden sich auf eine Insel zurückziehen und nie wieder arbeiten. Der weitaus größte Teil würde nach der Befriedigung von Konsumwünschen wie riesigen Autos und ebensolchen Häusern »investieren, damit sich das Geld weiter vermehrt«. Auf den Einwand, warum noch mehr Geld eigentlich erstrebenswert sei, wenn ohnehin schon alles erschwinglich ist und die Bedürfnisse nach Häusern und riesigen Autos längst befriedigt sind, gibt es üblicherweise keine Antwort. Es wird jedoch eine Antwort impliziert: Geld an sich stellt einen Wert dar; möglicherweise, weil mehr Vermögen auch mehr Macht bedeutet.
Das ist die Ethik des Kapitalismus, ob das nun bedauert oder begrüßt wird. Wir wollen hier nicht behaupten, dass eine solche Ethik ewig sein muss, für den Augenblick halten wir aber die Hinweise für ausreichend, um den Homo œconomicus und den freien Markt als Referenzpunkte annehmen zu können. Das bedeutet allerdings nicht »Der Markt hat immer Recht«, der Slogan des neoliberalen Umbaus, der vor allem in den 1980er Jahren populär war. Märkte irren häufig.
Wir kehren zu unserem Modell einer freien Marktwirtschaft aus Bauern und Werkzeugmacherinnen zurück und gestatten diesen, sich ausreichend rational zu betragen, damit das ganze Modell weiterhin Gültigkeit hat. Doch selbst wenn der Rahmen der Neoklassik akzeptiert wird, können wir nicht automatisch davon ausgehen, dass der Markt alles regeln kann. Es gibt Situationen – auch über ihre Anzahl lässt sich streiten –, die den freien Markt überfordern.
Externalitäten
Externalitäten sind Nutzen oder Kosten, die in einem Markt verursacht werden, sich aber nicht im Marktpreis wiederfinden. Das möglicherweise einfachste Beispiel ist Umweltverschmutzung. In unserem Beispiel ist es durchaus möglich, dass Abwässer der Werkzeugproduktion ebenso wie Gülle aus der Tierhaltung die Wasserversorgung des Dorfes belasten. Es ergibt sich also ein Verlust an Lebensqualität und Gesundheit, der mit etwas Mühe auch in Geld bewertet werden könnte. Das Problem: Die Aufbereitung der Abwässer verursacht Kosten, die durch die einzelnen Betriebe getragen werden müssen, während die Kosten der Umweltverschmutzung der Allgemeinheit untergeschoben werden. Wenn alle Bauern und Werkzeugmacherinnen ihre Abwässer klären, profitieren alle davon, aber jedes Individuum für sich betrachtet hat einen Anreiz, die Umwelt weiter zu verschmutzen.
Externalitäten können nicht nur negativ sein – wie in unserem Beispiel, wenn anfallende Kosten von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Es gibt auch positive Externalitäten, etwa wenn ein Betrieb Lehrlinge ausbildet oder Kinder lesen und schreiben lernen, statt Teppiche zu knüpfen. Der Grund: Das höhere Ausbildungsniveau kommt nicht allein jenen zugute, die dafür bezahlen; zu den Nutznießern gehören Betriebe, die fertige Lehrlinge bei einem Arbeitsplatzwechsel einstellen oder auch die gesamte Gesellschaft, die von höherer Alphabetisierung durch einen höheren Wachstumspfad oder niedrigere Kriminalität profitiert.
Ein weiteres klassisches Beispiel für Externalitäten ist die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Eigentumsrechten, die auch die überzeugtesten Marktliberalen lieber dem staatlichen Apparat als einem Markt anvertrauen.
Grundsätzlich sind Externalitäten aber nicht auf die genannten Bereiche beschränkt. Siedelt sich ein Industriebetrieb im relativ armen Südburgenland an, dann hilft das der ganzen Region. Wenn in einer Region ein paar Softwareunternehmen aufmachen, die mit Bildungsinstitutionen verbunden sind, dann kann Silicon Valley herauskommen. Muss Anfang der 1980er Jahre die Schwerindustrie dichtmachen, weil die staatliche Unterstützung wegfällt, brechen ganze Regionen zusammen – etwa Nordengland oder das Ruhrgebiet. Das bedeutet nicht, dass automatisch alle Unternehmen mit staatlicher Förderung durchzufüttern sind, aber auch nicht, dass ein Streichen von Subventionen keine Kosten verursacht.
Der Nutzen eines Bahntunnels durch die Koralm – die direkte Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark – ist sicher nicht allein an höheren Fahrkartenverkäufen durch die Bundesbahnen zu messen, sondern auch am Entwicklungsimpuls für das gesamte südliche Österreich, was nicht bedeutet, dass die Kosten nicht dennoch zu hoch sein können. Eine schlechte Wasserversorgung führt zu Seuchengefahr, ebenso ein schlechtes Gesundheitssystem. Fehlende soziale Sicherheitsnetze oder soziale Ungleichheit können zu Kriminalität führen. Eine zu hohe Kreditvergabe durch das Bankensystem kann gewaltige Kosten verursachen, falls die Banken aufgefangen werden müssen, weil sie sich verrechnet haben und die eingegangen Risiken letztlich nicht mehr selbst tragen konnten. Sie kann aber auch gewaltige Kosten verursachen, wenn zusammenbrechende Banken nicht aufgefangen werden, weil dann der Absturz der gesamten Volkswirtschaft schlimmer ausfallen könnte als bei einer Rettung.
Kurz gesagt: Externalitäten finden sich überall; grundsätzlich ist wohl kaum ein Markt zu finden, in dem sie gar keine Rolle spielen.
Konkurrenz
Der Markt der Neoklassik liefert nur bei vollständiger Konkurrenz optimale Ergebnisse. Kommt es zu Monopol- oder Oligopolstellungen (ein oder mehrere große Anbieter oder Nachfrager), dann können die MonopolistInnen die Preise zu ihren Gunsten beeinflussen. Die theoretische Forderung geht sogar in Richtung unendlich vieler AnbieterInnen und NachfragerInnen, die aufgrund ihrer großen Zahl die Marktpreise als Einzelne nicht beeinflussen können. Dem Einzelnen erscheinen die Preise daher als gegeben; er kann sich lediglich entscheiden, ob er zu diesem Preis anbietet oder nachfragt – oder auch nicht. Ohne diese vollständige Konkurrenz ergibt sich tatsächlich keine spontane Koordination. Die großen Firmen beginnen, Preise und Angebotsentwicklung im Vorhinein zu planen und zu beeinflussen.
Gegen diese Vorstellung vollständiger Konkurrenz gibt es einige Vorbehalte. Die Ikone des Marktliberalismus, Friedrich von Hayek, hat einmal festgestellt, dass der von der Neoklassik geforderte Zustand der »vollständigen Konkurrenz« keinen Platz für das Wirken des Wettbewerbs lässt. Die Argumentation ist recht einfach: Aufgrund des Wirkens des Wettbewerbs wird der Marktwirtschaft im Allgemeinen Dynamik zugeschrieben wird. Der Versuch, Technologieführerschaft zu erreichen (und mittels Patent abzusichern), oder der Versuch, über Werbung ein Produkt als einzigartig zu verkaufen oder durch Preiskämpfe die Konkurrenten zu ruinieren – immer geht es darum, eine Stellung zu erreichen, die einem Monopolisten zumindest ähnelt.
Wettbewerb tendiert dazu, sich selbst auszuschalten. Ist er »vollständig«, gibt es keine Chance, einen Monopolstatus zu erlangen. Dieser ist aber Ziel der Unternehmen, weil sie so am meisten Profite erzielen können. Wäre er erreicht, handelt es sich nicht mehr um vollständigen Wettbewerb. Während in der Volkswirtschaftslehre »Marktmacht« (die Möglichkeit, Preise zu beeinflussen) kritisch gesehen wird, beschäftigt sich die Betriebswirtschaftslehre mit Methoden, »Preissetzungsmacht« zu erreichen. Marktmacht und Preissetzungsmacht sind das Gleiche.
Es stellt sich dabei auch die Frage, inwiefern die Forderung nach vollständiger Konkurrenz für alle Märkte sinnvoll sein kann bzw. ob Marktmacht immer und automatisch schlecht ist: Die ideale Anzahl der WettbewerberInnen in einem Markt ist von der eingesetzten Technologie abhängig und von der Höhe der notwendigen Investitionen in Anlagen und Maschinen. Überall dort, wo Vorteile der Massenproduktion zu erwarten sind, wo also mit der Stückzahl die Stückkosten sinken, wird die Anzahl der WettbewerberInnen in der einen oder anderen Form begrenzt sein. Solche Vorteile der Massenproduktion (oder economies of scale – Skaleneffekte) sind praktisch überall zu finden.
Auch ein Wirtshaus hat höhere Kosten, wenn es nur für zwei Gäste ausgelegt ist statt für fünfzig. Allerdings ist es unmittelbar nachzuvollziehen, dass ein Wirtshaus für hunderttausend Gäste nicht mehr mit sinkenden Stückkosten verbunden sein wird, weil mögliche Kostenvorteile im Einkauf (ein Vorteil der Massenproduktion) dadurch ausgeglichen werden, dass die KellnerInnen bei jeder Bestellung einen weiten Weg zurücklegen müssten, um ein Bier auszutragen. Die spanische Landwirtschaft kann durch Investitionen (Bewässerung, Hochleistungssorten, Dünger etc.) den Ertrag steigern, aber wenn ein Feld schon gut gedüngt ist, wird eine zusätzliche Tonne Dünger wenig bewirken (und möglicherweise sogar schädlich sein). Ein einzelner Bauernhof kann die Nachbarhöfe übernehmen und durch größere Flächen und intensiveren, Maschineneinsatz den Ertrag pro ArbeiterIn steigern – aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Mehr als 150 Hektar kann ein Landwirt oder eine Landwirtin auch mit den modernsten Maschinen nicht bearbeiten.
In der Folge gibt es auf dem Markt für Mais und Mittagessen auch eine große Zahl von WettbewerberInnen – wenngleich einige von ihnen von größeren Ketten organisiert werden (etwa McDonalds) und daher Skaleneffekte bei Einkauf und Marketing ausnützen können.
Auch für die Anfertigung einfacher Industriegüter wie Textilien sind Skaleneffekte relativ begrenzt, weshalb es auch eine Unzahl kleiner Nähereien in Bangladesch, Vietnam oder China gibt, die ihre Produkte dann an große Handelshäuser verkaufen.
In anderen Sektoren hingegen, und oft bei sehr kapitalintensiver Produktion, kann mit gewaltigen Skaleneffekten gerechnet werden. Wenn wir uns die Produktion von kommerziellen Großraumflugzeugen ansehen, stellen wir fest, dass teilweise hunderte Flieger verkauft werden müssen, damit sich die gewaltigen Investitionen in Entwicklung und Spezialmaschinen lohnen. Der Weltmarkt für solche Flugzeuge würde wohl mehr als die jetzigen zwei Anbieter (Boeing und Airbus) vertragen, aber sicher keine 150.
In anderen Fällen werden die internen Skaleneffekte durch externe ergänzt: Um ein Computerbetriebssystem zu entwickeln, ist eine große Zahl von ProgrammiererInnen jahrelang beschäftigt. Ist das Ding aber erst einmal fertig entwickelt, steigen die Gesamtkosten kaum, egal, ob 20 oder 200 Millionen verkauft werden. Dadurch sinkt der Anteil an den Gesamtkosten bei jeder einzelnen Kopie. Soweit zu den internen Skaleneffekten; für Computerprogramme kommen aber noch externe Skaleneffekte dazu – so genannte Netzwerkeffekte, weil durch einfachere Kommunikation der Nutzen für alle AnwenderInnen steigt, wenn ihre ArbeitskollegInnen das gleiche Produkt verwenden. In der Folge muss sich Microsoft nicht mit Dutzenden WettbewerberInnen herumschlagen.
Solche monopolistischen Märkte können relativ instabil sein. Falls die Profite hoch sind, können zusätzliche WettbewerberInnen auf den Markt drängen (üblicherweise nur solche, die in der Lage sind, die hohen Anfangsinvestitionen zu schultern) und die Preise sinken. Es ist aber nicht gesagt, dass die sinkenden Preise zu geringerem Angebot führen – im Gegenteil: Wenn mit steigender Produktionsmenge die Stückkosten sinken, können die MarktteilnehmerInnen auch mit einer Ausweitung des Angebots reagieren, um die gesunkenen Preise durch einen höheren Marktanteil zu kompensieren. Tun das alle, gibt es einen Preiskampf. Das gleiche Phänomen kann eintreten, wenn durch einen externen Schock die Nachfrage zurückgeht.
Dazu ein kurzer Ausflug in die Betriebswirtschaftslehre: Dort lernen wir in der Preiskalkulation, dass ein Unternehmen beim Verkauf eines Produktes sowohl die fixen Kosten (für die erfolgten Investitionen, die Kredite und die fix Beschäftigten) als auch die variablen Kosten (für einen Teil der Löhne und Dinge wie Energie) decken muss.
Was aber, wenn zu wenige Aufträge vorhanden sind, um die Maschinen voll einzusetzen? Dann kann es sinnvoll sein, den Preis unter ein Niveau zu senken, dass zur langfristigen Kostendeckung benötigt wird, um zusätzliche Aufträge zu erhalten. Es wird versucht, den KonkurrentInnen Marktanteile abzujagen, was aber kaum funktionieren kann, wenn alle gleich handeln. In einem solchen Fall können die Preise auf das Niveau der variablen Kosten sinken, und je kapitalintensiver ein Sektor ist, desto weniger wird ein solches Preisniveau ausreichen, um die Kapitalkosten zu verdienen. Für die beteiligten Unternehmen ist das verheerend, ebenso wie für die KreditgeberInnen.
Sind solche Vorgänge halbwegs begrenzt, so kann eine Art evolutionärer Wettbewerb begrüßt werden, bei dem die Schwächeren vom Markt verdrängt werden und sich die Technologie- und Kostenführer durchsetzen. Solch eine Form des Wettbewerbs entspricht den Vorstellungen eines Joseph Schumpeter; aber zumindest bei einem allgemeinen Nachfrageschock (einer Rezession) gibt es in jedem Fall ein Zuviel des Guten.
In einer modernen kapitalintensiven Volkswirtschaft wird die Forderung der Neoklassik in der Praxis geradezu umgekehrt: Nicht vollständige Konkurrenz ist gut, sondern ausreichende Marktmacht der führenden Unternehmen, damit diese auch in schwierigen Situationen die Preise hoch genug halten können, um ihre Kapitalkosten zu verdienen. Ohne diese Voraussetzung wären größere Investitionen sehr riskant, weil über kapitalintensiver Produktion immer die Gefahr einer Pleite schweben würde. Wer nicht über genug Marktmacht verfügt, schafft auch keine Finanzierung – sei es über den Kapitalmarkt oder einen Bankkredit. Damit wäre eine moderne industrielle Wirtschaft nur schwer möglich.
Wird Marktmacht als notwendig akzeptiert, lässt sich der oligopolistische Normalzustand der Wirtschaft auch deutlich besser erklären. Die meisten Märkte kennen nur eine begrenzte Zahl von AnbieterInnen, die durchaus in der Lage sind, ihre Preise zu verteidigen. Wenn durch einen Konjunktureinbruch die Nachfrage nach Gasturbinen sinkt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass Siemens den Verkaufspreis senkt.
Allerdings: Nur weil Marktmacht notwendig ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht verwendet wird, um KundInnen oder Angestellte auszunehmen und zusätzlichen Profit zu machen. Wenn in den Jahren vor 2007 Sektoren wie das Investmentbanking eine jährliche Rendite von 25 Prozent auf das eingesetzte Eigenkapital gefordert haben und gleichzeitig in der Lage waren, gigantische Boni auszuschütten, dann kann nicht von besonders viel Wettbewerb die Rede sein. Funktioniert Wettbewerb, dann sollten die Profite aufgrund der Konkurrenz eigentlich recht klein sein. Schließlich versucht jedes Unternehmen, dasselbe noch billiger und besser zu produzieren, um besser verkaufen und mehr Profite machen zu können.
Ein besonderer Fall sind »natürliche Monopole«, wo ohne staatliche Regulierung überhaupt kein Wettbewerb stattfinden kann. Betrachten wir etwa die Elektrizitätsversorgung, bei der ein großer Teil der Kosten bei der Errichtung der Leitungen anfällt. In einem völlig unregulierten Markt für Elektrizität müssten alle WettbewerberInnen ihre eigenen Leitungen verlegen, was zu teuer wäre. Im Endeffekt würde sich eine Reihe von regionalen Monopolen herausbilden, die jedes für sich die Stromrechnung der KonsumentInnen in die Höhe trieben.
Die Lösung: entweder öffentliche AnbieterInnen, deren Preise nicht nach dem Prinzip eines maximalen Gewinns gesetzt werden, oder eine öffentliche Kontrolle über das Elektrizitätsnetz. Diese muss nicht in öffentlichem Eigentum bestehen, aber es muss gesichert werden, dass alle WettbewerberInnen Zugang zu den Leitungen haben. In der EU ist eine solche Regulierung des Strommarktes im Allgemeinen vorhanden, bei Telefonleitungen gilt Ähnliches.
Zu einem Albtraum haben sich dagegen Privatisierungen von Eisenbahnen mitsamt dem Schienennetz entwickelt: Wettbewerb unterschiedlicher AnbieterInnen im Zugverkehr ist wohl grundsätzlich möglich, wenn auch aufgrund der gewaltigen Externalitäten mit Problemen behaftet (etwa in Bezug auf Faktoren wie regionale Entwicklung und Umweltschutz). Allerdings muss die Nutzung des Schienennetzes allen WettbewerberInnen offen stehen. Werden einfach Eisenbahngesellschaften mitsamt dem Schienennetz privatisiert, entsteht statt eines öffentlichen Monopols (das seine Preisentscheidungen unter politischem Druck trifft) ein privates, denn es gibt wohl kaum AnbieterInnen, die neben der existierenden Strecke Hamburg–Berlin noch einmal neue Gleise verlegen möchten – abgesehen davon, dass eine solche Ressourcenverschwendung volkswirtschaftlichen Unsinn darstellen würde. Ein privates Monopol kann dann die Preise nach Belieben gestalten und gleichzeitig die Investitionen in die Betriebssicherheit auf ein Minimum reduzieren.