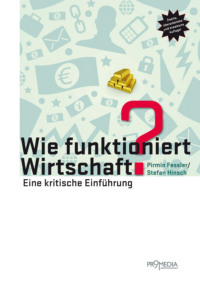Kitabı oku: «Wie funktioniert Wirtschaft?», sayfa 4
2. Geld sind Zahlen in Büchern von Banken und die Schulden von jemand anderem
Fast immer, wenn über Wirtschaft gesprochen wird, geht es gleichzeitig auch um Geld. Geld als Mittel zum Konsum, Geld zum Sparen, Geld zum Verteilen, Geld, das an Wert verliert oder an Wert gewinnt, Geld, dessen Wechselkurs zu anderem Geld steigt oder fällt, Geld als Schulden. Der Diskurs über Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ist geprägt von Geld.
Das Geld zu verstehen ist wohl wichtig, um zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert – so scheint es zumindest. Zur großen Überraschung spielt es aber in der herrschenden Theorie der Volkswirtschaftslehre eigentlich so gut wie keine Rolle. Das wohl einflussreichste Modell der Volkswirtschaftslehre, das den Grundstein für den gesamten Mainstream und insbesondere für die Neoklassik bildet, kennt kein Geld. Die im 19. Jahrhundert von Léon Walras entwickelte und von Kenneth Arrow und Gérard Debreu in den 1950er Jahren in ihre heutige mathematisierte Form gegossene Allgemeine Gleichgewichtstheorie basiert tatsächlich auf einer Tauschwirtschaft. Geld kommt darin keines vor und spielt daher auch keine Rolle. Natürlich gibt es Modelle, die auf der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie basieren und in denen Geld vorkommt, ja eine ganze neoklassische Geldtheorie. Diese begreift sich selbst aber immer als eine Theorie des Tausches.
Menschen wollen also, laut herrschender volkswirtschaftlicher Lehre, Güter und Dienstleistungen tauschen. Tauschen, das machen sie auf einem Markt. Wo zwei sich treffen und etwas tauschen wollen, da ist ein Markt. Dazu braucht es natürlich zunächst kein Geld. Wenn zwei Steinzeitmenschen tauschen oder wenn die Bauern und Handwerkerinnen aus dem Beispiel im vorherigen Kapitel ihre Lebensmittel und Werkzeuge tauschen, können sie das genauso gut ohne Geld. Die Volkswirtschaftslehre behauptet im Grunde, dass dieses Tauschparadigma immer schon gegolten hat, auch vor dem Gebrauch des Geldes. Es sei daher unabhängig vom Geld gültig. Konsum, Sparen, Schulden, Preise und selbst Zinsen lassen sich durchaus auch ohne Geld erklären. Gespart werden könne schließlich auch in Werkzeugen.
Ein Bauer, der einige Lebensmittel nicht konsumieren will, kann sie in Werkzeuge umtauschen und diese aufbewahren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Lebensmittel umzutauschen und aufzuessen. Werden die Werkzeuge in dieser Zeit eventuell von jemand anderem benötigt, der sie nützlicher einsetzen kann, aber selbst keine hat, könnte der Bauer sie verleihen. Derjenige, der sie ausleiht, wäre dann wahrscheinlich bereit, einen kleinen Anteil des damit erwirtschafteten Ertrags etwa in Lebensmitteln an den Bauern zu bezahlen. Damit wäre dann der Zins geboren. Wie also leicht zu sehen ist: Für all diese Operationen benötigt die Volkswirtschaftslehre nicht notwendigerweise Geld als Erklärung. Ganz im Gegenteil ist Geld eher ein störender Faktor, der sich in die Modelle gar nicht so gut einfügen lässt. Wozu also Geld?
Geld als Recheneinheit
Wie wir schon an anderer Stelle besprochen haben, basiert Wirtschaft, sobald sie einmal über die Subsistenzwirtschaft – also dem bloßen Produzieren der Individuen oder Haushalte für den Eigenbedarf – hinausgeht, auf Tausch. Dieser Tauschprozess führt, so die Allgemeine Gleichgewichtstheorie, zu einem Gleichgewicht, bei dem niemand mehr weiter tauschen will, weil niemand mehr durch Tausch bessergestellt werden kann, ohne dass ein anderer schlechtergestellt werden würde. Dabei kann dann in unserem Beispiel von Bauern und Werkzeugmacherinnen zum Beispiel eine Tauschrelation von drei Lebensmitteln zu einem Werkzeug herauskommen.
Nehmen wir an, die Bauern verhandeln über Preise und bezahlen in Euro. Dann würde für 1 Lebensmittel eben 1 Euro bezahlt werden und für 1 Werkzeug 3 Euro; 1 Werkzeug könnte so wiederum in 3 Lebensmittel getauscht werden, über den »Umweg« des Geldes eben. Hier würde es sich tatsächlich um einen Umweg handeln, wäre es doch viel einfacher, direkt Lebensmittel gegen Werkzeuge zu tauschen. In der realen Welt allerdings wird schnell klar, dass es wohl nicht so leicht wäre, etwa als FahrradhändlerIn Fahrräder gegen Lebensmittel im Supermarkt zu tauschen oder als FriseurIn das Haarschneiden gegen Benzin an der Tankstelle.
Je spezialisierter und arbeitsteiliger die Gesellschaft, desto schwieriger ist es, in einer Tauschwirtschaft ohne Geld zu leben. Es ist auch kaum vorstellbar, dass sich alle Wirtschaftsteilnehmer die entstandenen Tauschrelationen zwischen den Gütern merken könnten. Während es bei zwei Gütern nur eine Tauschrelation gibt, gibt es bei 3 Gütern schon 3, bei 4 schon 6, bei 10 schon 45 und bei 10 000, wie sie etwa in einem Supermarkt vorkommen, bereits 49 995 000 Tauschrelationen. Ein Supermarkt, der die jeweiligen Preise der Güter anstatt in Euro in jeweils allen anderen Gütern anschreiben wollte, wäre wohl sehr unübersichtlich: 1 Liter Milch kostet 2 Schokoriegel, 50 Gramm Wurst, 30 Gramm Käse, 3 Jogurts, ¾ Packungen Cornflakes, ⅓ Tiefkühlpizza, usw. Wird hingegen eines der Güter als Recheneinheit verwendet, vereinfacht sich das Ganze dramatisch. Dafür brauchen wir dann das Geld, das in der Volkswirtschaftslehre als »numéraire-Gut« bezeichnet wird.
Bei all diesen Überlegungen wird Geld nur als Recheneinheit benötigt. In der Volkswirtschaftslehre und auch in unserem alltäglichen Leben hat Geld aber noch eine weitere wichtige Funktion: Geld ist das Medium, mit dem Konsum über die Zeit transferiert werden kann. Dabei spielt auch der Zins eine Rolle, der zuallererst aber – wie oben beschrieben – auch schon ohne Geld existieren kann.
Geld als Mittel zum Konsumtransfer über die Zeit
Wenn Menschen durch ihre Arbeitskraft Güter produzieren, erzielen sie dadurch Einkommen: der Bauer in unserem Beispiel in Form von Lebensmitteln, die Werkzeugmacherin in Form von Werkzeugen. Wenn der Bauer andere Menschen anstellt, die ihre Arbeitskraft anbieten, weil sie selbst kein Land besitzen, muss der Bauer sie dafür bezahlen, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können und so auch ihre Arbeitskraft weiter anbieten können. Er könnte sie in Lebensmitteln bezahlen, die sie dann wieder in andere Güter tauschen können. Wenn sie aber nicht alle Lebensmittel sofort aufessen wollen und auch keinen Bedarf an anderen Gütern mehr haben, wäre es klug, die Lebensmittel in ein Gut zu tauschen, dessen Wert über die Zeit länger erhalten bleibt. Lebensmittel würden sich dazu nicht eignen, sie werden recht schnell ungenießbar und verlieren damit auch ihren Tauschwert. Wer will schon Werkzeuge oder genießbare Lebensmittel gegen faules Obst tauschen?
Die Volkswirtschaftslehre geht davon aus, dass sich mit der Zeit ein Gut, das sich hierfür besonders gut eignet, durchsetzt und zur allgemeinen Recheneinheit und Mittel zum Konsumtransfer über die Zeit wird, das so genannte numéraire-Gut. Das waren zuerst bestimmte langlebige Güter, oder auch einzelne Metalle und dann Münzen, also bereits standardisierte Mengen an Metallen.
Heute ist Geld so genanntes »fiat money« (»Es werde Geld«). Weder die Münzen und schon gar nicht die Scheine sind physisch das wert, was ihnen aufgeprägt oder aufgedruckt ist, aber es sind Schuldtitel, die in Geschäften, Banken und in allen Bereichen, in denen sie angenommen werden, gegen eine bestimmte Menge an Gütern und Dienstleistungen getauscht werden können.
Wie viel für eine gewisse Geldeinheit zu bekommen ist, bestimmt der Markt, der die Tauschverhältnisse festlegt und die dadurch resultierenden Preise in Einheiten des numéraire-Gutes – dem Geld – ausdrückt.
Wenn Menschen heute nicht alles, was sie als Einkommen durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft verdienen, für den Konsum ausgeben, dann sparen sie den Rest in irgendeiner Form von Geld- oder Sachvermögen. Das Sparen bedeutet dabei nichts anderes, als den Konsum über die Zeit zu verschieben. »Nichts anderes« bezieht sich in diesem Kapitel erst einmal auf die volkswirtschaftliche Theorie. Aber tatsächlich ist es so, dass Menschen sparen, um im Alter versorgt zu sein (und dabei Konsum in einen anderen Lebensabschnitt verschieben), für größere Anschaffungen (ich konsumiere jetzt weniger und dafür in zwei Jahren ein Auto) oder für die zukünftige Ausbildung ihrer Kinder.
Geld (und im weiteren Sinne Vermögen) wird manchmal aber auch aus anderen Gründen als dem zukünftigen Konsum angespart. Denken wir an Statussymbole, Anerkennung oder aber ab bestimmten Summen an Macht und Einflussmöglichkeiten. Vorerst bleiben wir aber bei der wohl häufigsten Form, dem Sparen für zukünftigen Konsum oder dem zukünftigen Konsum der Kinder.
Je nachdem, wie viele Menschen sparen können und wie lange sie ihren Konsum verschieben wollen, nutzen sie dazu unterschiedliche Aufbewahrungsformen. Das geschieht deswegen, weil verschiedene Formen des gesparten Vermögens einerseits unterschiedlich schnell wieder in Waren umgetauscht werden können. Andererseits sind diese Aufbewahrungsformen meist mit einem Leihen des Geldes in der Zeit des Konsumverzichts und damit mit einer bestimmten Bezahlung verbunden: dem Zins.
Der Zusammenhang zwischen Zins und Geld
Wie schon erwähnt, kann es auch ohne Geld Zins geben. Die Funktion von Zinsen entspricht einem Transfer von Konsum über die Zeit – dafür wird heute Geld verwendet, und nur darum ist Geld mit Zins verbunden. Zinsen repräsentieren immer eine Zahlung in der Zukunft für einen Transfer von Geld heute oder in der Vergangenheit. Menschen, die ihr Einkommen heute nicht in Güter umwandeln und konsumieren wollen, sparen. Sie transferieren damit ihren Konsum in die Zukunft. Das äußert sich in unserem Wirtschaftssystem im Allgemeinen so, dass sie ihr Geld zu einer Bank bringen. Andere Menschen, die gerade Geld benötigen, leihen es sich bei der Bank aus, beispielsweise um zu konsumieren oder, wenn es sich um ein Unternehmen handelt, um zu investieren. Transferiert werden demnach reale Ressourcen. Die SparerInnen verzichten tatsächlich auf realen Konsum, etwa ein zusätzliches Butterbrot, während die SchuldnerInnen das Geld leihen, um es wieder in reale Ressourcen zu tauschen. Auch hier ist Geld demnach eine Recheneinheit, die dazu dient, den Tausch realer Ressourcen einfacher bewerkstelligen zu können.
Der Zins kommt nun durch zwei Dinge zustande. Einerseits werden damit die Menschen, die auf ihren Konsum heute verzichten, für ihren Verzicht entschädigt, andererseits wird ein Teil davon verwendet, um die Dienstleistung der Finanzintermediäre zu bezahlen.
Dieser Transfer muss nicht zustande kommen. Er geschieht eben dann und nur dann, wenn es auf der einen Seite Menschen gibt, die auf eine bestimmte Menge Geld zu einem dafür angebotenen Preis (Sparzins) verzichten wollen, und es auf der anderen Seite Menschen oder Unternehmen gibt, die bereit sind, etwas dafür extra zu zahlen (Kreditzins), damit ihnen heute Geld zur Verfügung gestellt wird, das sie erst später verdienen werden.
Bei Menschen in unseren Gesellschaften ist es etwa häufig so, dass Menschen am Beginn ihres Lebens eher wenig Einkommen haben, sie aber davon ausgehen, dass es in Zukunft steigen wird. Trotzdem wollen sie häufig eine Familie gründen oder Eigentum an Immobilien erwerben, wenn sie jung sind. Sie sind daher bereit etwas extra dafür zu bezahlen, damit sie das früher tun können. Verdienen sie später mehr, können sie dieses Geld leichter aufbringen und zurückzahlen. Manchmal ist es auch einfach billiger, eine Wohnung auf Kredit zu kaufen als ewig Miete zu bezahlen. Dasselbe gilt für Unternehmen. Sie nehmen dann einen Kredit auf, wenn sie erwarten mit dem zusätzlichen Geld mehr erwirtschaften zu können, als der Kreditzins Kosten verursacht.
Zinsen müssen also letztlich immer in Form von Einkommen erwirtschaftet werden und werden damit aus einem Teil des Ertrags der Unternehmen bezahlt. Zinsen können bezahlt werden, weil Kredite in Projekte investiert werden, deren Rendite über dem Zinssatz liegt. Zinsen sind der Preis dafür, dass mit geliehenem Geld gearbeitet werden kann.
Zinskritik
Zu verschiedensten Zeiten und insbesondere zu Krisenzeiten treten immer wieder Gruppen mit verschiedenster politischer Überzeugung von links bis rechts auf den Plan und erklären, dass die Zinsen an allem Schuld sind: Zinsen würden – so das Argument – dazu führen, dass Menschen, die Geld haben, ohne etwas dafür zu tun, noch mehr Geld daraus machen könnten. Dazu käme noch, dass die mit dem Geld verbunden Schulden durch ihr exponentielles Wachstum nie zurückbezahlt werden könnten. Zinsen sollten somit abgeschafft werden und stattdessen so genanntes »Schwundgeld«, oder »Freigeld«, oder auch »Tauschkreise« eingeführt werden, die dann ohne die Zinsen auskämen.
Was ist dran an diesen Argumenten? Sind Zinsen das Problem? Sind Freigeld oder Tauschkreise die Lösung? Zu den Argumenten. Meistens gehen sie – manchmal über einige Ecken – auf die Freiwirtschaftslehre von Silvio Gesell zurück. Gesell entwickelte die Freiwirtschaftslehre Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie basiert auf der Idee, das Hauptproblem des Kapitalismus bestünde darin, dass jene, die das einzig unverderbliche Gut horten – das Geld – alle anderen schamlos ausnutzen können. Alle anderen brauchen das Geld nämlich zum Tausch und um sich dieses Geld zu leihen, müssen sie nun den GeldbesitzerInnen Zins bezahlen. Aus dieser Vorstellung heraus forderte er das »zinsfreie Geld«, das laufend an Wert verlieren und so immer im Wirtschaftskreislauf gehalten werden sollte. Geld horten würde schlicht keinen Sinn mehr machen. Statt des Verleihens von Geld würden die KapitalbesitzerInnen in Investitionen in die Realwirtschaft (etwa in neue Produktionsstätten) getrieben werden.
Diese Vorstellung wurde in der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren zum ersten Mal populär. In etwas anderer Form blüht die Freiwirtschaftslehre in verschiedenen oftmals ökologisch motivierten Gruppen seit den 1980er Jahren wieder auf. Im Mittelpunkt stehen lokale Tauschkreise oder lokales Freigeld. Zusammenfassend meinen diese Gruppen, dass Markt, Geld und Kapitalismus dann gut seien, wenn sie klein sind und ohne Zins auskommen. Der Zins, meinen sie, sei schuld am so genannten Wachstumszwang. Je höher die Zinsen, desto stärker müssten Unternehmen wachsen, um die aufgenommen Kredite zurückzahlen zu können. Dieser zwangsweise Wachstumswettlauf führe zu Krisen und ökologischen Katastrophen. Ohne Zinsen auch kein Wachstumszwang.
So einfach sich das anhört, so problematisch ist es. Wir brauchen dazu noch nicht einmal allzu tief in die Theorie einzutauchen, um das zu erkennen. Wenn die Wirtschaftspolitik das Wachstum fördern will, wie etwa in der 2007 ausgebrochenen Krise, dann erhöht sie die Zinsen nicht, sondern senkt sie. Warum? Geld wird billiger, es wird mehr ausgegeben, die Unternehmen können es billiger leihen und geben es risikoreicher aus. Das Wachstum wird also durch niedrige Zinsen angeheizt, und durch negative Zinsen, wie sie die ZinskritikerInnen beim Freigeld vorsehen, erst recht. Wachstumszwang, wie ihn die ZinskritikerInnen nennen, entsteht keineswegs durch den Zins. Das ist ein fundamentales Missverständnis der kapitalistischen Wirtschaftsform. Zwar stimmt es, dass zur Begleichung des Kreditzinses bestimmte Erträge beziehungsweise Einkommen notwendig sind, muss er doch letztlich aus real erwirtschaftetem Profit bezahlt werden.
Aber die eigentliche Triebkraft des Wachstums im Kapitalismus ist die Konkurrenz. Jene Unternehmen, die schneller wachsen, können mehr investieren, können zusätzlich an ihre AktionärInnen ausbezahlen, steigen schneller im Wert und verdrängen letztlich die anderen Unternehmen. Der Einsatz von Fremdkapital verschafft beim Wachstum einen entscheidenden Vorteil. Dafür wird der Zins bezahlt.
Ein weiterer Grund für das Wachstum: Der technische Fortschritt setzt laufend Arbeitskräfte frei, die irgendwo anders beschäftigt werden müssen und damit natürlich insgesamt mehr herstellen, sollen sie nicht die Zahl der Arbeitslosen erhöhen. Ebenso benötigt der staatlich-politische Apparat im Kapitalismus das Wachstum. Die Ungleichheit der Individuen im Kapitalismus wird nur auf Dauer akzeptiert, wenn es zumindest für alle immer besser wird. Das Wachstumsversprechen des Kapitalismus ist notwendig für seinen Bestand.
Das fundamentale Missverständnis, dem die AnhängerInnen von Freigeld und Tauschkreisen aufsitzen, ist die Vorstellung, dass der Zins einfach ein Preisaufschlag wäre, den die GeldbesitzerInnen verlangen können, weil die anderen das Geld zum Tauschen brauchen. Der Zins aber ist nichts anderes als ein Anteil am Profit desjenigen, dem das Geld geliehen wurde. Das ist nicht immer leicht zu überschauen, da eine Vielzahl von unterschiedlichen Kapitalanlagemöglichkeiten unterschiedlichen Zins bringt. Und Kapital auf Finanzmärkten manchmal den Eindruck erweckt, es würde sich selbstständig vermehren.
Letztlich ist aber jeder Zins Teil eines real erwirtschafteten Profits. Werden Schulden aufgenommen und es stellt sich heraus, dass der versprochene Profit nicht real erwirtschaftet wird, kommt es zur Krise, zu Preisverfall und Wertverfall und auch zu keinen Zinsen im entsprechenden Ausmaß.
Kapital vermehrt sich also nie von selbst – auch wenn das heute manchmal so scheinen mag, weil nicht mehr direkt beobachtbar ist, wo und wie das veranlagte Kapital zum Einsatz kommt. Irgendwo wird aber produziert, investiert oder stehen Produktionsmittel im Eigentum. Kapitalvermehrung ist immer Ausdruck einer (möglicherweise zukünftigen) Produktion oder einer veränderten Bewertung von Produktionsmitteln.
Auch für die Einkommens- und Vermögenskonzentration, die im Kapitalismus beobachtet werden kann, ist Zins nicht die alleinige Ursache. Klar, höheres Einkommen führt bei gleicher Sparquote langfristig zu einer immer ungleicheren Vermögensverteilung. Jeden Monat kann einer mehr weglegen als ein anderer, der absolute Abstand wächst, und die Zinsen und Zinseszinsen beschleunigen dieses. Aber auch ohne Zins würde Ähnliches stattfinden. Warum? Wie gesagt, ist der Zins als Anteil eines Profits zu verstehen. Profite, die eher reinvestiert werden, führen zu höheren Profiten. Während Lohn aus Arbeit vorrangig verkonsumiert wird. Ungleichheit beruht also nicht nur auf dem Zinssystem.
Der Denkfehler der Freigeld-AnhängerInnen ist einfach zu sehen. Sie hätten gern freien Kapitalismus, aber ohne Zins, wo Geld reines Tauschmittel ist und nicht mehr mit Zins verliehen werden kann. Dabei übersehen sie, dass Profit und Zins zwei Seiten derselben Medaille sind. Der Profit des einen ist der Zins des anderen. Zins ist nur Anrecht auf einen Teil des Profits. Ohne Profit aber gibt es auch keinen Kapitalismus.
All das bedeutet nicht, dass es nicht Situationen gibt, in denen das Ausmaß der Schulden zu hoch ist – eben, weil die Profite und Einkommen niedriger sind als angenommen wurde und daher auch die Zinsen nicht bezahlt werden können. Geschieht das einem einzelnen Unternehmen, gibt es eine Insolvenz, und die GläubigerInnen fallen um ihr Geld um. Das kann Regierungen betreffen, wenn die Staatsverschuldung zu hoch wird, oder auch ganze Volkswirtschaften, wenn die Verschuldung des Staates, der Unternehmen und der privaten Haushalte nicht mehr tragbar ist. In solchen Situationen kann die Verschuldung die Wirtschaft erdrücken. Es gibt durchaus Argumente für eine Versorgung mit möglichst billigem Geld und für möglichst niedrige Zinsen. Ähnlich dem »Schwundgeld« wären manchmal auch negative Zinsen günstig – was in der technischen Durchführung aber Probleme macht.
Genauso gibt es Situationen, in denen die Geldwirtschaft zusammenbricht und sich Tauschkreise bilden, etwa in Argentinien nach der Finanzkrise von 2001. Das mag in manchen Situationen vernünftig sein, bedeutet aber nicht, dass damit der Zins abgeschafft wäre oder der Kapitalismus grundlegend verändert. Die argentinischen Tauschkreise sind kollabiert, weil Leute entdeckten, dass man die Tauschgutscheine, über die der Handel abgewickelt wurde, in Farbkopiergeräten vervielfältigen kann.
Aber nehmen wir einmal an, sie wären fälschungssicher gewesen: Was, wenn jemand eine größere Investition tätigen wollte? Hätte er dann nicht versucht, sich solche Gutscheine zu leihen? Und wären nicht andere bereit gewesen, zu verleihen? Für eine kleine Entschädigung natürlich – sagen wir vier Prozent pro Jahr?