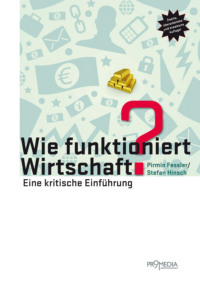Kitabı oku: «Wie funktioniert Wirtschaft?», sayfa 3
Transparenz und asymmetrische Information
Es ist unmittelbar nachvollziehbar, dass Märkte nicht funktionieren können, wenn entweder KäuferInnen oder VerkäuferInnen nicht wirklich wissen, was gekauft wird. Märkte müssen transparent sein, Information relativ gleich verteilt.
Das Problem mag auf den ersten Blick ein wenig esoterisch erscheinen, auf den zweiten Blick ist es gar nicht so selten. Popcorn in einem Kino ist grundsätzlich ein perfektes Beispiel für einen funktionierenden Markt. Es gibt keine Externalitäten, weil der Verkauf von Popcorn weder Umweltschäden noch sonstige Kosten für die Gesellschaft verursacht. Es gibt zahlreiche AnbieterInnen. Die KäuferInnen wissen, was sie bekommen, und werden auch im Vorhinein darüber informiert, was es kostet. In einem Bereich fehlt die Transparenz: Ohne Chemiebaukasten können die KundInnen nicht bestimmen, welche möglicherweise giftigen Geschmacksverstärker ihren Weg in sein Popcorn gefunden haben. Um diese asymmetrische Information auszugleichen, benötigt es eine Institution, die regulierend eingreift und die Qualität sicherstellt. Das mag ein staatliches Gesundheitsamt sein, samt einem gesetzgebenden und wissenschaftlichen Apparat, der gesundheitsschädliche Geschmacksverstärker ausforscht und schließlich verbietet.
Andere Beispiele: Bis vor relativ kurzer Zeit waren Mobilfunktarife so kompliziert, dass es fast unmöglich war, den billigsten zu bestimmen. Ein ernstes Problem gibt es dabei im Gesundheitsbereich. Im Wesentlichen müssen sich PatientInnen auf das Wort der Ärztin oder des Arztes verlassen, wenn diese ihnen eine Behandlung verschreiben. Nun wollen wir nicht vermuten, dass ÄrztInnen tatsächlich in betrügerischer Absicht sinnlose Untersuchungen verordnen und sich dafür bezahlen lassen. Dennoch gibt es einen gewaltigen Anreiz für ÄrztInnen oder Krankenhäuser – die in der Regel nicht für die erreichten Resultate, sondern für die durchgeführten Leistungen bezahlt werden –, das »Notwendige« ein bisschen breiter auszulegen. Eine gewisse Kontrolle scheint also angebracht.
Das dürfte ein zentrales Problem des amerikanischen Gesundheitswesens sein: Die Krankenhäuser sind allesamt privat und es gibt keine Aufsicht über die erbrachten Leistungen. Die einzelnen PatientInnen haben kaum Möglichkeiten – aber grundsätzlich auch wenig Interesse –, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Sofern sie versichert sind, zahlen sie die Behandlung ohnehin nicht selbst. In der Folge wird das Ganze recht teuer für die privaten Krankenversicherungen und deren Versicherte, welche die Kosten über sehr hohe Beiträge bezahlen müssen, aber ebenso für die Öffentlichkeit, denn im Gegensatz zur allgemein verbreiteten Meinung kommt auch in den USA der Löwenanteil dieser Gelder vom Staat. Die USA geben 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aus – einsame Spitze unter den Industriestaaten. Österreich und Deutschland liegen etwa bei 10 Prozent und Großbritannien bei 8 Prozent. Für so viele Dollar gibt es dafür eine etwas mittelmäßige Leistung, denn in verschiedenen Vergleichsstudien schneidet das US-Gesundheitssystem relativ schlecht ab.
Soziale Gerechtigkeit
Märkte fördern keine gleichmäßige Verteilung von Einkommen. Sie sichern auch keine Mindestversorgung mit Nahrung oder Wohnraum zu.
Als im Sommer 2008 der Ölpreis auf knapp 150 Dollar pro Fass gestiegen war, wurde es interessant, Mais zu Treibstoff zu verarbeiten und in die Tanks zu füllen. Das hat natürlich den Preis für Lebensmittel nach oben getrieben, was in einigen Staaten zu Hungerrevolten führte. Der Getreidemarkt hat kein Gewissen. Es ist ihm egal, ob die Maisnachfrage von hungrigen Kindern oder von AutofahrerInnen kommt. Wir erinnern uns: Der Markt teilt knappe Ressourcen konkurrierenden Zielen zu – welches dieser Ziele verfolgt wird, hängt nicht an politischen oder moralischen Erwägungen, sondern an der Frage, wer mehr bezahlt. Das Marktmodell verspricht lediglich Effizienz. Die Annahme ist, dass es bei gegebenem technischem Apparat insgesamt billiger und effizienter ist, Mais zu tanken, statt weniger Auto zu fahren. Kinder in Haiti sind nur insofern auf der Rechnung, als sie über Kaufkraft verfügen.
Auch überzeugte Marktliberale würde hier zustimmen: Wer eine andere Einkommensverteilung möchte oder ein Menschenrecht auf Nahrung, muss sich um Möglichkeiten jenseits des Marktes bemühen, wobei die liberale Wirtschaftstheorie eine Sozialpolitik fordert, die den Markt möglichst wenig stört, also etwa keine Höchstpreise für Mais, sondern eher direkte Transfers, damit die Armen nicht verhungern.
Der Wohlfahrtsstaat
Wie frei sollen Märkte sein? Wie viel Staat und Regulierung sind notwendig? Wird das Funktionieren von Märkten mit den Methoden der Neoklassik untersucht, dann ist ein abschließender Befund nicht möglich. Das mathematische Modell funktionierender Märkte bringt kein eindeutiges Ergebnis, sobald die einfache Tauschwirtschaft verlassen wird. Und ehrlich gesagt: Für die einfache Tauschwirtschaft ist der theoretische Apparat ein wenig überzüchtet, denn diese hat ob ihrer Einfachheit kein Koordinierungsproblem. Der Bauer und die Werkzeugmacherin müssten sich im Wesentlichen nicht über den Markt koordinieren, dafür wäre ein Wirtshaus ausreichend.
Eigentlich herrscht in der Wirtschaftskunde Einigkeit: Wenn keine vollständige Konkurrenz vorhanden ist, wenn große Externalitäten vorliegen oder die Transparenz nicht gegeben ist, dann braucht es einen regulierenden Eingriff. Nur: Bei etwas genauerem Hinsehen ist es gar nicht so einfach, einen Markt zu finden, wo tatsächlich so etwas wie vollständige Konkurrenz herrscht, und Externalitäten können praktisch überall beobachtet werden.
Vom Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre wurden aufgrund des theoretischen Apparats der Neoklassik (und der Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise) eine sehr große Zahl staatlicher Eingriffe und Regulierungen gefordert und durchgeführt. Als Schlussfolgerung des allgemeinen Marktversagens wurde der Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit errichtet: Sozialstaat, um die Armut zu bekämpfen; ein großer öffentlicher Sektor, um Leistungen zur Verfügung zu stellen, bei denen mit großen positiven Externalitäten gerechnet wird (Bildung, Gesundheit, Eisenbahn …); Industriepolitik, etwa in Frankreich oder in Asien, welche die Modernisierung der Wirtschaft planmäßig vorantreibt, teilweise ergänzt um einen Sektor verstaatlichter Industrie (wie in Österreich); eine Regulierung des Arbeitsmarktes über zentrale Lohnverhandlungen und langfristige Verträge; Eingriffe in die freie Preissetzung, etwa bei Wohnungsmieten; eine strenge Regulierung des Finanzwesens, um zu riskante Kreditvergaben zu verhindern.
Seit Mitte der 1970er kommt es zu einer Ablehnung staatlicher Eingriffe, wobei der freie Markt auf den Fahnen geführt wird und sich die ProponentInnen ebenfalls auf das Marktmodell berufen. Letztlich gibt es für beide Seiten keine mathematische Gewissheit, allein die politische und ideologische Überzeugung ist ausschlaggebend.
Die wirksamsten Argumente gegen den staatlichen Eingriff werden in der Folge auch nicht mit einem mathematischen Marktmodell begründet.
Freiheit und Unternehmertum
Auf der Ebene öffentlicher Wahrnehmung waren die Freiheit und der freie Unternehmer möglicherweise das wirksamste Argument gegen staatliche Eingriffe. Die überzeugtesten VerfechterInnen kommen aus der »Österreichischen Schule«; der wichtigste von ihnen ist wohl Friedrich von Hayek. Die Verteidigung der wirtschaftlichen Freiheit ist bei Hayek grundlegend philosophisch. Er glaubt, dass jeder staatliche Eingriff in Richtung autoritärer Staat führt, sein »Weg in die Knechtschaft« richtet sich gleichermaßen gegen Sozialismus wie Nationalsozialismus (denen relative Nähe unterstellt wird). Hayek geht es nicht allein um Effizienz, denn er verteidigt freie Märkte auch dort, wo sie weniger Wachstum bringen – um der Freiheit willen.
Allgemein wird heute den freien UnternehmerInnen höherer Einsatz unterstellt, während überall bekannt ist, dass »der Staat nicht wirtschaften kann«. Dem gegenüber müssten zwei Dinge festgestellt werden:
Erstens: Die Reduktion der Freiheit auf wirtschaftliche Freiheit scheint sehr verengt. Hat ein allgemeiner Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, Mobilität oder Nahrungsmitteln nichts mit Freiheit in der Gestaltung des Lebens zu tun? Auch ist »der freie Unternehmer« nicht grundsätzlich mit einem schwachen Staat und auch nicht notwendigerweise mit der Demokratie verbunden. Die liberalen Wirtschaftsreformen in Chile in den 1970er Jahren waren auf der Grundlage einer Militärdiktatur möglich, die politische GegnerInnen in Fußballstadien folterte und dreitausend von ihnen ermordete.
Zweitens: »Der Staat kann nicht wirtschaften.« – Das ist eine Art Trivial-Volkswirtschaftslehre, basierend auf Anekdoten, deren allgemeine Aussagekraft zweifelhaft ist. Die Geschichten über unfähige und schwerfällige staatliche BürokratInnen sind bekannt, aber es können genauso gut gegenteilige Anekdoten präsentiert werden: Singapurs Staatsfonds Temasek gehört zu den erfolgreichsten Finanzinvestoren der Welt; POSCO, der weltweit zweitgrößte Stahlkonzern und Asiens profitabelster, war bis zum Jahr 2000 im Eigentum des südkoreanischen Staates – ohne deswegen besonders unfähig zu sein; die weltgrößten Banken nach Börsenwert befanden sich 2009 in China, und zahlreiche ausländische InvestorInnen stehen Schlange, um Minderheitsanteile zu kaufen – ohne sich daran zu stoßen, dass der chinesische Staat die Kontrolle besitzt. Die Sache ist offensichtlich nicht ganz so einfach.
Die Aussage »Der Staat kann nicht wirtschaften« wird dabei einerseits an einer falschen Anreizstruktur festgemacht (nur der freie Unternehmer sei ausreichend motiviert), aber es werden auch andere Argumente vorgebracht.
Informationsdefizit der Planwirtschaft
Das Informationsdefizit einer zentralen Stelle ist das entscheidende wissenschaftliche Argument (im Gegensatz zum philosophischen rund um die Freiheit), das Hayek vorbringt. Während der Markt eine dezentrale Koordinierung ermöglicht – die MarktteilnehmerInnen müssen nur auf Preissignale reagieren –, muss eine zentrale Planung Informationen aus der gesamten Volkswirtschaft richtig verarbeiten, weil die einzelnen Produktionsprozesse aufeinander abgestimmt werden müssen.
Gegen eine Planwirtschaft sowjetischer Prägung sitzt der Vorwurf. Obwohl ursprünglich viele davon ausgegangen waren, dass die Planwirtschaft in der Koordinierung der Wirtschaft überlegen sei, hat es sich als unmöglich herausgestellt, eine gesamte Volkswirtschaft von einem Planungsministerium in Moskau aus im Detail zu steuern.
Daraus abzuleiten, dass jede staatliche Planvorgabe unmöglich sei, ist allerdings etwas verwegen, zumal die reale »Marktwirtschaft« voll von Planung ist, und einiges funktioniert ganz gut: Planung durch den Staat (etwa wenn er den Verlauf von Eisenbahntrassen oder den Standort von Schulen festlegt) und durch die großen oligopolistischen Unternehmen. Ein Konzern wie Siemens plant für die nächsten Jahre, manchmal Jahrzehnte. Technologieentscheidungen werden getroffen ebenso wie Standortentscheidungen. Es wird versucht, langfristige Lieferverträge abzuschließen, damit sich die Planung in einem stabileren Rahmen bewegt und nicht von wechselnden Marktpreisen durcheinandergeworfen wird. Beispielsweise führt Anfang 2013 der französische Stromkonzern EDF Verhandlungen mit der britischen Regierung über die Errichtung von zwei Atomkraftwerken für 14 Milliarden Pfund (wobei solche Projekte ihren Kostenrahmen noch nie eingehalten haben). Dabei beginnt EDF nur dann zu bauen, wenn ein entsprechender Strompreis garantiert wird. Man möchte eben Planungssicherheit; auf dem freien Markt ist das unternehmerische Risiko zu hoch.
Warum eine staatliche Stelle schlechter in der Lage sein soll, Zukunftstechnologien zu erkennen, als der Vorstand von Siemens oder EDF, ist nicht nachvollziehbar. Natürlich gibt es ein Problem von Informationsdefiziten, das findet sich allerdings auch bei jedem internationalen Großkonzern. Selbstverständlich gibt es auch Strategien, diese Informationsdefizite auszugleichen, etwa überzogene Zentralisierung zu vermeiden. Unternehmensführung und Controlling sind zentrale Bestandteile eines Betriebswirtschaftslehre-Studiums.
Im Endeffekt gibt es Probleme, die jenseits kollektiver Planung schlicht unlösbar sind. Betrachten wir etwa ein Problem wie den Treibhauseffekt (die Mutter aller Externalitäten): Welche Lösung soll hier gefunden werden, wenn keine weit in die Zukunft gerichteten Politikvorgaben vorkommen dürfen? Es ist kein Zufall, dass der Ultraliberalismus die Speerspitze der »Klimaskeptiker« bildet, welche die Klimaerwärmung für eine Verschwörung halten, weil nicht sein darf, was der Markt nicht lösen kann.
Principal-Agent-Probleme
Die seriöseste Argumentationslinie gegen staatliche Intervention sind die Principal-Agent-Ansätze der 1970er Jahre. Die Frage lautet: »Wer ist eigentlich der Chef und wer führt seine Anweisungen aus?« Passend zum damals vorherrschenden technokratischen Modernismus hat die welfare economy der Nachkriegszeit den Staat als eine Art unkorrumpierbaren Engel über der Gesellschaft verstanden, als Ausdruck eines Allgemeininteresses oder zumindest des Mehrheitswillens. Der Staat als »Agent« seines »Principal«, der Öffentlichkeit.
In den 1970er Jahren kam diese Vorstellung zunehmend in die Kritik: einmal durch den Wirtschaftsliberalismus, der statt Marktversagen Staatsversagen ausmachte. Der »Agent« hat eigene Interessen, die mit jenen des »Principal« nicht übereinstimmen müssen. Aber auch durch den in der »Neuen Linken« erstarkten akademischen Marxismus geraten die etwas naiven Vorstellungen vom Wohlfahrtsstaat unter Druck. Staatsapparate vertreten Eigeninteressen oder sie machen Politik für bestimmte Interessengruppen.
Der Wirtschaftsliberalismus hielt den Staatsapparat für eine Geisel der Gewerkschaften, aber das Problem ist durchaus breiter zu fassen – nicht nur Gewerkschaften können politischen Druck ausüben: Der amerikanische Präsident Eisenhower bezeichnete die Verflechtung von wirtschaftlichen Interessen und den politischen und militärischen Apparaten als »militärisch-industriellen Komplex«. Der Marxismus spricht (wohl etwas vereinfachend) vom Staat als dem Instrument der »herrschenden Klasse«. James K. Galbraith – wahrlich kein Liberaler unter den ÖkonomInnen – sieht den Staat als Selbstbedienungsladen für »räuberische« Eliten.
Es reicht, heutige intensive Lobbyingaktivitäten zu betrachten oder die Verflechtungen aus Politik und Finanzwirtschaft, um festzustellen, dass der Staat kein unparteiischer Schiedsrichter über der Gesellschaft ist, sondern Interessen verfolgt.
Es bleibt aber die Frage, ob deswegen staatliche Eingriffe automatisch zum Scheitern verurteilt sind. Wenn es auch stimmt, dass Staatsapparate und gesellschaftliche Gruppen Eigeninteressen verfolgen, so sind diese nicht mit einfacher Korruption gleichzusetzen – zumindest nicht immer. Die französische Bürokratie verfolgte bis in die 1980er Jahre ein Modell eines staatlich gelenkten Kapitalismus, der etwa die Kreditvergabe der Banken in bestimmte vorgegebene Richtungen kanalisierte.
Diese Tradition hat der staatlichen Bürokratie bis heute eine Sonderstellung in der französischen Gesellschaft und einen besonderen Platz unter den Eliten verschafft – es kann also festgehalten werden, dass der dirigisme sich für seine VerwalterInnen durchaus bezahlt gemacht hat. Dennoch war das Ziel dieser staatlichen Eliten nicht nur einfache Bereicherung, sondern auch die Modernisierung Frankreichs, natürlich gemäß bestimmter politischer Vorstellungen.
Außerdem muss festgehalten werden, dass Principal-Agent-Probleme nicht auf den Staatsapparat beschränkt sind. Wenn das Management einer Bank im Fall eines Gewinns mit dicken Boni rechnen darf, für Verluste aber nicht geradestehen muss, dann wird es die Geschäfte ein wenig riskanter anlegen, als es im langfristigen Interesse der EigentümerInnen wäre.
Allgemein tauchen Principal-Agent-Probleme immer dann auf, wenn EigentümerInnen oder AuftraggeberInnen von den Ausführenden getrennt sind. Aus diesen Schwierigkeiten wird aber nicht die Schlussfolgerung getroffen, Aktiengesellschaften sofort aufzulösen, sondern es wird nach Wegen gesucht, das Management zu kontrollieren. Principal-Agent-Probleme sind eine echte Schwierigkeit bei staatlichen Eingriffen, aber möglicherweise ist Demokratisierung die bessere Antwort als völlige Abstinenz des Staates in wirtschaftlichen Fragen.
In der real existieren kapitalistischen Wirtschaft ist der Staat nämlich nicht wegzudenken. Er garantiert Rahmenbedingungen wie den Schutz von Privateigentum, Rechtssicherheit, Patentrechten und vieles mehr. Kapitalismus bedeutet seit fünfhundert Jahren immer auch Riesenkonzerne, von der britischen Ostindien-Kompanie zu den japanischen Zaibatsu der Vorkriegszeit und den heutigen Multis. Konzerne haben wiederum die Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Stellung in politische Macht umzusetzen, etwa um Staatshilfen zu erhalten oder Konkurrenten auszuschalten. Auf der Grundlage unvollständigen Wettbewerbes (große Konzerne statt vieler kleiner AnbieterInnen) ist eine Trennung von »Staat« und »Wirtschaft« kaum möglich. Wer vor diesem Hintergrund einen Rückzug des Staates fordert, meint daher in der Regel das Zurückdrängen bestimmter Interessengruppen – während andere weiterhin Einfluss ausüben können. So ist es auch kein Wunder, dass es sich dabei meist um jene politischen Gruppierungen handelt, die ein besonderes Naheverhältnis zu Unternehmerverbänden aufweisen.
Und? Wer koordiniert jetzt die Wirtschaft?
Wir kommen auf den Beginn des Kapitels zurück und wiederholen: die spontane Ordnung des Marktes; die Planung des Staates und der großen Oligopole; institutionelle Arrangements, etwa das Zusammenspiel von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden auf dem Arbeitsmarkt. Alle drei spielen eine Rolle. Der Versuch, Märkte völlig abzuschaffen – der in der Sowjetunion unternommen wurde –, ist gescheitert. Eine zentrale Detailplanung über eine gesamte Volkswirtschaft ist mit großen Effizienzverlusten verbunden; in der entstehenden Mangelwirtschaft ist der Markt als Schwarzmarkt über die Hintertür zurückgekehrt.
Der Versuch, den Staat völlig auf die Seite zu schieben, ist eigentlich seit den 1980er Jahren wissenschaftlich wieder auf dem Rückzug und spätestens seit der aktuellen Weltwirtschaftskrise politisch überholt. Für das richtige Verhältnis zwischen Staat und Markt, für die Frage, wie Marktversagen festgestellt und der Staat kontrolliert werden kann, gibt es keine mathematische Lösung, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Antworten. Und was für den Staat und eine Aktiengesellschaft gilt, gilt auch für die Wissenschaft. Keine dieser Antworten ist völlig frei von »Principal-Agent-Problemen« – auch in jeder wissenschaftlichen Antwort finden sich unterschiedliche Interessen in einer Gesellschaft, die niemals frei von Konflikten war.
Die Frage »Wie wird die Wirtschaft koordiniert und warum fällt sie nicht beständig auseinander?« ist berechtigt. In diesem Kapitel haben wir versucht, Hinweise zu ihrer Beantwortung zu geben. Bei der in diesem Zusammenhang ebenfalls geführten Debatte »Wer koordiniert besser – Staat oder Markt?« muss man jedoch ein wenig aufpassen. Teilweise führt sie am Wesentlichen vorbei, denn beide – Staat und Markt – spielen immer eine Rolle.
Selbst ein vorgeblich enthaltsamer Staat verschwindet nicht. Auch die Entscheidung, Marktkräften freien Lauf zu lassen, benötigt politisches Eingreifen. Als etwa die britische Regierung unter Margaret Thatcher Anfang der 1980er Jahre die britische Bergbauindustrie zusammenbrechen ließ, musste sie sich doch mit den Auswirkungen dieser Entscheidung auseinandersetzen und Polizeikräfte gegen die streikenden Kumpels losschicken. Unter dem neoliberalen US-Präsidenten Ronald Reagan wurden die Militärausgaben verdoppelt – nicht gerade ein Zeichen für einen schwachen Staat.
Es ist außerdem keineswegs so, dass solche Entscheidungen dann in einem Raum getroffen werden, in dem Interessen und Interessengruppen keine Rolle spielen. Die Finanzwirtschaft im Südosten Englands war die Gewinnerin der marktliberalen Reformen und hat diese auch nach Kräften gefördert. Die Rüstungsindustrie hat ein Interesse an Rüstungsprogrammen. Es stellt sich also nicht die Frage, ob staatliche Eingriffe abgelehnt oder befürwortet werden, sondern eher, was für einen staatlichen Eingriff eine Gesellschaft wünscht und wem dieser helfen soll. Bei der Frage »Wer wirtschaftet (reguliert) besser – Staat oder Markt?« sollte beachtet werden, was »besser« bedeutet. Ist damit einfach ein mehr an Wirtschaftswachstum gemeint, die Fähigkeit, mehr herzustellen als in der Periode davor?
Ohne umfangreiche Belege vorlegen zu können: Wir würden davon ausgehen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg jene Staaten das höchste Wachstum aufgewiesen haben, die staatliche Eingriffe und eine vorsichtige zentrale Planung mit einer Orientierung auf den Weltmarkt und einem relativ autoritären Staat kombiniert haben; zumindest scheint das für relativ arme Länder der Fall zu sein, etwa Südkorea (rechtsgerichtete Militärdiktatur bis in die 1980er Jahre) oder China seit der wirtschaftlichen Öffnung ab Ende der 1970er. Für das rasche Wachstum kann es natürlich auch andere Gründe geben, aber selbst wenn nicht: Es stellt sich die Frage, ob eine gerechtere Einkommensverteilung und legale Gewerkschaften nicht zwei Prozentpunkte weniger Wachstum pro Jahr wert sind.