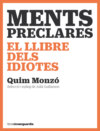Kitabı oku: «Hundert Geschichten», sayfa 8
Tricks
Der Morgen zeigte sich muffelig. Beim Tennis gab sich Enric den normalen Wechselfällen auf dem Platz hin: Zum Beispiel war der Schmetterball etwas lang (oder kurz; oder perfekt) und Natxo verlor (wie so oft) den Ball, der gegen eine Wand schlug (oder im Metallnetz oder in den Bäumen landete) und dann neben einem leeren Klappstuhl liegen blieb. Nehmen wir an (um es kurz zu machen), dass er mit diesem Ball das Spiel in der Tasche hatte, den Satz und das Spiel: Das sind Details, die nicht so wichtig sind: Enric gewann fast immer.
Danach duschte er und zog sich an. Natxo schlug vor, zusammen zu Mittag zu essen. Enric lehnte ab: Er musste sich mit Pepa treffen. Sie vereinbarten, wegen des Abendessens zu telefonieren.
Pepa kam zu spät. Sie entschuldigte sich schon unter der Tür. Zudem hatte sie bereits gegessen: ein belegtes Brötchen mit ihren Kommilitonen. Es tat ihr sehr leid. Enric dachte, von einem belegten Brötchen werde man nicht satt. Pepa sagte, sie werde etwas trinken. Der Kellner nahm die Bestellung auf. Pepa lächelte. Enric erzählte, er habe ein Haus auf Menorca gekauft (fürs Wochenende) und überlege, ob er zur Vereinfachung den Pilotenschein mache. Pepa schlug vor, ins Kino zu gehen.
Zwei Stunden später kamen sie aus dem Kino. Sie gingen zu Enric und dann ins Bett. Sie lagen im Halbschlaf, als um acht das Telefon klingelte. Es war der verärgerte Natxo: Er hatte sich zweimal hintereinander verwählt. Immer mit derselben Nummer. Sie verabredeten sich zum Abendessen. Im Schlafzimmer war Pepa noch am Schlafen. Enric biss ihr in die Schenkel.
– Duschen wir zusammen?
Halb eingeseift, klingelte das Telefon noch einmal. Mit einer schaumigen Erektion verbreitete Enric Fußabdrücke auf den Fliesen. Pepa fasste sich beleidigt an eine Brustwarze.
– Ja?
Auf der anderen Seite Schweigen; jemand, der fast unhörbar atmete.
– Ja?
Die Atmung kam ins Zweifeln. Es schien, als würde sie sich das Lachen verbeißen. Enric stellte sich einen Apfelbaum ohne Äpfel und ohne Blätter vor: aus Pappe; oder einen stummen Papagei, der aus einer ganz nahen anderen Welt anruft. Schließlich redete eine Frauenstimme:
– Hallo, Enric. Erinnerst du dich an mich?
Er erinnerte sich nicht. Für einen Moment überlegte er: »Vielleicht Eva oder Anna.« Er ließ alle Möglichkeiten Revue passieren: Diese Stimme war ihm hundertprozentig unbekannt. Die Erektion war dahin, die Seife tropfte auf den Boden und hinterließ eine Pfütze.
– Offen gestanden . . .
– Erinnerst du dich nicht an aaallllll das, was wir gemeinsam gemacht haben?
Die Stimme wollte erregend sein und machte sich stattdessen lächerlich. Niemand kann fragen: »Erinnerst du dich nicht an all das, was wir gemeinsam gemacht haben?«, es sei denn aus Jux. Er wollte gerade antworten, als die Stimme wieder sprach:
– Ich schon, ich erinnere mich an dich. Willst du wissen, was ich mache, wenn ich mich an dich erinnere? – Die Stimme atmete übertrieben, schnalzte mit der Zunge an den Gaumen – Kannst du es dir vorstellen? Zuerst lutsche ich an einem Finger, ich sauge daran, als sei er aus Honig. Dann gleite ich mit der Hand ganz langsam, denn ich habe es nicht eilig (ich habe die ganze Zeit der Welt) den Körper entlang nach unten und streichle alles, jede Mulde, denn es ist ein empfindsamer Körper, den man sehr sanft behandeln muss. Und genau da, wo ich mich gerade anfasse, an diesem flackernden Knöspchen, sterbe ich vor Lust; mit der anderen Hand stecke ich einen Finger in ein seidenes Loch, warm und saftig . . .
Enric legte auf. Er versuchte zu erraten (jetzt, wo er sich sicher war, die Besitzerin der Stimme nicht zu kennen), welcher Bekannte sich, zwei Meter vom Telefonapparat entfernt, vor Lachen bog, während eine Freundin, die sich mit ihm verschworen hatte, die Verführerin spielte. Die Erektion war nun wieder da. Er beeilte sich und warf sich in die Badewanne. Er setzte das ganze Badezimmer unter Wasser.
– Weißt du, was das war? Ein schweinischer Telefonanruf.
– Was hat sie dir gesagt?
– Sie hat mir gesagt, wie sie sich genau so zwei Finger reinsteckt.
Als eine halbe Minute später das Telefon noch einmal klingelte, waren schon drei Finger drin. Sie taten, als hörten sie es nicht. Es klingelte weiter, lang, minutenlang, wie die Sirene eines Krankenwagens.
Am nächsten Tag speiste Enric nach dem gewonnenen Tennisspiel mit einem Bankberater. Später rief Lídia an. Sie verabredeten sich für abends, er würde sie abholen. Zu Hause zog sich Enric um, hörte Musik, las einen Bericht; als um Punkt acht das Telefon klingelte, las er das International Management und gähnte.
– Hallo, Enric. Erinnerst du dich immer noch nicht an mich?
– . . .
– Gestern nacht habe ich ganz intensiv an dich gedacht und . . .
– Und du hast dir drei Finger reingesteckt?
– Vier. Weil ich sehr feucht war und sie ganz leicht hineinglitten, sanft, wie nie . . .
Enric legte auf. Es fehlte nur noch, dass er ihr erlaubte, ihn zum Schwanken zu bringen. Er zog sich an. Er legte Klaus Schulze auf (das war die Musik, die Lídia mochte) und bereitete alles so weit vor, dass er nur noch den Plattenspieler anstellen brauchte, sobald sie nach Hause kamen.
Drei Tage lang wiederholte sich der Anruf immer zur gleichen Zeit. Am vierten Abend um acht versammelte Enric alle seine Freunde und Freundinnen, die von der Geschichte wussten, um das Telefon und jedes Mal, wenn es klingelte, nahm eine andere Person ab und leugnete, dass dies die gewählte Nummer sei. Beim fünften Mal sagte die Stimme »Idiot« und rief nicht mehr an.
In jener Nacht ging Enric früher als sonst schlafen. Am nächsten Morgen verlor er zum ersten Mal in sechs Monaten ein Spiel. Irritiert rief er nicht, wie verabredet, Pepa an, sondern verbrachte den Nachmittag damit, lauter nutzloses Zeug zu kaufen einschließlich einer Blumenvase in einem Antiquitätengeschäft. Um halb acht saß er halb eingenickt vor dem Fernseher. Zwei vor acht klingelte das Telefon. Er wunderte sich: Die anonymen Anrufe waren immer überaus pünktlich. Er nahm ab: Pepa: Wie geht’s so? Fünfzehn Sekunden vor acht suchte Enric nach einer Ausrede: Er würde sie später anrufen. Sobald er den Hörer aufgelegt hatte, klingelte das Telefon noch einmal.
– Ja?
– Hallo.
Ab diesem Moment ist es leicht, diese Geschichte weiterzuspinnen, und vielleicht wird sie dadurch langweiliger. Es heißt also, sich kurz zu fassen und sowohl psychologische Erklärungen (ständig verfügbare Ausflüchte, mit denen man alles und jedes rechtfertigen kann) zu vermeiden als auch die Beschreibung der Reaktionen von Freunden und Freundinnen, die wachsende Sorge der Bankberater, die Maßnahmen der Familie (erst befremdet, dann nacheinander besorgt, empört, entschlossen): Sie sind leicht vorhersehbar und von Mal zu Mal schärfer.
Tagelang versuchte Enric, sich mit der geheimnisvollen Stimme zu verabreden. Nach vielen Abenden Kampf willigte die Stimme ein: morgen um acht an dem und dem Ort. Enric beschrieb sich, damit sie ihn erkennen konnte: grauer Anzug und rote Nelke am Kragen. Die Stimme fand das lustig. Enric freute sich darüber.
Am nächsten Abend um acht war er zum ersten Mal seit Wochen nicht vor dem Telefon. An dem vereinbarten Ort war es brechend voll, und niemand kam auf ihn zu. Er konnte nicht feststellen, ob sie da war oder nicht, und falls sie da war, wer sie war. Er kam spät und betrunken nach Hause zurück, mit zu großen Schlüsseln für zu kleine Schlösser. Beim nächsten Anruf zeigte er sich verärgert. Die Stimme sagte, sie sei da gewesen, hätte es aber vorgezogen, nichts zu sagen und zu schauen, wie er reagiere. Ärgerlich legte Enric den Hörer auf und bereute es sogleich, denn wenn sie zur Verabredung gekommen war, sich nicht vorgestellt, sondern stattdessen ihn beobachtet hatte, so bedeutete dies, dass sie von diesem Spiel allmählich genug hatte. Er wartete auf einen weiteren Anruf, der nicht kam. Er schlief schlecht. Am nächsten Tag um acht abends blieb das Telefon stumm. Als es drei Tage später endlich wieder klingelte, war es nur, um ihm mitzuteilen, dass das Spiel zu Ende sei, dass sie die Nase voll habe von einer Geschichte, die sie aus Spaß begonnen hatte, rein zufällig, als eines Tages jemand anrief, der sich verwählt hatte und nach einem Enric fragte und dabei die Nummer zwei Mal wiederholte, oft genug, um sie zu notieren und das Spiel zu beginnen. Nun würde sie nicht mehr anrufen. Enric bat um ein Treffen. Sie sagte nein. Er insistierte. Sie lehnte kategorisch ab. Er hatte Angst, sie könne den Hörer auflegen, und hätte sich damit zufriedengegeben, dass alles weiterging wie bisher, ohne ein Treffen: ein täglicher Anruf. Sie antwortete, sie habe ihre Entscheidung bereits gefällt: Sie würde nicht mehr anrufen. Und legte auf.
Enric dachte über verschiedene Möglichkeiten nach: Wenn sie seinen Namen und seine Nummer wegen ein paar verwählter Anrufe herausbekommen hatte, dann mussten beide Telefonnummern sehr ähnlich sein: nur eine oder maximal zwei Ziffern Unterschied. Er beschloss, alle möglichen numerischen Variationen auszuprobieren. Doch die möglichen Kombinationen von sieben Ziffern sind zahlreich. Nach wenigen Tagen war sein Finger müde, und er grämte sich, weil ihre Nummer eine der vielen sein konnte, die er probierte, es unendlich lang klingeln ließ, aber niemand abnahm. Er versuchte es über Wochen hin: Er wählte Tausende von Nummern; nichts, rein gar nichts.
Er stellte sich hunderttausend mögliche Tode vor. Er würde aus Liebe sterben, aus Liebe für eine Frau, von der er nicht mehr kannte als ihre Stimme. Jeden Abend, wenn er nach einem anstrengenden Tag (vor acht, falls sie doch anrufen würde) den Hörer auflegte, entschied er sich für einen anderen Freitod: Schließlich hatte er das größte Handbuch zu dem Thema beisammen. Er stellte sich die Schlussszene in einem Film vor, immer dieselbe: Um acht Uhr abends, der Sarg mit seiner Leiche wird gerade hinausgetragen, da klingelt das Telefon, einen Tag zu spät.
Alles überstürzte sich, doch ganz anders als gedacht: Nachdem er sich wochenlang in der dunkelsten Ecke seiner Wohnung verschanzt hatte (um den polizeilichen Ermittlungen, den Brigaden von Psychoanalysten, die ihm die Familie auf den Hals schickte, der Belagerung von Freunden und Freundinnen aus dem Weg zu gehen) fand er eines Abends unter der Wohnungstür eine Telefonrechnung mit einem Datum, das bereits eine Weile zurücklag, und die die unmittelbar bevorstehende (und daher schon eingetretene) Drohung enthielt, ihm das Telefon abzustellen. Er rannte zum Telefon, hob den Hörer ab, wissend, was ihn erwartete: null Ton. Daraus entnahm er, dass es bei den Bemühungen seiner Familie, ihm (angesichts seines offensichtlichen Wahns) die Konten zu sperren, einen Fehler gegeben hatte und die Sperrung nun auch die Zahlungen betraf. Das Ende der Geschichte verliert sich nun in den Labyrinthen, Fluren und Schaltern des Behördendschungels bei dem Versuch alle ausstehenden Rechnungen zu bezahlen, um sein Telefon wieder angeschlossen zu bekommen, und in der immer weiter verblassenden Hoffnung, der Anruf könne sich doch wiederholen; als er dann eines Tages mal wieder auf der Straße war, nahm er die Gelegenheit wahr, anfangs noch etwas vergrätzt, und rief Lídia (oder vielleicht auch Pepa) aus einer Telefonzelle an:
– Hallo, junge Frau.
– Ach, was für eine Überraschung! Hast du eigentlich inzwischen die vierzig überschritten?
Matruschkas
Er rennt über Wiesen, duckt sich in das hohe Gras, versteckt sich hinter den Säulen. Das Haus rückt in immer weitere Ferne. Rechts am Weg Weiden und dann und wann ein weißes Holzschild, auf dem mit schwarzen Buchstaben steht: BADEN VERBOTEN1. Rechtwinklig zum Uferweg gibt es ganz kurze Pfade, die in Treppen mit steinernen Geländern übergehen, in die Vasen und Blumen gemeißelt sind, und deren Stufen in den See hineinführen. Er keucht und schwitzt. Er ist völlig erschöpft. Lehnt sich ans Geländer. Nervös schaut er zurück, dann aufs Wasser, immer wieder, hin und her. Nun läuft er weiter am See entlang bis zur Bootsanlegestelle, die verlassen daliegt. Er sucht den Horizont mit seinem Blick ab. Er weiß, wenn sie noch lange brauchen, wird man ihn schnappen. Er steigt die Treppen wieder hoch. Springt über das Geländer. Versteckt sich hinter den Bäumen. Von da aus übersieht er den See. Er ist ungeduldig. Schaut ständig auf die Uhr. Minuten später hört er ein ganz leises, näher kommendes Geräusch: In der Ferne zwischen dem fahlen Blau von Himmel und Wasser taucht ein Motorboot auf. Ein Vogel durchschneidet die Luft. Er steht vom Boden auf. Ganz vorsichtig biegt er die Zweige auseinander, schaut den Weg hinunter und springt über das Geländer. Als er die Steintreppe zur Bootsanlegestelle hinuntersteigt, hört er hinter sich ein Geräusch. Er dreht sich um: Die Brünette mit Sonnenbrille zielt mit einer Pistole auf ihn. Die Musik wird lauter. Er rennt los, in Richtung Wasser.
Die Leinwand wird schwarz, dann weiß. Die Menge pfeift. Manche brüllen. Die Lichter werden hell. Für einen Moment lässt der Tumult nach. Dann verstreichen zehn langsame Minuten, in denen die Stimmung im Publikum von einem mehr oder weniger geduldigen Warten in offene Empörung umschlägt: Die Menge trampelt mit den Füßen und verlangt eine Erklärung. Verwirrung kommt auf, als endlich ein Vertreter des Kinos herbeieilt und sich kleinlaut entschuldigt, eine unerhörte Sache sei passiert: Der Schluss des Filmes sei nicht da. Und, fügt er an, es sehe nicht so aus, als habe man ihn abgeschnitten, denn übergangslos folge nach den letzten gezeigten Bildern ein Stück schwarzen Filmstreifens. Er bedauere die Störung außerordentlich, vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, dass solche Angelegenheiten sehr ärgerlich seien, insbesondere bei einer Uraufführung. Unter diesen Umständen sei es also das Beste, schlussfolgert er, das Eintrittsgeld zurückzuerstatten, weshalb er die Zuschauer auffordert, den Saal geordnet zu verlassen und sich an den Kassen anzustellen. Er fügt noch hinzu, man habe den Verleih kontaktiert, der ihm versichert habe, von nichts zu wissen und verspreche, sich, sobald wie möglich, mit dem Produzenten in Verbindung zu setzen. Schließlich macht der Vertreter des Kinos eine ohnmächtige Geste mit den Armen und tritt ab. Nach einigen empörten Buh-Rufen verlassen die Zuschauer langsam den Kinosaal. Ein Zuschauer (irgendeiner: Sie können ihn sich aussuchen) gähnt, steht träge auf und begibt sich ins Foyer. Die Schlange, die ansteht, um sich das Eintrittsgeld erstatten zu lassen, vermengt sich mit der Schlange für die nächste Vorführung, die sich nun, perplex, nicht so recht entschließen kann, ihre gute Position, die sie durch eine beachtliche Wartezeit erlangt hat, wieder aufzugeben. Unser Mann hat keine Lust zu warten: Er gibt das Geld verloren und steigt die Straße hinauf. Als er an der halben Schlange vorbei ist, hört er, was aus der Nachricht inzwischen geworden ist: Es heißt, man habe den Film entführt, um Fördergelder für einen Film zu erpressen, der von allen Produzenten abgelehnt worden war. Am Ende der Schlange läuft das Gerücht völlig aus dem Ufer: Durch einen anonymen Anruf habe man erfahren, dass im Kino eine Bombe gelegt worden sei. Die Leute zerstreuen sich leicht beunruhigt durch die Seitenstraßen. Er steigt ins Auto und fährt los. Im Radio kommt Dizzy Gillespie. Er fährt durch Vorortstraßen, die in einem Nebel aus undurchsichtigem Weiß liegen. Nun hört man im Radio einen stotternden Journalisten, der eine Frau ohne Arme interviewt, die ein Kind ohne Beine geboren hat. Ein Unglück kommt selten allein, folgert der Sprecher stammelnd und legt gleich darauf noch einmal Gillespie auf: Russian lullaby, einen Song, den der Mann (und das überrascht ihn) auch in dem Restaurant hört, das er gleich darauf betritt. Er bestellt ein gastronomisches Palindrom (als Vorspeise Melone mit Schinken; dann Schinkenkrustenbraten und als Dessert Melone), in der Hoffnung, den Maître zu verblüffen, der sich aber nicht so leicht beeindrucken lässt. An einem Nebentisch erzählt jemand von einer australischen Telepathin, die genau im selben Moment entsetzt aus einem Traum hochschreckte, als einem Schweizer Kollegen von einer verspielten Nichte mit einer Vorliebe für ungewöhnliche Verkleidungen ein tüchtiger Schrecken eingejagt wurde. Unser Mann lacht, und das Gelächter wird im Laufe des Essens lauter, bis es beim Dessert zu einem Schellen- und Trommelkonzert angewachsen ist, das noch im untersten Verlies der Burg zu hören ist.
Der Wecker. Er schält sich träge aus dem Bett, duscht, rasiert sich und zieht sich an. Er frühstückt im Café gegenüber. Dann steigt er in sein Auto: Bald lässt er die Stadt hinter sich, zehn Minuten lang ist die Straße leer. Er sieht das Haus von Weitem. Er parkt dicht daneben. Rechts am Weg Weiden. Am Seeufer Scheinwerfer, Kabel und Steckdosenleisten.
Sie warten bereits seit geraumer Zeit auf ihn. Er zieht sich rasch um und wird geschminkt. Der Regisseur gibt Anweisung, mit den Dreharbeiten zu beginnen. Er versteckt sich hinter den Bäumen. Sie filmen verschiedene Einstellungen. Dann springt er über das Geländer. Er wiederholt den Sprung zwei Mal. Während er die Steintreppe hinunterrennt, hört er ein Geräusch hinter sich; er dreht sich um: Die Brünette mit der Sonnenbrille zielt mit einer Pistole auf ihn. Er rennt los, in Richtung Wasser. Die Szene wird wiederholt: zwei Mal zielt die Frau auf ihn und zwei Mal rennt er los. Der Regisseur ist nicht zufrieden. Sie wiederholen die Szene ein drittes Mal: Die Frau zielt mit der Pistole auf ihn, er rennt hinunter ans Wasser. Diesmal unterbricht der Regisseur das Drehen nicht. Die Frau schießt. Der Schauspieler stürzt zur Erde.
Im Parkett herrscht für einen Moment Verwirrung: Auch ein Zuschauer ist gestürzt. Man trägt ihn weg, und der Film ist sofort zu Ende.
1 Im Original deutsch.
To choose
When a man cannot choose he ceases to be a man [...] Is a man who chooses the bad perhaps in some way better than a man who has the good imposed upon him?
ANTHONY BURGESS, A Clockwork Orange
Mitten am Vormittag spürte ich, nachdem ich die Post erledigt hatte und mich gerade anschickte, ein paar Briefe durchzusehen, eine Leere im Magen. Nicht wie Hunger: Es war eher eine körperliche Leere, wie ein Ballon, der sich nur schwer hinunterschlucken lässt. Wenn ich die Hand in den Mund hätte stecken und den Hals hinunterschieben können, hätte ich es tasten können: weich und fettig, jenes Nichts, das sich still beschwerte. Im Parterre trank ich ein paar Kaffee. Eine halbe Stunde später war das Unbehagen immer noch da: Diesmal trank ich Sprudel im Café gegenüber. Ich hielt es noch eine weitere Viertelstunde aus, doch jetzt hatte ich bereits das Gefühl, als sei ich innen aus Luft: Wenn mich einer angepiekst hätte, wäre ich geplatzt. Ich bat den Direktor um ein Gespräch: Ich teilte ihm mit, dass es mir nicht gut gehe, und bat ihn um Erlaubnis, nach Hause zu dürfen. Ich beschrieb die Beschwerden ziemlich vage: im Magen, immer heftiger. Dann fügte ich noch starke Kopfschmerzen hinzu, für den Fall, die Symptome kämen ihm leicht oder geringfügig vor. Er gab mir die Erlaubnis und wünschte mir rasche Besserung.
Auf dem Weg grübelte ich herum: Eine diffuse Angst kroch meinen Rücken hinauf, die sich, ohne dass mir das bewusst war, bereits in ein Verlangen verwandelte, das ich nicht mehr würde kontrollieren können. Am Nachmittag passierte gleichzeitig zweierlei: Ich begriff, was mit mir los war, und wollte es nicht akzeptieren. Um nicht weiter darüber nachzudenken, reparierte ich Stecker, hing Lampen auf, staubte Regale ab. An einem Nachmittag erledigte ich alle Arbeiten, die ich monatelang vor mir her geschoben hatte.
Am Abend beim Fernsehen gelang mir die kohärente Formulierung. Und ich wiederholte (so als vertraute ich darauf, dass ich es durch das Aussprechen und Hören in klaren, deutlichen Worten mit der Angst zu tun bekäme und folglich davon Abstand nehmen würde) ich sie laut:
– Ich muss jemanden töten.
Der nüchterne Klang dieser Worte hatte allerdings die gegenteilige Wirkung wie erhofft: So als machten die Signifikanten das Signifikat weniger schlimm (vous pigez la feinte?). Selbstredend trug ich die moralischen Gründe, die dagegen sprachen, vor und beschrieb das Risiko, das damit einherging. Auch denkt normalerweise jemand, der einen Anderen umbringen will, an eine bestimmte Person, und er hat ein Motiv. Ich jedoch war weit von solch einfachen Gefühlen entfernt. Ich spürte die Notwendigkeit zu töten ohne Motiv und ohne ein bestimmtes Opfer, und dieser Drang ließ mich nicht nur mich nicht schlecht fühlen, sondern würde (da war ich mir ganz sicher), falls ich wirklich zur Tat schritte, dazu führen, dass ich hinterher befreit, munter und glücklich wäre.
In dieser Nacht schlief ich schlecht: Albträume quälten mich, aber nicht, weil ich dabei war, eine, sagen wir mal, Schandtat zu begehen (dabei war? so entschieden war der Traum?), sondern weil ich mir für die Entscheidung zu lange Zeit ließ. Es gab einen Moment im Traum, zwischen einer Maiswüste und einem türlosen Gebäude, in dem ich eine Wahrheit begriff, die mir in ihrer Bestimmtheit entsetzlich erschien: Nicht der ist schuldig, der ein Verbrechen begeht, sondern derjenige, der sich dabei erwischen lässt. In der Früh rief ich schweißgebadet im Büro an und schob eine starke Grippe vor. Der Direktor verschrieb mir Aspirin, Cognac, heiße Milch, Honig mit Zitrone und Bettruhe.
Bei mehreren Gläsern Saft überlegte ich lange hin und her: Wen würde ich umbringen und warum? Dabei fiel mir ein (das hatte ich mal irgendwo gehört, wusste aber nicht mehr wo), dass ein perfektes Verbrechen nur dann zustande kam, wenn man zwischen Verbrecher und Opfer unmöglich eine Beziehung herstellen konnte. Wenn ich einen anonymen Fußgänger ermordete, ohne gesehen zu werden, wie könnte man mich beschuldigen, da ich ihn von nirgendwo her kannte und nicht einmal wusste, wer er war? Ich wäre wie ein Heckenschütze, der ihm unbekannte Leute erschießt; doch würde ich die exhibitionistischen Anwandlungen meiden, die häufig zu seiner Verhaftung führen.
Ich brauchte also nicht weiter darüber nachzudenken, wen ich ermorden sollte: Der Zufall würde mir das Opfer zuführen. In einer einsamen Ecke, ohne sein Gesicht zu sehen, würde ich jemanden umbringen und erst am nächsten Tag in der Zeitung sein Gesicht sehen und seinen Namen lesen. Ich musste einzig noch über das Werkzeug nachdenken. Das Auto schloss ich von vornherein aus: Jemanden mit hundert Stundenkilometern in einer dunklen Gasse zu überfahren, erschien mir zu schwierig und riskant für einen wahrscheinlich ungeschickten Anfänger. Stichwaffen erschienen mir roh. Der Strumpf um den Hals schäbig. Der Revolver sagte mir am meisten zu: Er machte aus mir einen Mörder wie im Film.
Zudem würde ich mich der Tat entsprechend kleiden. Ich entwarf die Kleidung: gestreifter Anzug (mit Weste), dunkles Hemd, helle Krawatte, Schnürschuhe. Für Maßschneiderei und Waffenhandlung brauchte ich weniger lang, als ich gedacht hatte. Ich holte ein wunderschönes Paar Schnürschuhe aus dem obersten Fach eines Schrankes. In der Waffenhandlung stieß ich auf keinerlei Probleme: Die extreme Leichtigkeit, mit der man Waffen für die eigene Sicherheit kaufen konnte, machte den individuellen Angriff einfacher denn je. Am selben Nachmittag hatte ich bereits alles zusammen. In dieser Nacht schlief ich durch.
Am nächsten Morgen zeigte mir der Spiegel ein völlig unverbrecherisches Gesicht: Nach so vielen gemeinsam verbrachten Jahren kann ich getrost gestehen, dass mein Gesicht irgendetwas zwischen Seehecht und Ei ähnelt, vielleicht etwas zu blass, verdutzt, aber überhaupt nicht aggressiv. Bevor ich auf die Straße hinaustrat (ich glaubte mir das immer noch nicht in Gänze), steckte ich mir die Waffe zwischen Gürtel und Hemd.
Den ganzen Morgen lang streifte ich durch Parks. Auf einem Platz mit einem Springbrunnen in der Mitte aß ich an einem Kiosk zu Mittag. Dann ging ich unter Pappeln spazieren, von denen ich eigentlich gedacht hatte, sie seien verschwunden. Den ganzen Nachmittag lang streichelte ich mit der einen Hand den Kolben meiner Pistole. Neben einem See, der wie Silberpapier dalag, fütterte eine Alte Tauben. Wir waren absolut alleine. Ich ging weiter: Ganz hinten saß ein Wächter auf einer Bank und säuberte gelangweilt seine Fingernägel. Ich war nicht versucht, auf ihn zu schießen. Danach sah ich zwischen den Bäumen ein Pärchen, das sich mehr als küsste. Ein Gefühl von Zärtlichkeit durchlief meinen Körper.
Wenn ich so wählerisch war, wen sollte ich dann umbringen? Alle erschienen mir zu grau, um zu sterben. Vielleicht jemand Herausragendes? Aus einem unbestimmten Gefühl heraus wusste ich, dass keine dieser Personen das war, was ich suchte. Suchte ich also nach einer bestimmten Person? Auf dem Weg zum Ausgang des Parks kam mir nun ein Mann entgegen, weder jung noch alt, weder groß noch klein, so unbestimmt, dass man an ihm hätte vorübergehen können, ohne ihn zu bemerken. So einen Typ sollte ich umbringen? Ich zog den Revolver, der ja zwischen meiner Leber und dem Gürtel steckte, heraus und schob ihn in die Tasche meines Jacketts. Zehn Schritte von dem Mann entfernt legte ich den Finger auf den Abzug. Kurz bevor ich abdrückte (überrascht, wie leicht es mir gefallen wäre), schoss es mir durch den Kopf, dass mich so viel Mittelmaß nicht überzeugen konnte. Ich verfiel wieder ins Grübeln, und um davon loszukommen, machte ich mir zum wiederholten Mal klar, dass der einzig richtige Weg war, ohne Motiv zu töten, denn nur so konnte das Verbrechen ungestraft bleiben. Einen Moment lang dachte ich, mir fehle es an Entscheidungskraft. Wie leicht müsste es sein, auf den Abzug zu drücken, wenn man einen überzeugenden Grund hatte! Ich drehte mich um, der unbestimmte Mann war bereits weit weg.
In einer Bar trank ich einen Gin und fuhr dann mit dem Auto aus der Stadt: Ich wählte Straßen, die ich kannte, und Wege, die mir unbekannt waren. Weit genug entfernt von jeglichem Anzeichen einer Siedlung entdeckte ich unter einem Vollmond und umgeben von Zypressen ein erleuchtetes zweistöckiges Haus. Leise parkte ich das Auto zwischen den Bäumen.
Ich rannte geduckt über die Wiese. Mir kam es vor, als hätte ich das schon einmal erlebt, in einer früheren Reinkarnation oder im Kino. Schon war ich neben der Tür. Durch die Fenster konnte ich hineinschauen: In einem großen Wohnzimmer, die Wände hingen voller Bilder, sah ein Mann in den Vierzigern fern. Ob noch jemand in dem Haus war? Aus einer Holzkiste nahm der Mann eine Zigarre. Ich hörte Geräusche: Im oberen Stockwerk wurde das Licht ausgemacht, und nun erschien eine Frau in einem dicken Pelzmantel unter der Wohnzimmertür. Der Mann und die Frau küssten sich. Gesprächsfetzen drangen bis zu mir. Er sagte, sie möge nicht so spät zurückkommen. Sie versprach, gleich nach dem Kino zurückzukehren. Ich versteckte mich unter einer Treppe hinter ein paar Büschen, doch die Frau verließ das Haus nicht durch die Eingangstür, sondern fuhr in einem weißen Mercedes in einem Affenzahn direkt aus der Garage heraus.
Es wäre weniger glaubhaft, ihn mit der alten Ausrede des Autos und der Panne zu bitten, das Telefon benutzen zu dürfen, als die Situation derart zu dramatisieren, dass er, weil es ihn so direkt betraf, keine Sekunde zögern würde, die Tür zu öffnen. Ich wartete ein paar Minuten, in denen der Mann sich die Zigarre zurechtschnitt und sie mit Bedacht anzündete. Dann klingelte ich ungestüm:
– Machen Sie auf, Ihre Frau hatte einen Unfall!
Ich hörte nur die Stimme im Fernseher. (Jetzt vor der Tür konnte ich nicht sehen, was der Mann tat.) Dann hörte ich, wie er das Gerät abstellte; und Schritte, ich konnte nicht herausfinden, ob sie näher kamen oder sich entfernten. Ich griff nach dem Revolver, der noch in der Tasche war. Ich rief noch einmal:
– Machen Sie die Tür auf! Ein Unfall! Ihre Frau mit einem weißen Mercedes . . .!
Der Mann schob den Riegel zurück und öffnete langsam die Tür, fassungslos. Ich schien nicht bösartig auszusehen, denn als er mich sah, machte er die Tür ganz auf, er hatte endgültig Vertrauen gefasst:
– Meine Frau? Ich bin nicht verheiratet. Doch der weiße Mercedes . . .
Mein Fehler: Ich hatte falsche Schlüsse gezogen: Die Frau, die weggefahren war, war gar nicht seine Frau. Na und? Vielleicht war sie die Geliebte oder eine Freundin, die mir leidtat: Der Mann hatte nicht in Erwägung gezogen, dass es sich um sie handeln könnte, bis er die Worte weißer Mercedes hörte. Sei wie es sei, ich befand mich in dem Haus, und das Schweigen dauerte schon zu lang. Dies war ganz klar mein Mann. Ich zog den Revolver. Der Mann machte eine überraschte Geste. Ich sah mich gezwungen, ein paar Worte zu sagen, um die Situation klarzustellen:
– Ich bin gekommen, um Sie zu töten.
Der Mann war noch mehr überrascht: Ganz offensichtlich hatte er beim Anblick der Waffe an Raub gedacht. Mit einem dünnen Stimmchen fragte er mich, warum. Ich wollte nicht darauf hereinfallen: Wenn ich anfinge, ihm zu erklären, dass ich in Wirklichkeit gar kein Motiv hatte, ihn zu liquidieren, würde ich mir schnell überflüssig und lächerlich vorkommen. Der Mann fügte hinzu:
– Warten Sie einen Moment, ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen.
– Er zog seine goldene Armbanduhr ab und reichte sie mir zusammen mit seiner Brieftasche, die er in der rechten Hosentasche trug. – Oben habe ich Schmuck und noch mehr Geld. Wenn Sie wollen, können Sie auch diese Bilder mitnehmen. Sie können einen ganzen Haufen Geld mitnehmen. Aber verlieren Sie nicht den Kopf, behalten wir die Nerven.
Allmählich hatte er Angst bekommen. Er sträubte sich zu glauben, dass ich nicht da war, um ihn auszurauben: Er war nicht in der Lage, das zu verstehen. Ich dagegen fand es kränkend, dass er mich als einen kleinen Dieb betrachtete, den man mit Flitterkram kaufen konnte. Zitternd und stammelnd stand er vor mir und erschien mir derart als Feigling (und während ich die Kälte des Abzugs an meinem Finger spürte, dachte ich, an seiner Stelle würde ich mich genauso feige verhalten), dass ich ohne die geringsten Gewissensbisse zwei Schüsse auf ihn abfeuerte, die in der Nacht wie zwei Ohrfeigen klangen. Als er auf dem Boden lag, gab ich ihm mit einem dritten den Gnadenschuss. Die Zigarre begann eine Ecke des Teppichs anzusengen. Der Mann umklammerte fest die Brieftasche und die Uhr, die er mir vorher angeboten hatte. Ich bückte mich. Noch ehe ich verstand, was ich tat, nahm ich die Uhr und die Brieftasche. Oben sammelte ich den Schmuck und das Geld ein. Von den Bildern wählte ich fünf aus: einen Modigliani, zwei Bacon, einen Hopper und einen Llimós. Mit dem Taschentuch öffnete ich die Tür. Im Auto fragte ich mich, ob es das nächste Mal genauso einfach sein würde.