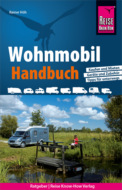Kitabı oku: «Reise Know-How Wohnmobil-Handbuch», sayfa 6
Gängige Sitzgruppen und ihre Vor- und Nachteile
Klassische Dinette
+ bis zu sechs Sitzplätze, kein Drehen der Fahrerhaussitze, kann zur Liegefläche umgebaut werden
- erfordert mehr Platz
Halbdinette
+ spart Platz, Tisch kann leicht ausgebaut werden
- nicht isoliertes Fahrerhaus, die Sitze sind teils mühsam zu drehen
Längssitzgruppe
Die Lösung mit zwei Bänken entlang den Fahrzeugwänden findet man vorwiegend in teilintegrierten Modellen.
+ großzügiges Raumgefühl, offene Atmosphäre
- erschwerter Durchgang zum Fahrerhaus
Hecksitzgruppe
+ wohnliche Atmosphäre, gute Abtrennung vom Fahrerhaus
- weniger geeignet für Beifahrer, wenig Heckstauraum
Betten
Wie man sich bettet, so liegt man. Während der eine mit einer Schaummatte auf dem umgeklappten Tisch zufrieden ist, legt der andere Wert auf ein komfortables Bett wie zu Hause. Das Wohnmobil kann alle Möglichkeiten bieten. Zu kurz oder zu schmal sollten die Liegeflächen aber keinesfalls sein. Da hilft nur Probeliegen!
Grundsätzlich muss man sich zunächst entscheiden, ob man das allabendliche Bettenbauen in Kauf nehmen will oder ein Festbett bevorzugt. Der Umbau einer Sitzgruppe (meist klassische Dinette) spart durch die doppelte Nutzung viel Platz und ist vor allem in kleinen Fahrzeugen unvermeidbar. Wo Betten abends aus Tisch und Bänken „gebaut“ werden müssen, ist dies mit Kindern und auf engstem Raum meist der stressigste Moment des Tages. Der Umbau sollte möglichst rasch und einfach durchführbar sein, die Polster müssen auch als Matratzen taugen und dürfen nicht auseinander rutschen (ggf. Antirutschmatten darunter legen).
Ist am Morgen die Tischplatte nass, so ist dies nicht auf ein Malheur zurückzuführen, sondern auf Kondenswasser. Hier können Noppenmatten als Abstandshalter helfen. Trotzdem ist es wichtig, die Polster anderntags gut zu lüften. Das gilt auch für Polster im Alkoven, falls nicht Lattenrost und Heizkanäle für eine gute Hinterlüftung sorgen. Nur Lattenrost, (Taschen-)Federkernmatratze und Kaltschaummatratze bieten Schlafkomfort wie zu Hause. In guten Wohnmobilen sind damit nicht nur fest installierte Heckbetten ausgestattet, sondern auch Alkoven- und Hubbetten.
Alkoven- und Etagenbetten müssen mit einer Absturzsicherung (Netz) ausgestattet sein, natürlich vor allem, wenn dort kleine Kinder schlafen.
Gängige Betteinbauten und ihre Vor- und Nachteile
Umbau
+ spart viel Platz
- zusätzlicher Aufwand
Querbett im Heck
+ große Liegefläche, gut vom Wohnraum abtrennbar, schafft Platz für eine Heckgarage darunter
- erfordert viel Platz, schwieriger Zugang für den, der hinten liegt
Längsbetten im Heck (Französisches Bett)
+ bequemer Zugang, gute Kombination mit dem Bad, spart Platz
- kein Platz für eine Heckgarage, schmales Doppelbett
Queensize-Bett
Ein Längsbett für zwei Personen, das von beiden Seiten zugänglich ist.
+ viel Komfort, da von beiden Seiten zugänglich, wohnliches Ambiente
- erfordert viel Platz, meist schmales Bett, wenig Platz für Heckgarage
Alkovenbett
+ kein Umbau, bei Kindern beliebte Wohnhöhle, große Liegefläche, am Tag Stauraum für Decken, Bettzeug, Klappmöbel etc.
- wenig Kopffreiheit, unbequemer Zugang, erhöhter Windwiderstand des Fahrzeugs
Hubbett
Diese Variante ersetzt in Integrierten das Alkovenbett. Sie findet sich auch in anderen Modellen.
+ bietet zusätzliche Schlafplätze auf wenig Raum
- wenig Kopffreiheit, unbequemer Zugang, schränkt evtl. Standhöhe ein
Bad und WC
Wie so oft im Wohnmobil gilt es auch hier, den passenden Kompromiss zwischen Platzangebot und Komfort zu finden. Von den kleinsten Kastenwagen und Pick-up-Kabinen abgesehen, werden heute praktisch alle Wohnmobile mit Waschraum, Dusche und WC geliefert. Sonst ist man überwiegend auf die Sanitäranlagen von Campingplätzen angewiesen, aber notfalls kann man sich auch am Spülbecken waschen und eine mobile Porta-Potti-Toilette benutzen, die im Schrank Platz findet. Tatsächlich wird z. B. die Dusche wegen des Wasserverbrauchs und des anschließenden Reinigungsaufwands von manchen Campern eher selten genutzt.
Die Nasszelle sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:
> Sie muss über eine gute Ventilation verfügen (am besten ein kleines Fenster),
> einen rundherum abschließenden Duschvorhang besitzen, um Handtücher etc. trocken zu halten,
> eine hochgezogene Plastikwanne als Boden haben, damit keine Nässe in den Wohnraum gelangt,
> im Boden zwei diagonal gegenüberliegende Abflüsse besitzen, damit das Wasser auch abläuft, wenn das Wohnmobil nicht ganz eben steht.
Für beengte Waschräume gibt es schwenkbare Waschbecken und Toilettensitze, um Raum zu sparen, und große Spiegel sorgen für ein üppigeres Raumgefühl. Achten Sie darauf, dass genügend Platz vorhanden ist, um sich komfortabel zu bewegen und die Waschutensilien aller Mitreisenden zu verstauen.
Gängige Nasszelleneinbauten und ihre Vor- und Nachteile
Nasszelle mit integrierter Dusche
Bei knappem Platz in kleinen Fahrzeugen muss die Dusche in den Waschraum integriert werden (d. h. der Fußboden ist zugleich Duschwanne) – und kann nur durch einen Vorhang oder eine Klappwand abgetrennt werden.
+ wenig Platzbedarf
- wenig Bewegungsfreiheit, Dusche nicht unabhängig von Waschbecken/Toilette
Separate Dusche
Die Dusche ist von Waschbecken/WC durch eine Tür abgetrennt und hat eine separate Duschwanne.
+ komfortables Duschen ohne Umbau und Trockenwischen, kann auch zum Aufhängen nasser Kleider dienen
- deutlich mehr Platzbedarf, teils sehr enger Duschraum
Raumbad
Hierbei handelt es sich um einen großzügigen Sanitärraum über die gesamte Aufbaubreite, der durch eine Tür mit Doppelfunktion variabel abgetrennt wird.
+ viel Komfort und Bewegungsfreiheit
- erfordert viel Platz, teils enger WC-Bereich
In den Schlafraum integriertes Bad
Bei dieser vor allem für Paare komfortablen Lösung ist der Sanitärbereich mit in den abtrennbaren Schlafraum integriert, wobei die Dusche sich meist an der einen Außenwand befindet und Waschbecken/WC an der anderen.
+ viel Bewegungsfreiheit und Privatsphäre, Dusche und WC sind separat
- hoher Platzbedarf
Variables Bad
Die Dusche wird dadurch zugänglich, dass eine ganze Wand zur Seite und über die Toilette geschwenkt wird.
+ platzsparend, wenig Umbauaufwand, viel Bewegungsfreiheit
- Dusche nicht unabhängig von Waschbecken/Toilette
Dusche
Als Dusche dient meist der Hahn des Waschbeckens, der einen Brausekopf und einen Verlängerungsschlauch besitzt, sodass man ihn ausziehen und an der Wand befestigen kann. Größere Wohnmobile besitzen eine separate Dusche, die durch eine Falt- oder Schiebtür abgetrennt wird. Ein 10-l-Gasboiler mit Thermostat (möglichst nahe der Dusche für kurze Leitungswege) sorgt rasch für warmes Wasser. Allerdings werden bei den üblichen 80 bis 100-l-Wassertanks selbst in einem Zwei-Personen-Haushalt nur sparsame Duschen möglich sein, wenn man nicht jeden Tag Wasser nachfüllen will.
Besonders beim Strandurlaub angenehm ist eine Außendusche, die aber im Winter Probleme machen kann. Hat der Waschraum ein Fenster, so kann man den Duschkopf einfach nach draußen reichen, dann hat man ebenfalls eine Außendusche und der Waschraum bleibt sauber und trocken.
Im Zubehörhandel bekommt man unter dem Namen „Solardusche“ recht preisgünstig einen schwarzen 20-l-Wassersack mit einem Brausekopf an einem kurzen Schlauch mit Klemmverschluss. Legt man den Sack tagsüber in die Sonne, so kann man ihn nach einigen Stunden an eine Stange oder an die Markise hängen und darunter eine warme Dusche nehmen. Das spart Wasser aus dem Bordtank, viel Energie für das Aufheizen des Wassers und zudem eine Putzaktion im Duschraum.
Teurer, dafür aber deutlich stabiler und komfortabler zu bedienen sind Wassersäcke und Duschschläuche aus Lagerbeständen der Schweizer Armee (www.wasserziege.ch/wassersäcke-co/wassersäcke).

Eckspiegel lassen das Bad viel geräumiger wirken (044wh kn)
Toilette
Das WC im Wohnmobil ist in den meisten Fällen eine Kassetten-Toilette mit fest installiertem Sitz, Wasserspülung und einer von außen herausziehbaren Fäkalien-Kassette. Seit einiger Zeit werden fast nur noch auf halbe Länge verkürzte Mini-Kassetten eingebaut, die zwar leichter sind, aber mit Familie tägliches Entleeren erforderlich machen. Um etwas länger autark zu sein, kann man eine zweite Kassette kaufen und in einer entsprechenden Halterung eines Außenstauraums transportieren. Billiger ist ein mobiler Entsorgungstank oder ein schlichter Weithalskanister. Doch Achtung: Der Überdruck, der durch Faulgase entsteht, muss entweichen können, sonst kann der Kanister explodieren!
Für die Spülung wird meist das Wasser aus dem Haupttank verwendet. Es gibt aber auch Toiletten mit separatem Wassertank und eigener Pumpe, für die man ungereinigtes Wasser verwenden bzw. auch etwas Flüssigreiniger beifügen kann. Wenn man Chemikalien für die Toilette verwendet, so sollte man umweltschonende Mittel wählen und diese nicht überdosieren. Doch mit den heute üblichen Entlüftungssystemen (z. B. von SOG, s. Anhang) kann man auf Chemikalien ganz verzichten, ohne unter üblen Gerüchen zu leiden. Sie erzeugen während der Toilettenbenutzung durch kleine Lüfter einen Unterdruck, sodass keine Gerüche in den Wohnraum entweichen können. Die Luft wird dabei durch einen Kohlefilter nach außen abgeleitet, um Geruchsbelästigung auch außerhalb des Fahrzeugs zu vermeiden. Ein hervorragendes Beispiel ist die SOG-Kompaktanlage, die im Reisemobil (bzw. Caravan) sehr flexibel platziert werden kann. Das Gehäuse besteht aus dem Ventilator und einer wechselbaren Filtereinheit. Diese Anlage überzeugt durch eine sehr gute Filterung der abgeführten Gase und einen kaum hörbaren Ventilator. Zudem kann sie unabhängig von der Toiletten-Kassette platziert werden und die durch den Filter praktisch geruchsneutralen Gase lassen sich durch den Fahrzeugboden ableiten. Eine sehr zu empfehlende Lösung.
Die Nachteile einer Kassetten-Toilette sind allerdings jedem klar, der sie auch nur ein paar Tage lang benutzt hat: Die Kassette ist ruckzuck voll (meist alle zwei Tage) und das Entleeren ist alles andere als ein Vergnügen. Die Lösung: die ganze Sauerei einfach mithilfe einer Verbrennungstoilette verbrennen. Bei Temperaturen um 500° C bleibt von Urin und Exkrementen nur ein kleines Häufchen Asche – nach Herstellerangaben bei einwöchiger Benutzung durch vier Personen etwa eine Tasse voll, die dann problemlos im Müll zu entsorgen ist.
Das ist natürlich famos, aber die Nachteile sind auch nicht zu übersehen: Für einen Verbrennungsvorgang sind etwa 110 g Gas erforderlich, was bedeutet, dass eine 5-kg-Flasche nach 45 Toilettengängen leer ist. Geht man z. B. über den Tag verteilt fünfmal auf die Toilette, verbraucht man mit zwei Personen schon 1,1 kg. Eine 11-kg-Gasflasche wäre allein für die Toilette nach 10 Tagen verbraucht. Außerdem sind für die Verbrennung eine zuverlässige 12-V-Stromversorgung (ca. 1,3 A pro Verbrennung, minimaler Verbrauch im Stand-by-Modus) sowie die Original-Papiertaschen des Herstellers zu knapp 10 Cent pro Stück nötig.
Die Verbrennung dauert etwa eine Stunde und funktioniert auch während der Fahrt. Allerdings sollte man nach dem Toilettengang wenigstens 10 Minuten mit der Weiterfahrt abwarten, bis eine Temperatur von 200° C erreicht ist. Beim Einbau ist auf richtige Luftzufuhr und Abgasführung über das Fahrzeugdach zu achten, um die Geruchsbelästigung während der Verbrennung auszuschließen oder zu minimieren. Außerdem ist der Entlüfter nicht ganz geräuschlos. Zu Funktionsstörungen kann es in heißen Regionen und in hohen Gebirgslagen kommen. Und dann ist da noch der Preis: rund 4000 €.
Eine einfache Trockentoilette erspart zumindest die für jede Spülung erforderliche Wassermenge, die nicht unerheblich dazu beiträgt, dass die Kassette stets so schnell voll ist. Besser ist jedoch eine Trenntoilette, in der Festes von Flüssigem getrennt wird. Der Urin läuft dabei in einen Behälter, den man problemlos in die Kanalisation entleeren kann. Denkbar wäre auch ein Anschluss an den Grauwassertank. Frischer Urin ist übrigens keimfrei und riecht kaum. Gerüche entstehen erst nach einigen Tagen oder Wochen durch die Zersetzung. Die Exkremente werden mit saugfähigem Material überstreut (z. B. Sägemehl, Rindenmulch, Katzenstreu), um Geruchsentwicklung zu verhindern. Durch die Trennung wird die Geruchsbildung zusätzlich verringert. Zudem ist durch die Trennung erheblich weniger Streumaterial erforderlich, was den Vorteil hat, dass der Behälter seltener entleert werden muss. Es kann auf chemische Zusätze komplett verzichtet werden und man braucht keinen Wasseranschluss. Der Urinbehälter muss alle paar Tage entleert werden, der Behälter für Exkremente meist erst nach Wochen! Die dicht verschlossenen Beutel können dann in den Müll gegeben werden oder (biologisch abbaubare Beutel) auch in den Kompost – nicht aber in die Bio-Tonne! Einfache Trockentoiletten gibt es schon für 50 €, für eine Trenntoilette sind 500 bis 1000 € anzusetzen. Man kann beide aber auch problemlos selbst bauen.
Für Fahrzeuge ohne eigene Nasszelle gibt es tragbare Toiletten („Porta-Potti“) mit Wasser- und abtrennbarem Fäkaltank. Einige Reisemobile besitzen Toiletten mit großen, fest eingebauten Fäkaltanks, die über einen Schlauch direkt entleert werden können. Das hat den Vorteil, dass die Tanks um ein Vielfaches größer sind und für mehrere Wochen reichen. Doch wo entsprechende Entsorgungsstationen fehlen, braucht man dann einen zusätzlichen Transportcontainer auf Rollen (z. B. Sani-Tank), um den Inhalt zur Entsorgungsstelle zu bringen.
Für WC-Komfort wie zu Hause gibt es Zerhackertoiletten, in denen ein Häckselwerk das Toilettenpapier und die Fäkalien so fein zerkleinert, dass der Inhalt auch durch einen Schlauch gut zu entleeren ist. Diese Lösung bietet sich daher besonders in Kombination mit einem größeren, fest eingebauten Fäkaltank an. Allerdings hat der Komfort auch seinen Preis: Eine solche Toilette kostet etwa 1000 €, wiegt ca. 30 kg und braucht relativ viel Wasser.
Tipps zur Toilettenbenutzung
Auch wenn man sonst ungern über dieses Thema redet, hier sollten wir es tun, und falls Sie Gäste im rollenden Zuhause haben, sollten Sie diese diskret informieren, um ihnen Peinlichkeiten zu ersparen: Die Toilette sollte nur mit geöffnetem Schieber benutzt werden, insbesondere für das „große Geschäft“, sonst hat man nachher beträchtliche Probleme, den Haufen dazu zu bewegen, dass er gnädigst in der sehr kleinen Öffnung verschwindet. Bei geöffnetem Schieber und etwas Zielübung bleiben allenfalls kleine Spuren, die man mit Wasser und einer WC-Bürste beseitigen kann. Hierzu ist es dann wieder besser, den Schieber kurz zu schließen, damit das Wasser in der Schüssel steht. Wer weniger Zielübung hat, kann den kritischen Bereich der Schüssel vorbeugend mit einigen Blättchen Klopapier auslegen. Machen Sie es sich außerdem zur festen Gewohnheit, den Schieber der Toilette nur zu öffnen, wenn der Deckel geschlossen ist. Bei Kassetten ohne Entlüftung kann sich durch Faulgase, Wetterveränderung oder Bergauffahrt ein Überdruck aufbauen. Und beim Öffnen des Schiebers riskiert man dann höchst unappetitliche „Sommersprossen“!
Installationen
Ein komplexes System vielfältiger Installationen (Wasser-, Strom- und Gasnetze zur Versorgung von Heizung, Boiler, Klimaanlage, Wasserpumpe, Dusche, Herd, TV, Beleuchtung, Ventilation, Kühlung u. v. m.) macht aus dem Wohnaufbau eine wirkliche Wohnung. Die Zeiten, in denen man sich mit einer Matratze, einer Gaslaterne, einem Spirituskocher und einem Wasserkanister zufrieden gab, sind lang vorbei. Heutige Wohnmobile bieten einen Komfort, der dem zu Hause in nichts nachsteht.
Diese komplexen Systeme der Strom-, Gas- und Wasserversorgung führen ein verborgenes Dasein und bleiben meist unbemerkt, solange alles störungsfrei funktioniert. Doch auch wenn man nicht gleich zum Selbstausbauer werden will, ist es gut, eine ungefähre Vorstellung von diesen Anlagen und ihrer Funktion zu besitzen, um im Falle einer Störung die Ursache feststellen und ggf. sogar selbst beheben zu können.
Elektrische Anlage
Ohne elektrischen Strom geht in modernen Wohnmobilen gar nichts. Man braucht ihn z. B. für die Beleuchtung, die Wasserpumpe, das Umluftgebläse, die Zündung des Gasboilers und der Heizung etc. Wohnmobile besitzen meist zwei getrennte Stromsysteme: ein 12-Volt-Gleichstrom-Netz für unterwegs und um beim Freistehen autark zu sein, sowie ein 230-Volt-Wechselstrom-Netz, an das man auf dem Campingplatz angeschlossen ist.
Da nicht nur der Wohnbereich, sondern auch das Basisfahrzeug Strom benötigt, ist das 12-Volt-Netz in zwei Bereiche unterteilt, die beim Abstellen des Motors durch ein Relais automatisch getrennt werden.
Wesentliche Teile der Anlage (Lichtmaschine, Ladegerät und Batterien) müssen sehr unterschiedliche Anforderungen erfüllen, je nachdem, wie das Reisemobil genutzt wird:
> Wer überwiegend auf Campingplätzen steht, braucht nur geringe 12-V-Reserven und daher nur eine einfache elektrische Ausstattung.
> Wer überwiegend frei steht, braucht 12-V-Reserven für mehrere Tage und daher eine stärkere und aufwendigere elektrische Ausstattung oder einen geeigneten Stromerzeuger (beispielsweise Solaranlage).
Die einzelnen Komponenten müssen aufeinander abgestimmt sein. Es reicht z. B. nicht, eine stärkere Zweitbatterie einzubauen, wenn diese wegen einer zu schwachen Lichtmaschine nie voll aufgeladen wird. Sehr gute und hilfreiche Tipps zum Thema „Strom im Wohnmobil“ (und mehr) bietet Andre auf seiner Website www.amumot.de/ratgeber.
AC/DC
Die Buchstaben AC/DC sind manchem eher als Name einer legendären Rockband bekannt. Sie stehen aber ursprünglich als Abkürzungen für Wechselstrom (AC = Alternating Current, meist 230 V, und für Gleichstrom, DC = Direct Current, meist 12 V).
Lichtmaschine (Generator)
Der Stromerzeuger, der den 12-V-Gleichstrom für Fahr- und Wohnbereich liefert, ist die Lichtmaschine: Ein Generator, der durch den Motor angetrieben wird und bei wachsendem Stromverbrauch auch zunehmend Motorkraft (= Treibstoff; je 100 W etwa 0,1 l/100 km) benötigt. Da während der Fahrt auch Strom verbraucht wird (Licht, Radio, Scheibenwischer und vieles mehr), kann nur der Überschuss als Reserve gespeichert werden. Um den an einem Abend verbrauchten Strom zu ersetzen, muss man je nach Lichtmaschine etwa 4–8 Stunden fahren.
Batterien
Damit auch im Stillstand, d. h., wenn die Lichtmaschine nicht arbeitet, Gleichstrom zur Verfügung steht, muss er in einem Akku (auch „Batterie“ genannt) gespeichert werden. Wohnmobile haben generell mindestens zwei unabhängige Batterien für Basisfahrzeug und Wohnbereich: die Fahrzeug- oder Starterbatterie und die Versorgungs-, Bord- oder Zweitbatterie. Dies gewährleistet, dass der Motor auch dann noch gestartet werden kann, wenn nach einem langen Abend die Stromkapazität des Wohnteils erschöpft ist. Zum Aufladen (also bei laufendem Motor) müssen beide Batterien verbunden sein. Sobald der Motor steht, müssen sie getrennt sein, damit sie nicht gemeinsam entladen werden. Damit das nicht vergessen werden kann, erledigt das Trennrelais dies automatisch. Auch der Kühlschrank, der während der Fahrt mit 12 Volt betrieben werden kann, wird bei Abstellen des Motors durch ein Relais automatisch vom 12-V-Netz getrennt, da er ein starker Verbraucher ist und die Bordbatterie rasch leer saugen würde. Achtung: Beim Umschalten auf Gasbetrieb sollte man den 12-V-Schalter trotzdem auf „Aus“ stellen, sonst konkurrieren beim späteren Starten des Motors beide Systeme und setzen sich gegenseitig matt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.