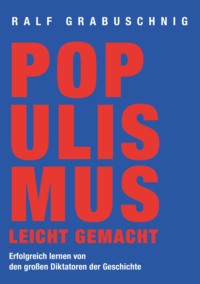Kitabı oku: «Populismus leicht gemacht», sayfa 2
Die Methode Tito: Wann Ihr Leben beginnt, bestimmen immer noch Sie!
Nun haben wir zwei Tricks der ganz Großen kennengelernt, mit welchen Sie Ihre Biografie so richtig schön auf Vordermann bringen können. Lassen Sie einfach jene Teile Ihres Lebenslaufs weg, die nicht zu Ihrer Geschichte passen, und vernichten Sie jeden Beweis von Weggefährten und Ereignissen, an die Sie nicht erinnert werden wollen. Die beiden brutalsten europäischen Diktatoren des 20. Jahrhunderts kamen schließlich nicht ohne Grund an ihre Position! Aber es gibt auch einen Mittelweg, und wie so oft im weiteren Verlauf dieses Buchs manifestiert sich dieser am deutlichsten an Josip Broz Tito, dem jahrzehntelangen Herrscher über das kommunistische Jugoslawien. Dabei zeichnet sich Marschall Tito im Unterschied zu seinen meisten autokratischen Zeitgenossen generell durch seine Vorsicht aus. Und noch heute wird im ehemaligen Jugoslawien diese kalkulierte Besonnenheit mit Güte verwechselt, was Tito nach wie vor Sympathien einbringt. Diese Charaktereigenschaft war auch der Grund, warum dieser Mann überhaupt erst zur starken Hand auf dem Balkan werden, sich aus dem Orbit der Sowjetunion befreien und zum weltweit angesehenen Staatsmann avancieren konnte. Wohl auch nicht ohne Grund zerfiel sein Reich wenige Jahre nach seinem Tod wieder … Aber lassen Sie sich davon mal nicht die Laune verderben. Tito musste den Zerfall seines eigenen Staates schließlich nicht mehr miterleben. Er starb auf dem Zenit seiner Macht eines natürlichen Todes. Solange Sie das auch schaffen, ist doch alles in Butter. Widmen wir uns also wieder den schönen Dingen im Leben! Tito war nun zwar vielleicht nicht ganz so gütig, wie einige seiner ehemaligen Untertanen das heute noch gerne sehen. Er war aber doch zumindest ein ungewöhnlicher Diktator. Er schuf in Jugoslawien eine verhältnismäßig sanfte Diktatur, die er vor allem mithilfe seines Personenkultes und der Propaganda beherrschte. Damit ist er auch ein phänomenales Vorbild, wenn es um den kreativen Umgang mit der Biografie geht.
Die Umgestaltung der Herkunftsgeschichte beginnt bei Tito schon mit der eigenen Kindheit – das kennen wir ja bereits von Adolf Hitler. Aber Tito toppt den „Führer“ hier. Nicht einmal sein Geburtsjahr ist mit Sicherheit geklärt. Und als würde das noch nicht genügen, kursieren nicht etwa zwei oder drei unterschiedliche Daten, sondern gleich zehn! Nach allem, was man weiß, dürfte der Mann in den frühen 1890ern geboren worden sein, wahrscheinlich irgendwann im Mai. Dass ganz Jugoslawien irgendwann den 25. Mai als seinen Geburtstag beging, ist keine Garantie für die Korrektheit dieses Datums, sehr wahrscheinlich ist es nicht der tatsächliche Tag seiner Geburt. Aber was soll der ganze Trubel, letzten Endes ist es doch völlig egal. Das Kernelement von Titos biografischer Elastizität ist ohnehin ein komplett anderes. Er hat seine Biografie in späteren Jahren nämlich auf de facto vier Jahre reduziert: die Zeit des Partisanenkrieges gegen die deutschen und italienischen Besatzer Jugoslawiens. Zu diesem Zeitpunkt war Tito zwar schon ungefähr (wie gesagt, so sicher können wir uns da nicht sein) fünfzig Jahre alt – über die Zeit davor wurde während seiner Herrschaft aber kaum gesprochen. Wozu auch? Was wirklich zählt im Leben dieses großen Marschalls, fand doch in jenen vier Jahren statt! Tito hatte erkannt: Alle anderen Details um sein früheres Leben würden die Menschen nur von der eigentlichen Geschichte ablenken. Die Zeit als orientierungsloser Jugendlicher, als Soldat der österreichisch-ungarischen Armee im Ersten Weltkrieg, als kommunistischer Zögling in Russland, als Lehrling Stalins … das wollte doch niemand hören! Hören wollten die Menschen von der Legende Tito. Der Marschall, der sich mit seinen treuen Partisanen in den Wäldern und Bergen verschanzte, den Besatzern den Guerillakrieg erklärte und den dann auch noch gewann! Tito setzte als Präsident also alles daran, genau diesen Teil seines Lebens immer wieder hervorzuheben. Das war für ihn auch nicht sonderlich schwierig. Immerhin entstand der Staat Jugoslawien, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1991 existierte, doch aus genau jenem Partisanenkampf. Im Gegensatz zu Hitler und Stalin stand Tito mit seiner Methode vor einer viel leichter zu bewältigenden Aufgabe. Er musste nicht ganze Abschnitte seines Lebens, die Kindheit und Jugendzeit sowie alle anderen unpassenden Augenblicke vertuschen. Genauso wenig musste er krankhaft seine Photoshop-Skills aufbessern und der Bevölkerung ständig neue Versionen alter Propagandabilder vorführen. Tito musste einfach nur immer dieselbe Geschichte erzählen und dafür sorgen, dass sie im Volk hängen blieb. Das war ihm schon während des Kriegs bewusst. So hat sein langjähriger Gefährte Aleksandar Ranković später erzählt, dass Tito immer darauf geachtet hatte, mit ja nichts in Verbindung gebracht zu werden, was später kompromittierend wirken könnte. Er hat nie ein Todesurteil oder den Befehl zur Niederbrennung eines Dorfes unterschrieben. Das heißt aber freilich nicht, dass das nicht geschehen wäre oder er es nicht mündlich angeordnet hätte.
Sein Regime nutzte über die nächsten Jahrzehnte zahlreiche Mittel, um ständig über diese Zeit des Kriegs und Titos Rolle als Partisanenführer zu sprechen und die Erinnerung daran frischzuhalten. Eine davon prägte die Menschen besonders und genießt bis heute ungebrochene Berühmtheit: die jugoslawischen Partisanenfilme. Der Film war Titos Lieblingsmedium. In seinen Residenzen unterhielt er Privatkinos und hatte einen eigenen Angestellten, der die Filme für ihn einlegte und ihn im Kinosaal betreute. Kein Wunder, dass das Medium bald auch für Propagandazwecke Verwendung fand. Und noch viel weniger ist es ein Wunder zu nennen, dass der Partisanenwiderstand zum beliebtesten Thema dieser Filme wurde. Einige der über hundert Produktionen stechen als besonders eindrucksvoll hervor. Das liegt vor allem daran, dass Tito es sich durchaus wert war, für die Filme ausländische Stars zu casten. Kaum etwas war zu teuer, und irgendwie ermöglichte Tito die Finanzierung jedes Mal. Ein Paradebeispiel ist der Film „Sutjeska“ über die Schlacht desselben Namens im Jahr 1943. In der Hauptrolle war kein Geringerer zu sehen als Richard Burton! Ganz ähnlich im Film „Bitka na Neretvi“, Schlacht an der Neretva, der – Sie haben es wahrscheinlich erraten – der Story von „Sutjeska“ einigermaßen ähnlich ist. Aber gut, das zeichnet diese Filme generell aus: Sie fühlen sich alle irgendwie gleich an, was seinen ganz eigenen Propagandawert hatte. Für „Bitka na Neretvi“ wurde unter anderem Orson Welles verpflichtet, und der Film wurde 1970 sogar für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert. Den Erfolg kann man der titoistischen Propagandamaschine also nicht absprechen. Die Dreharbeiten für den Film, die eineinhalb Jahre in Anspruch nahmen und gerüchteweise bis zu zwölf Millionen Dollar verschluckten, wurden von Tito persönlich genehmigt. Er stellte bei der Gelegenheit auch gleich 10 000 Soldaten der jugoslawischen Armee ab, um dem Ganzen einen realistischen Touch zu verleihen. Die absurdeste Entscheidung war aber, dass er es erlaubte, eine voll funktionsfähige Eisenbahnbrücke zu sprengen, anstatt für die Dreharbeiten eine Replik zu bauen. Es sieht halt viel realistischer aus, wenn es echt ist! Und wenn der Diktator sagt, man soll die Brücke für den Film sprengen, dann macht man das auch. Dumm nur, dass die Aufnahmen der Sprengung wegen der entstandenen Rauchwolke letzten Endes unbrauchbar waren, weshalb man sie in einem Studio nachstellen musste. Die Überreste der Brücke – allerdings wohl einer Replik – kann man in Bosnien bis heute bewundern. Ob irgendjemand der Besucher dort auf die Idee kommt, dass Tito vielleicht doch ein exzentrischer Alleinherrscher gewesen sein könnte? Herzallerliebst, wenn Sie das jetzt glauben …
Diese Filme besaßen für Tito einen enormen Wert, der weit über seine persönliche Liebe zum Medium hinausging und die Kosten in seinen Augen auch rechtfertigte. Die Filme erinnerten sein Volk immer und immer wieder an den alten Partisanenkampf, den bei weitem wichtigsten Teil von Titos Biografie. Als Herrscher wollte er immer und überall mit genau dieser Zeit seines Lebens in Verbindung gebracht werden, denn dieser Moment der „Volksbefreiung“ bildete die Grundlage seiner Herrschaft, seines Personenkultes und seines Staates. Hollywood-Stars nach Jugoslawien zu holen, passte außerdem wunderbar ins Bild des luxusverwöhnten Marschalls. Geld war kein Problem für den alten Genossen. Man lebte ja ohnehin auf Pump – wie wir im Verlauf dieses Buches noch sehen werden.
Wie bringen wir Ihre Biografie auf Vordermann?
Hitler, Stalin und Tito – drei Namen, die für unterschiedliche Methoden stehen, mit deren Hilfe es Diktatoren in der Vergangenheit gelang, ihre Biografien aufzubessern. Man weiß: Jeder Diktator ist anders. Und das gilt auch für aufstrebende Miniautokraten, wie Sie einer sind. Und doch trifft eines auf jeden zu: Die Biografie ist wichtig! Überlassen Sie es also auf keinen Fall einem anderem, zu beschreiben, wer Sie sind und wofür Sie stehen. Das sollten Sie schon selbst in die Hand nehmen. Welche Methode für Sie persönlich zielführend ist, können Sie problemlos herausfinden. Gibt es Teile Ihrer Biografie, die Sie lieber verheimlichen würden? Dann wählen sie die Methode Hitler und streichen diese überflüssigen Details aus Ihrem Leben. Einige Ihrer derzeitigen Kollegen zeichnen das bereits erfolgreich vor: Viktor Orbán und sein Soros-Stipendium, Aleksandar Vučić und seine Rolle im Milošević-Regime, Heinz-Christian Strache und seine Jugendbekanntschaften … Und seien wir doch ehrlich: Wer von uns hat denn keine Leichen im Keller, die es zu verbergen gilt? Sollte das bei Ihnen nicht der Fall sein, dann sind Sie vielleicht doch kein Diktatorenmaterial. Legen Sie Wert auf das Verschwinden von Zeitgenossen, kann Ihnen eine Prise Stalinismus nicht schaden. Kein Diktator der Welt weist gerne auf die Gehilfen hin, die ihn an seinen Platz gebracht haben. Ein paar Photoshop-Tricks hier, ein paar Erschießungskommandos da, und schwups: Schon sind die unliebsamen Steigbügelhalter verschwunden. Wie immer führen viele Wege nach Rom (oder nach Pjöngjang, wenn Sie wollen). Jeder Diktator ist anders, jede Biografie ist anders und verlangt nach einer anderen Behandlung. Welche ist die Ihre?
Basteln Sie ein Feindbild
Ich muss Ihnen an dieser Stelle des Buches bereits eine unangenehme Wahrheit näherbringen: Ihr Volk wünscht sich in Wirklichkeit gar keinen Diktator. Ich weiß schon, was Sie jetzt sagen werden: „Das mag vielleicht im Allgemeinen stimmen, aber bei mir ist das anders!“ Immerhin sind Sie doch der beste Politiker, den Ihr Land je gesehen hat, und das Volk kann sich nur glücklich schätzen, Sie zu haben. Das mögen Sie als Resultat von Jahren feuchter Träume glauben, doch diesen Zahn muss ich Ihnen leider ziehen. Wenn es anders geht, wünscht sich die Menschheit üblicherweise keinen starken Herrscher, der von oben herab über ihr Leben entscheidet. Schon allein um die Menschheit von diesem Irrtum zu erlösen, gilt es, an die Macht zu kommen und dort zu bleiben. Hierfür bedienen sich Diktatoren seit jeher einer ebenso schlichten wie effektiven Methode. Anstatt sich selbst als die objektiv beste Wahl zu positionieren und um die Menschen zu werben, präsentieren sie sich als eine konkrete Lösung. Lösung wofür? Der Diktator ist die Lösung für ein ganz bestimmtes Problem, das übrigens rein gar nichts mit seinen Fähigkeiten zu tun hat. Wenn dieses Problem nämlich groß genug ist (oder die Menschen in Ihrem Land das glauben), müssen Sie über kein besonderes Know-how verfügen. Sie müssen nur die Lösung darstellen! Aber von welchen Problemen sprechen wir denn hier? Von Feinden natürlich! Der zukünftige Diktator muss das letzte Bollwerk gegen einen gemeinsamen Feind sein, einen Feind, der die Gesellschaft und den Staat in seiner Gesamtheit bedroht. Das und nur das erlaubt ihm seine Stellung als Alleinherrscher. Aber woher soll dieser Feind denn kommen? Das beste Problem ist immer das, das man selbst schafft. Denn dann fällt die Lösung meist nicht schwer. Schauen Sie sich nur um in der Welt. Kim Jong-un beschützt wie schon sein Vater und Großvater das nordkoreanische Volk vor den Imperialisten im Süden und in Amerika, nachdem sie selbst den Koreakrieg vom Zaun gebrochen hatten. Wladimir Putin schützt das russische Volk seit Jahrzehnten vor dem ausbeuterischen Westen und dessen moralischen Verfall, nachdem er selbst dem Land jegliche Hoffnung auf Reform genommen hatte. Donald Trump schützt das amerikanische Volk vor … oh, Moment! Ich entschuldige mich. Jetzt hätte ich Präsident Trump fast in eine Reihe mit solchen autokratischen Herrschaften gestellt.
Der Schlüsselbegriff für uns ist also das Feindbild. Wenn Sie zum alleinigen Machthaber Ihres Landes aufsteigen wollen, brauchen Sie ein solches, denn ohne Bedrohungsszenario, ganz ohne eine böse äußere Gruppe, vor der es die Nation zu schützen gilt, ist Ihre Machtübernahme vor dem Volk nur schwer zu rechtfertigen. Aber Sie haben Glück! Feindbilder haben doch gerade in diesen Jahren wieder Hochkonjunktur. Die Flüchtlinge, der Islam, der „Deep State“ … es gibt so viele reale und fiktive Feinde, die man als aufmerksamkeitssüchtiger Jungautokrat bekämpfen kann. Das Buffet ist eröffnet! Die Menschen lieben eben ihre Feindbilder, und seit jeher teilten alle sozialen Gruppen solche Vorstellungen. Immerhin bieten gemeinsame Feinde eine Grundlage für Rudelbildung, und nicht erst seit gestern nutzen aufstiegshungrige „Politiker“, wie Sie sich wohl gerne auch sehen, diese Neigung. Egal, wohin man in der Geschichte blickt, so gut wie jeder große Herrscher baute seine Macht zuallererst auf ein wohlgenährtes Feindbild auf. Die ganz Großen unter diesen Politikern verließen sich dabei aber nicht auf das Glück. Sie gingen ganz aktiv daran, solche Feindbilder zu erfinden, zu schüren und damit immer weiter aufzublasen, bis der Ruf im Volk nach einer „Lösung“ nicht mehr zu überhören war. Dreimal dürfen Sie raten, wer diese Lösung dann parat hatte.
Den Roten kann man nicht über den Weg trauen
Nun habe ich gerade gesagt, dass es in so gut wie allen menschlichen Gesellschaften schon immer Feindbilder gegeben hat und ebenso machthungrige Menschen, die diese für sich ausgenutzt haben. Allerdings gibt es doch Zeiten in der Geschichte, zu denen diese ewige Wahrheit wahrer ist und stärker zutrifft als zu anderen. Zeiten des politischen Umbruchs und der Unsicherheit sind nämlich die beste Voraussetzung für Feindbilder und ihre politische Verwertung. Wenn wir uns das letzte Jahrhundert anschauen, gibt es da ein ganz besonderes Datum, das jedem Autokratie-Fan bekannt sein sollte: der Jahreswechsel von 1918 auf 1919. Da herrschten in Europa noch so richtig wilde Zeiten! Anfang November 1918 endete der Erste Weltkrieg, und mit ihm kam unter anderem das Ende des Deutschen und des Habsburgerreiches. In Mittel- und Osteuropa entstanden neue Staaten wie Jugoslawien, die Tschechoslowakei, Ungarn und Polen, während sich in schon zuvor existierenden Staaten wie Rumänien massiv die Grenzen verschoben. Bereits ein Jahr vor Ende des Krieges war außerdem die Oktoberrevolution über Russland hinweggefegt, und damit war das politische Chaos in weiten Teilen des Kontinents perfekt. Heute lässt es sich manchmal viel zu leicht über diese Umbrüche reden, ohne den mit ihnen verbundenen Einschnitt für die Menschen der Zeit wirklich zu begreifen. Die Etablierung dieser neuen Nationalstaaten und die damit verbundene Unsicherheit brachten gigantische Zäsuren im Alltagsleben mit sich, die die Menschen noch über Jahre hinweg prägten. Teils komplett neue Politiker, die zuvor keine Rolle gespielt hatten, neue Grenzen – zuweilen mitten durch existierende Lebensräume … Auch muss ich wohl nicht betonen, dass diese Verschiebungen für die wirtschaftliche Entwicklung direkt nach dem Krieg nicht gerade zuträglich waren. Für die Erholung nach einem Krieg ist es nicht die beste Idee, etablierte Handelswege und Wirtschaftsräume zu durchschneiden und alles auf null zu stellen. Aber gut, darum ging es den politischen Führern der Zeit ja nicht. Diese außen- und innenpolitische Unsicherheit und wirtschaftliche Misere spiegelten sich somit bald im innenpolitischen Leben vieler Staaten Europas wider. Radikale Zeiten verlangen eben nach radikalen Antworten, und so griffen über den Kontinent hinweg politische Extrempositionen um sich.
Besonders erfolgreich erschien in den ersten Monaten nach dem Krieg zunächst eine bestimmte Extremposition: die des Kommunismus. Auch das kann man sich gegenwärtig nur schwer vorstellen. Heute wirkt – zumindest in Europa – die Oktoberrevolution eher wie ein isolierter Einzelfall, der nur durch sowjetische Gewalt und durch den nächsten Weltkrieg in die Länder Mittel- und Osteuropas getragen werden konnte. Von der von Lenin versprochenen „Weltrevolution“ kann im historischen Rückblick keine Rede sein. Im Winter 1918 sah das allerdings noch ganz anders aus. Die Oktoberrevolution lag erst ein Jahr zurück, und plötzlich gab es vielerorts in Europa linke Gruppierungen, die eine ganz ähnliche Revolution wie in Petersburg anstrebten. Eine Zuspitzung schien unausweichlich. In Deutschland geschah das schon sehr früh in der Novemberrevolution, die 1918 zumindest in Teilen des Landes Arbeiter- und Soldatenräte nach sowjetischem Vorbild hervorbrachte. Einen Höhepunkt erreichte die Entwicklung im Frühling 1919 mit der Münchner Räterepublik und ihrer gewaltsamen Niederschlagung durch regimetreue und rechtsradikale Verbände, die freilich genauso wenig demokratiebegeistert waren wie die Anhänger der Räterepublik. Nach der Oktoberrevolution und einer ganz ähnlichen Revolution in Ungarn war der in München nun schon der dritte dieser bolschewistischen Aufstände. Sorge vonseiten der rechtsautoritären Kräfte war also durchaus angebracht!
Ein besonders lehrreiches Beispiel kann uns die Niederschlagung der erwähnten ungarischen Räterepublik bieten. Immerhin kam als Folge dieser kurzlebigen Revolution ein ausgesprochen ehrenwerter Kollege von Ihnen in Budapest an die Macht. Ein Mann, der Ihnen als Mentor so einiges über autoritäre Politik beibringen kann. Der roten Republik in Ungarn wäre aber wohl auch ohne ihn kein gutes Schicksal bestimmt gewesen. Als diese im April 1919 proklamiert wurde und die neue Führungsschicht daran ging, ihre links-revolutionären Ideen zu verwirklichen, waren die Probleme eigentlich schon vorauszusehen. Zu mächtig und zu zahlreich waren die Gegner der Maßnahmen, und schon im August fand das Regime sein Ende, als zu allem Überfluss auch noch rumänische Truppen in Budapest einmarschierten. Die rechtsautoritäre Gegenbewegung ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im Frühjahr des Folgejahres saß ein gewisser Herr Miklós Horthy im Sessel der Macht. In einem absurden ungarischen Königreich ohne König wurde er Reichsverweser. Wir werden in diesem Buch noch an einigen Stellen von diesem Mann hören, doch eine seiner ganz zentralen Charaktereigenschaften möchte ich gleich am Beispiel seiner Machtübernahme ansprechen: Er spielte von Beginn an meisterhaft mit den Feindbildern der ungarischen Gesellschaft. Feind war zuallererst der Kommunist. Nach der blamablen Niederlage gegen Rumänien war auch der letzte Bonus der Kommunisten verspielt, und Horthy verstand es aufs Beste, sich als Bollwerk gegen eine Rückkehr dieser „linken Chaoten“ und „Volksverräter“ zu positionieren. Ganz nach dem Handbuch also. Dennoch traf auch auf Ungarn im Jahr 1919 zu, was fast immer zutrifft. Die Allerwenigsten wünschten sich einen Diktator, auch nicht in Person Miklós Horthys. Aber sie sahen das Problem, und dieser Horthy, Admiral der k. u. k.-Armee und Vertreter einer „alten Größe“, war zumindest ein ausgewiesener Gegner des kommunistischen Terrors und somit eine glaubhafte Lösung. Er war ein Garant für die Stabilität des Landes und dadurch ein Kompromiss, den viele Schichten Ungarns zu tragen bereit waren.
Als echter Diktator verstand sich Horthy in der Folgezeit allerdings nicht, zumindest nicht, was seinen Herrschaftsstil anging. Er bevorzugte es, wie ein herkömmlicher Monarch zu regieren und Ministerpräsidenten unter sich einzusetzen, die die Tagespolitik Ungarns gestalteten – wie in der guten alten Zeit eben, in der Horthy selbst aufgewachsen war. An seiner Legitimation änderte das freilich nichts. Er war angetreten, um ein Problem zu lösen, und der Reichsverweser stand die nächsten zwei Jahrzehnte vor allem für ein Versprechen: Unter ihm würde es in Ungarn niemals wieder eine linke Revolution oder auch nur eine starke linke Bewegung geben. Und dieses Versprechen vertrat er recht glaubwürdig. So war Horthy der letzte nennenswerte europäische Staatsmann, der Anfang der Dreißigerjahre die Sowjetunion als Staat anerkannte – über fünfzehn Jahre nach der Oktoberrevolution und zu einem Zeitpunkt, an dem niemand mehr die Staatlichkeit dieses Regimes hätte anzweifeln können. Dass ihn sein Lieblingsfeindbild, die Bolschewisten, später auch in den politischen und persönlichen Abgrund trieb und ihn zu einer Allianz mit Nazideutschland und der Teilnahme am deutschen Russlandfeldzug verführte, ist ein anderes Thema. Und es ist auch alles nicht so tragisch! Zum Zeitpunkt seines Sturzes war Reichsverweser Miklós Horthy immerhin 24 Jahre lang im Amt gewesen und inzwischen weit über siebzig Jahre alt. Seinen Lebensabend durfte er dann außerdem im klimatisch wie politisch freundlichen Portugal verbringen. Ich bin mir sicher, als Möchtegerntyrann werden Sie mir zustimmen: Man kann sich für die eigene Rente Schlimmeres vorstellen.