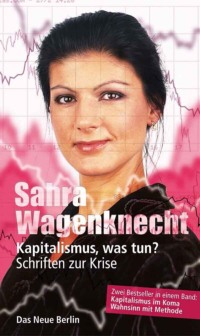Kitabı oku: «Kapitalismus, was tun?», sayfa 2
Die Inflationsrate – und zwar die reale, keineswegs bloß eine »gefühlte« – differiert somit erheblich mit der Einkommensklasse, zu der jemand zählt. Auch solche Differenzen ließen sich wissenschaftlich abschätzen. Das freilich war auf Künasts »Teuro-Gipfel« ebenso wenig Thema wie die Ursachen steigender Preise, die keineswegs in der neuen Währung als solcher liegen.
8. Juni 2002
Der große Bluff
Manchmal haben auch Leitartikler im Handelsblatt lichte Momente. »War der amerikanische Boom in den neunziger Jahren nur ein großer Bluff?« – mit dieser Frage rang einer von ihnen kürzlich eine Drittel Zeitungsseite lang, ehe er die bejahende Antwort wagte. Über zehn Jahre galten die USA als das Erfolgsmodell schlechthin: Jährliche Wachstumsraten nahe fünf Prozent, Preisstabilität, sinkende Arbeitslosigkeit – alles Wünschenswerte schien beisammen. Die letzten zwei Jahre haben das Bild getrübt, inzwischen wird es fleißig aufpoliert. Ifo prognostiziert für 2002 ein Wachstum von 2,3 Prozent; der US-Finanzminister protzt gar mit möglichen 3,5 Prozent. Wie realistisch solche Prognosen sind, sei dahingestellt. Interessanter ist die Frage, die auch den Handelsblättler umtrieb: was die Statistiker mit Kennziffern wie der Wachstumsrate heute tatsächlich messen.
Die Einsicht, dass die Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) nur bedingt als Wohlstandsindikator taugen, ist nicht neu. Eine bekannte Kritik hebt hervor, dass die VGR rein quantitative Größen erfasst: Eine Wirtschaft, die jährlich zehn Millionen Regenschirme erzeugt, deren Stoff sich nach dem zweiten Regen von den Speichen löst, erscheint nach VGR-Maßstab wohlhabender als eine, deren Schirme über Jahre halten und die gerade deshalb weniger von ihnen produziert. Oder: Das Bruttosozialprodukt wächst, wenn die Zahl der pillenschluckenden Kranken zunimmt oder Raubbau an der Umwelt den Aufwand zur Beseitigung der Schäden erhöht.
So berechtigt allerdings diese Kritik ist, sie thematisiert nur einen Teil der Seltsamkeiten. Quantitäten sind immerhin eine empirisch noch irgendwie relevante Größe. Heutzutage von den Statistikern gezählt und gemessen wird dagegen zu weiten Teilen einfach – nichts. Nach dem Platzen der Internet-Blase hat es sich für diesen Bereich herumgesprochen: Anstelle mancher Dotcom-Firma hätte man ebenso gut Nießbrauchsrechte an den globalen Endlagern für Atommüll oder Anteile an den Wasserreservoiren des Monds verkaufen können. Solange Anleger bereit sind, ihr Geld für derartige Papiere zu verschleudern, gelten die daraus resultierenden Einnahmen von Banken und Brokerhäusern als Wertschöpfung. Auch in der inzwischen wieder hochgeschätzten Old Economy entstammt ein Teil der Gewinne reinen Luftbuchungen. Teils unbewussten, sofern die Konzerne, statt dröge Güter zu produzieren, die die Leute mit ihren niedrigen Löhnen eh nicht kaufen können, mit ihrem Kapital in Aktien, Devisen und Derivaten herumspielen und daraus resultierende Erlöse als Gewinn verbuchen. Teils sehr bewussten, sofern nämlich Konzernbilanzen den wirklichen Unternehmenszustand in etwa so lebensnah widerspiegeln wie Vorabendserien die reale Welt. Dass sich Enron auf kreative Buchhaltung verstand, ist inzwischen ein Gemeinplatz. Man sollte allerdings davon ausgehen, dass der Unterschied zwischen Enron und anderen Großunternehmen in erster Linie darin liegt, dass Herr Lay Pech hatte und sich verspekulierte. Im Normalfall läuft die Sache unauffällig und einträglich: für das Unternehmen, für die mitverdienenden »Wirtschaftsprüfer«, oft genug auch für Behörden. Nach der Enron-Pleite waren auch IBM und General Electric wegen Verdachts auf Bilanzfälschung ins Visier der Fahnder geraten. Kurze Zeit später wurden die Ermittlungen »wegen Mangel an Beweisen« eingestellt. Lediglich der Konzern CMS Energy musste zugeben, dass etwa drei Viertel (!) seines Handelsvolumens Scheingeschäften entstammten.
Dabei werden Bilanzen nicht in jedem Fall geschönt. Ist der Adressat das Finanzamt, kann auch Armut vorgegaukelt werden. Ein beliebtes, in beide Richtungen einsetzbares Täuschungsmanöver besteht im »Parken« von Gewinnen und Verlusten bei nichtkonsolidierten Tochtergesellschaften. Enron hatte 900 davon. Zur Bilanzkosmetik gehören ferner die Auf- oder Abwertung von Vorräten und Variationen bei den Abschreibungen. Weit verbreitet und durchaus nicht illegal sind Pro-Forma-Ergebnisse: Ertragszahlen, die um »außergewöhnliche Einflüsse« bereinigt sind. Was außergewöhnlich ist, entscheidet das Unternehmen. Der Internetdienst SmartStockInvestor.com hat errechnet, dass die im Nasdaq notierten Unternehmen in ihren Pressemitteilungen für die ersten drei Quartale 2001 einen Pro-Forma-Gewinn von insgesamt 19,1 Mrd. Dollar auswiesen, während sie an die amerikanische Finanzaufsicht SEC für den gleichen Zeitraum einen Verlust von 82,3 Mrd. Dollar meldeten.
Man glaube nicht, Bilanzmanipulation sei eine amerikanische Spezialität. Eine Studie der Universität des Saarlandes, die 342 Geschäftsberichte von Nemax-Titeln unter die Lupe nahm, kam zu dem Schluss, dass Wirtschaftsprüfer in der Regel eklatante Verstöße gegen einschlägige Bilanzierungsvorschriften akzeptieren. Auch bei Dax-Unternehmen wäre man gewiss fündig geworden.
Die Unternehmensdaten aber sind die wesentliche Basis, auf der makroökonomische Größen wie Volkseinkommen oder Wachstumsrate errechnet werden. Der Prunkbau steht auf wackligen Füßen. Zumal in den oberen Etagen fröhlich weiter geschummelt wird. Eichel überlegt seit einiger Zeit, ob er durch eine neue Methode der Inflationsrechnung dem ausbleibenden Aufschwung wenigstens statistisch auf die Sprünge hilft. »Mehr Wachstum durch neue Preismessung« fasst das Handelsblatt diese Idee zusammen. Ob da auch ein Leitartikler über Bluff nachdenkt?
22. Juni 2002
Schurkenparabel
Die Welt ist ungerecht. Telekom-Chef Sommer hat gemacht, was alle machen: Er hat die Wachstumschancen der Telekombranche rosig geredet, um den Ausgabepreis der Aktien nach oben zu treiben, er hat sich redlich bemüht, den privatisierten Staatskonzern auf Shareholder-Value zu trimmen, er hat die internationale Expansion vorangetrieben, hat mit UMTS Milliarden in eine vermeintliche Zukunftstechnologie investiert, und er hat bei all dem der Aufforderung Rechnung getragen, dass Leistung sich wieder lohnen müsse, was er selbstredend auf die eigene bezog. Statt Dank und Lob erhält er nun die unehrenhafte Entlassung, steht am Pranger als Personifizierung von Gier und Bereicherungswut, als Schädiger von drei Millionen Kleinaktionären, die er durch eine verfehlte Unternehmensstrategie um ihr mühsam Erspartes betrogen habe.
Dabei hatte alles so schön angefangen. Im November 1996, Sommer war gerade ein Jahr im Amt, brachte die Telekom ihre erste Aktientranche zum Ausgabepreis von 14,32 Euro an die Börse. Eine Erfolgsgeschichte begann. Die T-Aktie stieg und stieg, erst allmählich, dann immer schneller. Der zweite Börsengang folgte im Juni 1999, der Ausgabepreis lag jetzt bereits bei 39,50 Euro. Gezielt wurden Kleinsparer umworben und zum Einstieg ermutigt, den zunächst niemand bereuen musste. Innerhalb weniger Monate verdoppelte sich der Kurs und erreichte im Frühjahr 2000 seinen Spitzenwert von 100 Euro. Wer ein Jahr zuvor T-Aktien gekauft hatte, hatte faktisch im Schlaf sein ursprüngliches Vermögen noch einmal hinzuverdient. Ähnlich der Telekom boomten damals alle Papiere aus dem Kommunikations-, Medien- und Internetbereich. Dass aus 10 000 Mark innerhalb kürzester Zeit 20 000 oder 30 000 werden, schien eher Regel denn Ausnahme zu sein. Kapitalismus macht reich, lautete die Generalnachricht, man müsse nur mitmachen. Ob BILD, SPD-Grundsatzdebatte oder RTL-Vorabendprogramm: Auf allen Kanälen florierte jenes Verblödungspalaver, das die Verwandlung von Briefträgern und Aldi-Kassiererinnen in nachfeierabendliche Aktienzocker als den endlich gefundenen Ausweg aus sozialen Nöten und gesellschaftlichen Einkommenskontrasten verkündete. Strahlemann Sommer wurde zur Inkarnation dieses wohlstandgenerierenden Volkskapitalismus und erfüllte damit eine wichtige politische Funktion. Die Zerschlagung und Teilprivatisierung der gesetzlichen Rente etwa, auf die Allianz-Chef Schulte-Noelle erst kürzlich wieder Lobeshymnen sang, wäre ohne die Kapitalmarkt-Euphorie jener Tage kaum durchsetzbar gewesen. Der Kanzler höchstselbst legte sich ins Zeug, um die Konten unbedarfter Kleinsparer zugunsten überbewerteter Anteile an der Deutschland AG zu leeren.
Deshalb hängt für Schröder an der T-Aktie noch mehr als der Frust von drei Millionen potentiellen Wählern. Ihr Absturz hat den Mythos der kapitalistischen Teilhaber-Gesellschaft beschädigt und damit auch eine Politik, die unter Reformfähigkeit die Förderung des Shareholder-Value-Kapitalismus amerikanischer Prägung versteht. Jetzt muss Sommer als Buhmann herhalten, um Verallgemeinerung zu vermeiden. Sein Hinauswurf ist Teil eines inszenierten Lehrstücks mit zwei Botschaften: Der unfähige Manager ist schuld! Und: Abzocke wird bestraft!
Natürlich ist diese Schurkenparabel so verlogen wie die ursprüngliche Erfolgsstory. Sommers Aktienoptionsspielereien lagen, verglichen mit denen anderer Konzerne, im mittleren bis unteren Bereich des Üblichen und das Auf- und Ab der T-Aktie ist einfach Ergebnis kapitalistischer Krisendynamik. Dabei wirkt die billionenschwere Liquidität, die heutzutage, global mobil und von wenigen dirigiert, von Anlage zu Anlage rast, als extremer Verstärker, der die Ausschläge bis zum Exzess treibt. Dank Privatisierungspolitik zum Anlageobjekt geworden, galt die Telekommunikation Ende der Neunziger als hochprofitabler Wachstumsmarkt. Es herrschte Gründerstimmung, Hunderte neue Unternehmen starteten, die Preise für Telefongespräche sanken um bis zu siebzig Prozent. Finanzierbar war dieses Dumping, weil Eigen- wie Fremdkapital spottbillig zur Verfügung standen. Bloße Branchenzugehörigkeit garantierte sprudelnde Geldquellen, deren Eigner zunächst kaum nach Gewinnen fragten. In diesem Umfeld gingen die europäischen Ex-Monopolisten international auf Einkaufstour und verbrannten Milliarden beim Ersteigern voraussichtlich wertloser UMTS-Lizenzen.
Spätestens Anfang 2000 war eigentlich klar, dass der Aktienboom im Telekombereich jede Basis verloren hatte. Während professionelle Fonds den sachten Ausstieg einleiteten, fing der Werbefeldzug gegenüber dem Kleinanleger erst richtig an. Nach der 12-Milliarden-Pleite von Global Crossing geschah, was irgendwann geschehen musste: ein abrupter Kapitalabzug aus dem gesamten Telekom-Bereich setzte ein. Kleinere Anbieter, vorher Alibi gelungener Liberalisierung, gehen seither reihenweise Konkurs. Die großen Konzerne überleben, auch dank unverändert überragender Marktmacht im heimatlichen Terrain, allerdings mit geschmolzener Eigenkapitaldecke und hohen Schulden. Die Telekom traf dieses Schicksal nicht härter als France Telecom oder die britische BT Group, von Worldcom in den USA zu schweigen. Neue Allianzen sind absehbar. Die US-Aufsichtsbehörde hat bereits angekündigt, künftig auch Zusammenschlüsse zu genehmigen, durch die einzelne Anbieter erneut große Teile des Marktes kontrollieren. Der Begriff »Re-Monopolisierung« macht die Runde. Dann freilich dürften die Preise für Telefondienste aller Art bald wieder kräftig steigen und ihnen folgend auch Gewinne und Aktienkurse. Nur mag bis dahin manchem Kleinanleger die Puste ausgegangen sein; vielleicht, weil er als gleichzeitiger Telekombeschäftigter dem radikalen Sparprogramm der Sommer-Nachfolger zum Opfer fiel.
20. Juli 2002
Professionell geschmiert
Apple: Gewinn-/Umsatzeinbruch, BNP Paribas: Prognosen verfehlt, Caterpillar: Erwartungen verfehlt, Ericsson: Siebter Verlust in Folge, IBM: Gewinneinbruch, Prognosen verfehlt, Intel: Prognosen verfehlt, J. P. Morgan: Prognosen verfehlt, Motorola: Rekordverlust, Philip Morris: Hoher Verlust wegen Abschreibungen …, irgendwie hatte man sich unter »Aufschwung« etwas anderes vorgestellt als die derzeit eintrudelnden Quartalsbilanzen der Unternehmen. Gut, dass es inmitten all der Trostlosigkeit wenigstens eine Branche gibt, die kräftig expandiert, obschon eine moralinsaure Öffentlichkeit ihr derzeit das Leben schwer macht.
Die Rede ist vom professionellen »Gibst-du-mir-geb-ich-dir«, laut Handelsblatt der »Wachstumsmotor« in der ansonsten eher gebeutelten Kommunikationsbranche. Schon jetzt erwirtschaften Lobbyisten zwischen fünfzehn und zwanzig Prozent der Honorarumsätze großer PR-Agenturen; Tendenz steigend. Etwa 15 000 Interessenvertreter in Brüssel verdienen ihre Brötchen damit, rund 20 000 EU-Beamte zu bearbeiten, und auch in Berlin bauen große Anwaltskanzleien ihre Lobbyarbeit aus. 1726 Gruppen sind allein in der offiziellen Lobbyliste des Bundestages registriert. Selbstverständlich gehe es beim Geschäft der honorigen Public-Affairs-Berater »nicht darum, zu mauscheln«, betont selbige Wirtschaftszeitung, sondern lediglich, »die Themen gegenseitig transparent zu machen«.
Die derzeitige öffentliche Diskussion wird daher als konjunkturschädigend – und im Übrigen als pure Heuchelei – missbilligt. Als ob mit Scharping und Özdemir irgend etwas bekannt geworden wäre, was nicht längst jeder wüsste! Lobbyisten gehörten schließlich »zum Abgeordnetenalltag – wie Ausschusssitzungen«.
Wo das Handelsblatt recht hat, hat es recht. Bereits im März 1999 hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihrer Klientel in aller Öffentlichkeit einige Tips verabreicht, wie Politikerkauf auf elegante Weise zu bewerkstelligen sei. Überschrift: »Auf Abbau der Arbeitslosigkeit berufen / Die Opposition nicht vergessen / Lobbying als strategische Aufgabe« (FAZ 8. 3. 99) Zunächst wurden damals mögliche Verunsicherungen ob des Regierungswechsels ausgeräumt: »Mit guten Argumenten … konnten Lobbyisten auch beim kleineren Regierungspartner durchaus Einfluss ausüben«, wusste die FAZ, und meinte gewiss nicht nur Herrn Özdemir. Zudem finde man in den Bundesbehörden »zumindest auf der fachlichen Ebene, manchmal auch noch im Leitungsbereich … die gewohnten Ansprechpartner«. Dann folgt das nötige Knowhow: Es gelte »beim Gegenüber einen Informationsvorsprung zu schaffen«. Lobbyisten müssten »immer präsent sein. Ihre Forderungen seien maßvoll, sie seien glaubwürdig«. Empfohlen werden insbesondere Kontakte zu Ausschussvorsitzenden im Bundestag, Fachsprechern der Fraktionen, einzelnen Abgeordneten im Europäischen Parlament und deutschen Kommissaren in der Europäischen Kommission.
»In den Abgeordnetenbüros, in den Cafeterien, in den Brüsseler Restaurants rund um den Glaskasten des Parlaments in der Rue Wirtz, überall treffen sich diskrete Gesandte von Konzernen und Verbänden mit EU-Parlamentariern«, erläuterte dieser Tage das Handelsblatt (26. 7. 02) die Funktionsweise unserer zivilisatorischen Errungenschaft »Demokratie«. Als Prototyp erfolgreicher Praxis könne folgender Fall aus Deutschland gelten: »So wollte eine große amerikanische Hamburger-Kette« – Dezenz ist angesagt; auch das Handelsblatt will keine potentiellen Werbekunden verprellen! – »Mitte der achtziger Jahre auch an Autobahnen verkaufen. Doch die Raststätten waren fest in staatlicher Hand. Ein Fall für einen ausgebufften Lobbyisten. Ein paar Anrufe bei bekannten Stern-Reportern, so erzählt der PR-Experte, schon erschien 1985 eine vierseitige Story in dem Magazin. Thema: Die miserablen deutschen Autobahn-Raststätten – Besserung nur durch Privatisierung zu erwarten. Das Interesse der Öffentlichkeit war geweckt. So konnte der Lobbyist zwei befreundete Abgeordnete überzeugen, eine Anfrage zur Privatisierung der Raststätten zu starten. 1990 schließlich eröffnete die Fastfood-Kette ihr erstes Restaurant an der Autobahn.«
Was freilich die wirklich Großen von den wirtschaftlichen Mittelfeldspielern unterscheide, sei, dass sie des Umwegs über die Agenturen gar nicht bedürfen. »Wenn etwa Daimler-Chef Jürgen Schrempp ein politisches Anliegen hat, spricht er oft direkt mit dem Bundeskanzler oder den Ministern. Die Mitarbeiter im Berliner Daimler-Büro verfolgen die Sache dann weiter.« Einer, der ebenfalls »politische Anliegen« und den direkten Draht hat, ist Allianz-Chef Schulte-Noelle. In einem am 22. Juli im Handelsblatt erschienen Interview zeigt er sich überzeugt, dass die Nach-Wahl-Regierung »… das mit Volldampf in Angriff nimmt, was in kleineren Gesprächsrunden längst unumstritten ist«. Das betreffe insbesondere »kraftvolle und zukunftsweisende Entscheidungen« auf dem »strangulierten Arbeitsmarkt« sowie in der Gesundheitspolitik. Dabei hält sich Schulte-Noelle nicht damit auf, zwischen Schröder und Stoiber zu differenzieren, sondern konstatiert, er könne »in persönlichen Gesprächen mit den Politikern der einen oder andern Seite … gar keine so großen Unterschiede feststellen«.
Nachzutragen wäre, dass professionelle PR-Pflege natürlich nicht die einzige im konjunkturellen Jammertal fröhlich prosperierende Branche ist. Auch der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS erfreute die Wirtschaftswelt kürzlich mit der optimistischen Prognose, sein Umsatz im Militärgeschäft werde von derzeit sechs Mrd. Euro bis 2004 um mindestens die Hälfte auf neun Mrd. Euro ansteigen. Und noch eine kleine Meldung purzelte weithin unbemerkt ins Sommerloch: »Rüstungsexport kommt auf den Prüfstand. SPD- und CDU-Politiker fordern Aufweichung der strengen Ausfuhrrichtlinien.« (Handelsblatt 12. 7. 02) Um die Rentabilität von PR-Investments muss man sich also keine Sorgen machen.
3. August 2002
Abwärtssog
War es vor Jahresfrist in der einschlägigen Wirtschaftspresse noch verpönt, auch nur den Begriff »Rezession« zur Beschreibung der aktuellen Lage zu verwenden, haben sich inzwischen viel bösere Worte eingeschlichen. Statt über kapitalistische Effizienz und kreatives Unternehmertum sinnieren stockkonservative Leitartikler über ein möglicherweise Jahrzehnte anhaltendes Siechtum der westlichen Ökonomien. Das Schicksal Japans, über das in den letzten Jahren kaum einer nachdenken mochte, ist plötzlich allgegenwärtig, von einer drohenden Deflationsspirale, ja von Weltwirtschaftskrise ist die Rede. »Nimmt man die Daten der US-Wirtschaft unter die Lupe, packt einen der Schreck. Und … in Asien und Europa sieht es nicht besser aus«, bangt das Handelsblatt. In düsteren Kommentaren werden Parallelen zwischen 1929 und 2002 gesucht und gefunden. Und jeder neuen Börsenmeldung folgt das gleiche Klagelied: Es gäbe keine »sicheren Häfen« mehr; alle »sinnvoll herleitbaren Unterstützungsniveaus« seien durchbrochen, es gehe haltlos bergab und bergab und bergab, und keiner wisse, wie weit noch und wie lange.
Bushs Konjunkturreden der letzten Wochen mit ihrer billigen Aufschwungpropaganda wurden von der Wall Street regelmäßig mit dreistelligen Verlusten quittiert. Offenbar um seine Glaubwürdigkeit besorgt, rudert jetzt auch Alan Greenspan zurück. Hatte er in seiner Juli-Rede noch versucht, Optimismus zu verbreiten und der US-Ökonomie 3,5 Prozent Wachstum für dieses Jahr angedichtet, gesteht die amerikanische Zentralbank Fed jetzt »für die überschaubare Zukunft« das »Risiko einer weiteren wirtschaftlichen Abschwächung« ein. Die Zinsen wurden nach allgemeiner Auffassung in dieser Woche nur deshalb nicht erneut gesenkt, damit, wenn alles noch viel schlimmer gekommen ist, der mindeste Spielraum bleibt. In Wahrheit glaubt wohl auch niemand mehr daran, dass eine erneute Zinssenkung die Talfahrt stoppen könnte. Immerhin befinden sich die US-Leitzinsen mit 1,75 Prozent bereits heute auf dem niedrigsten Stand seit vierzig Jahren. Und das Beispiel Japan zeigt, dass handfeste kapitalistische Krisen auch mit Zinsen nahe Null nicht zu besiegen sind.
In dem allgemeinen Tohuwabohu melden sich auch immer mal wieder Optimisten zu Wort, die darauf beharren, dass die Kurse bald wieder steigen müssten, da es sich beim statthabenden Börsencrash lediglich um die Bereinigung einer spekulativen Blase handele. Irgendwann befänden sich Unternehmensgewinne und Kurswert wieder in einem vernünftigen Verhältnis, und dann wäre der ganze Albtraum vorüber. Nur: Niemand weiß, wann jenes »vernünftige Verhältnis« erreicht ist. Im Dezember 1996, als Alan Greenspan das erste Mal vor einem »irrationalen Überschwang« an den Börsen warnte, bewegte sich der Dow Jones knapp 20 Prozent unter heutigem Niveau.
Die marxistische These, dass es sich beim Aktienkurs um die zum herrschenden Zinsfuß – zuzüglich eines gewissen Risikoaufschlags – kapitalisierten Unternehmensprofite handelt, gilt zwar über längere Frist auch heute noch. Aber zum einen handelt es sich bei den kursrelevanten Profiten nicht um die vergangenen, sondern um die zukünftigen, die keiner genau kennt und von denen im Abwärtssog alle annehmen, dass sie jedenfalls unter den heutigen liegen. (Zumal auch die vielfach nicht rosig sind, weshalb das Kurs-Gewinn-Verhältnis amerikanischer Aktien mit Werten von rund 35 heute beinahe so hoch ist wie auf dem Gipfel des Booms.) Zum anderen – reale Profitentwicklung hin oder her – genügt es zur Fortschreibung der Kursstürze völlig, wenn alle erwarten, dass alle erwarten, dass es vorerst weiter bergab geht. Denn es ist dieses seltsam zirkuläre Kalkül, das die reale Kursdynamik regelt. In einem durch vorwiegend spekulative Kapitalbewegungen beherrschten Markt kann die »längere Frist«, in der sich die Fundamentaldaten durchsetzen, nämlich ziemlich lang werden und beschreibt ohnehin nur einen Trend. Ansehen und Erfolg von Analysten, Brokern und Hedgefondsmanagern aber hängen nicht von der korrekten Voraussicht langfristiger Trends, sondern vom Ausnutzen der kurzfristigen Schwankungen ab. So wie in Boomphasen – egal, ob einzelner Branchen oder der Gesamtökonomie – lange mit Erfolg darauf spekuliert werden kann, dass der Aktienkurs die realistisch erwartbare Profitsteigerung weit überzeichnet, kehrt sich das Kalkül im Krisenprozess um.
Zumal man bei richtiger Voraussicht (oder verlässlichen Informanten) auch an fallenden Kursen glänzend verdienen kann. Nicht nur durch rechtzeitiges Abstoßen der eigenen Aktien, sondern auch, indem man den Kursverfall selbst in klingende Münze verwandelt. Leerverkäufer etwa, sogenannte Short Seller, leihen sich bei einem Händler, einer Bank oder einem Fond Aktien gegen Gebühr, die sie an der Börse verkaufen. Sinkt dann tatsächlich der Kurs, kaufen sie die Aktien zu dem niedrigeren Preis und geben sie dem Leihgeber zurück. Die Differenz ist ihr Gewinn. Leerverkäufe in großem Stil können den Kursverfall einer Aktie erheblich beschleunigen, da sie einerseits das Angebot zusätzlich erhöhen, andererseits vorhandene Leerpositionen in Aktien zumindest in den USA veröffentlicht werden. Ein hohes Potenzial gilt als Abwertungsindiz und kann die Verkäufe, auf die die Short Seller spekulieren, tatsächlich auslösen. Nachweislich hatten Leerverkäufer etwa beim Absturz der Telekomaktie oder auch der von SAP ihre Hände im Spiel. Dennoch: Spekulanten sind für das Auf und Ab der Börse in letzter Konsequenz ebenso wenig verantwortlich wie deregulierte Finanzmärkte für kapitalistische Krisen. Beide sind nichts als Katalysatoren und Verstärker. Sie haben den US-Boom durch Vorspiegelung gewaltiger Vermögenszuwächse des amerikanischen Mittelstands weit über die eigentliche Kaufkraftgrenze hinaus verlängert und rächen sich jetzt, indem sie die Abwärtsdynamik potenzieren.
17. August 2002
Profitable Fluten
»Auftragsflut in Sicht«, titelte dieser Tage das Handelsblatt. Gegenstand des Artikels ist nicht eine der üblichen Schönwettermeldungen eines um Schröders Wahlsieg besorgten Hofökonomen – so dick lügen angesichts der realen Lage selbst die nicht mehr – sondern die nüchterne Empfehlung, Aktien der Baubranche zu ordern. Auch Baumärkte, Einrichtungshäuser, Möbelläden und Teppichausstatter zählten zu den Firmen, die »am Großreinemachen verdienen«. Die Rede ist von den Folgen der Hochwasserkatastrophe. Analysten werden zitiert, Rechnungen aufgemacht, Profitchancen durchkalkuliert. Es ist eben alles eine Frage der Sichtweise. Was für viele ein Albtraum und der Ruin von Zukunft und Hoffnung, ist für andere eine nützliche Belebung der seit Jahren lahmenden Baukonjunktur.
Es hat keinen Sinn, sich über Zynismus zu beklagen. Zeit seiner Existenz lebt Kapital in dem Widerspruch, sich nur um den Preis strangulierter Massenkaufkraft optimal zu verwerten und sich andererseits nicht verwerten zu können, wenn keiner da ist, der ihm den produzierten Kram abnimmt. Kriege und Naturkatastrophen, deren Zerstörungskraft Nachfrage erzwingt, sind in diesem Zusammenhang ausgesprochen hilfreich. Allerdings existiert auch hier das Problem, dass irgendwer seinen Geldbeutel öffnen und zahlen muss. Dies war nach den marktwirtschaftlichen »Befreiungskriegen« in Bosnien und im Kosovo der Fall, als US- und EU-Steuergelder als Kredite flossen, ebenso in Kuweit nach dem ersten Golfkrieg. In Afghanistan rinnt das Geld schon spärlicher, wohl weil der Krieg zwar inzwischen weniger beachtet, aber noch lange nicht beendet ist. Und in vielen hunger- und bürgerkriegsgeschüttelten Dauerkatastrophengebieten dieses Planeten ist schlicht gar nichts zu holen. Die in regelmäßigen Abständen wiederkehrenden Fluten in Bangladesch mit Zigtausenden Toten interessieren keinen Bauunternehmer und keinen Aktienanalysten. Anders in Dresden. Obschon auch die öffentliche Hand in Deutschland sich in den letzten Jahren erfolgreich arm reformiert hat, stand von Beginn an fest, dass die zerstörte Infrastruktur wiederaufgebaut und den Betroffenen wenigstens eine minimale Entschädigung gezahlt werden muss. Offen war einzig, wessen Portemonnaie dafür herhalten sollte. Und der Zank darüber begann, noch während das Wasser durch die Dämme schwappte. Wäre nicht gerade Wahlkampf, hätte die Lösung vermutlich in einem Flutopfersondersolidaritätszuschlag bestanden, oder – sozial noch ein bisschen grausamer – in einer neuen Verbrauchssteuer auf irgendein schwer vermeidbares Konsumgut. Vielleicht würden wir dann künftig nicht nur für die Rente tanken und für Schilys Polizeistaat rauchen, sondern auch für Sachsens Straßen trinken. Solche Ideen verboten sich allerdings vier Wochen vor dem Urnengang. Schließlich hat Stoiber in diesem Wahlkampf schon mehrfach bewiesen, dass er sich auch aufs Ziehen der populistischen »Mein-Herz-gehört-dem-kleinen-Mann«-Karte versteht. Inzwischen ist beschlossen: Es gibt keine Steuererhöhungen, aber die zweite Stufe der Steuerreform wird um (mindestens?) ein Jahr verschoben und geschätzte 6,3 Milliarden Zusatzeinnahmen, die daraus resultieren, fließen in die Elbregionen.
Nun ist Schröders Steuerreform zu Recht alles andere als ein Objekt linker Sympathie, und die seinerzeitige Zustimmung der PDS im Bundesrat gehört zu jenen unverzeihlichen Sündenfällen, deren Summe sich heute in mageren Umfragewerten rächt. Dennoch: Was da um ein Jahr verschoben wurde, ist in erster Linie jener einzige kleine Teil des unsäglichen Projekts, den man guten Gewissens noch rechtfertigen konnte. Aufgeschoben ist zwar auch die weitere Senkung des Spitzensteuersatzes um 1,5 Prozent, der übergroße Teil der geplanten Einnahmen aber rührt daher, dass die versprochene Senkung des Eingangssteuersatzes um knapp 3 Prozent nicht stattfindet und die Freibeträge nicht, wie beabsichtigt, angehoben werden. Beides trifft vor allem Gering- und Mittelverdiener. Die bereits in Kraft getretene Senkung der Spitzensteuern um insgesamt 4,5 Prozent wird dagegen ebenso wenig zurückgenommen wie das milliardenschwere Geschenkpaket an die deutsche Wirtschaftselite, das seit 2001 dem Fiskus in bestimmten Bereichen die Hände bindet.
Um welche Beträge es bei letzterem geht, zeigt die Entwicklung der Körperschaftssteuer. Hatte diese Steuer dem Staat im Jahr 2000 noch 23 Milliarden Euro Einnahmen gebracht, wies sie 2001 erstmals in der bundesdeutschen Geschichte ein negatives Ergebnis aus: Während jedem Kleinverdiener Monat für Monat sein Obolus vom Gehaltszettel abgezogen wird, überwiesen die Finanzämter der Dax-Aristokratie per Saldo 425 Millionen Euro. Aus der Steuer war eine versteckte Subvention geworden, und das keineswegs als einmaliger Ausrutscher. Für die ersten sechs Monaten diesen Jahres liegt der Negativsaldo bereits bei 1,3 Milliarden Euro. Im Juli kamen weitere 563 Millionen dazu. Ursache dieser seltsamen Verkehrung im Steuergeldfluss sind spezielle Regelungen in Eichels Meisterwerk, die es den Kapitalgesellschaften gestatten, sich in den Jahren vor der Reform zu den alten Sätzen gezahlte Steuern zurückzuholen. Nach offizieller Schätzung beträgt das Polster, das sich auf diese Weise versilbern lässt, etwa 30 Milliarden Euro. Vielleicht sind es auch mehr, keiner weiß es genau, und keiner will es genau wissen. In jedem Fall gehen viele Steuerschätzer inzwischen davon aus, dass die öffentliche Hand aus edlen Konzernzentralen auf absehbare Zeit kaum einen müden Euro mehr bekommt. Weder für die Flutopfer, noch für sonst irgendwas. Der 1,5-prozentige Zuschlag zur Körperschaftssteuer, den Schröder – witzigerweise auf Druck der Union – am Ende noch in das Wiederaufbau-Finanzierungspaket aufgenommen hat, wirkt in diesem Kontext wie ein trüber Scherz, und das Theater der Wirtschaftsverbände riecht nach Inszenierung. Es ist wie immer: Otto Normalverbraucher zahlt die Zeche; und damit zum Schaden auch der Spott nicht fehlt, wird er sich demnächst im Handelsblatt wieder für seine Konsumunlust getadelt finden.
31. August 2002
Der Boss und sein Kanzler
»Der Boss und sein Kanzler«, hatte das Handelsblatt am 6. Juli die Klassenverhältnisse in einer Bildunterschrift auf den Punkt gebracht. Die Photomontage, unter der der zitierte Satz steht, zeigt einen selbstbewussten Eon-Chef Hartmann; neben ihm, klein und in Demutshaltung, Gerhard Schröder. Tags zuvor hatte Staatssekretär Tacke die Übernahme der Ruhrgas AG durch Eon per Ministererlaubnis bewilligt. Ausgekungelt hatten Hartmann und Schröder den Deal spätestens im Oktober 2001. Was folgte, war eine halbjährige Aufführung absurden Theaters. Das Bundeskartellamt lehnte die Fusion, die fast zwei Drittel des deutschen Gasmarktes einem einzigen Unternehmen übereignen wird, erwartungsgemäß ab. Es hätte die mit dem Sachverhalt befassten Ökonomen aber ebenso gut zum Golfspiel auf die grüne Wiese schicken können; noch während sie prüften, wurde die Ministererlaubnis in Aussicht gestellt. Die in diesem Verfahren zu hörende Monopolkommission teilte gleichfalls mit, sie sähe keinen einzigen Grund, weshalb Eons Übermacht dem Allgemeinwohl dienen sollte, – die Bedingung einer Ministererlaubnis. Am 29. Mai wurde dem Gesetz Genüge getan, das Für und Wider in öffentlicher Anhörung abzuwägen. Der mit der Ministererlaubnis betraute Tacke war gar nicht erst erschienen, Hartmann verschwand, nachdem er sein Statement verlesen hatte. Unterdessen verhandelten beide ungestört von Öffentlichkeit über Auflagen, die Eon nicht schmerzen und Tackes Gesicht wahren würden. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent RWE wurde durch versprochenen Zugriff auf die noch in Eon-Besitz befindliche Gelsenwasser AG in den Handel eingebunden.