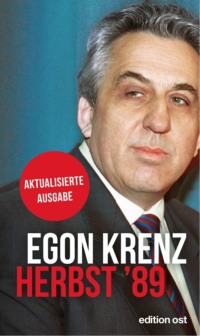Kitabı oku: «Herbst '89», sayfa 3
Als Helmut Schmidt 1981 Erich Honecker besuchte, sagte er ihm, dass das Bundesverfassungsgericht »mit unglaublich großer Arroganz politische Fragestellungen juristisch entscheide. Man könne auch sagen, die Bundesrepublik sei kein Rechtsstaat, sondern ein Gerichtsstaat«.26 Dies ist seit 1990 auch meine Erfahrung. Ich kenne bis heute keinen Staat auf der Welt, in dem es nicht auch Unrecht geben würde. Leider!
Die DDR war trotz ihrer Defizite etwas völlig Neues in der deutschen Geschichte. Sie durchbrach den ewigen Kreislauf von Ausbeutung, Krise und Krieg. Sie war keine Fehlgeburt, sondern eine logische Antwort auf die existenziellen Katastrophen, die der deutsche Imperialismus ausgelöst hatte. Er war Schuld am Tod von über 80 Millionen Menschen in zwei Weltkriegen. Die Entstehung der DDR war ein Aufbäumen von Antifaschisten, nicht nur aus der Arbeiterbewegung, sondern auch aus dem Bürgertum, gegen die Verursacher und die Ursachen von Krieg und Faschismus. Die DDR nahm ihr Gründungsversprechen ernst: Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen.
Auch angesichts der Tatsache, dass Deutschland inzwischen wieder im Krieg steht, ist von historischem Wert: Die DDR bleibt bis heute der einzige deutsche Staat, der nie Kriege geführt hat.
1949 charakterisierte die sowjetische Regierung die Gründung der DDR als einen Wendepunkt in der Geschichte Europas. Und tatsächlich: Solange sie existierte, wäre es undenkbar gewesen, dass deutsche Soldaten an Kriegen wie beispielsweise in Jugoslawien und Afghanistan teilgenommen hätten. Wie die Gründung war auch der Untergang der DDR ein europäischer Wendepunkt. Nicht im Traum hätte ich mir 1989 vorstellen können, dass schon wenige Jahre später Truppen der NATO, der auch Deutschland angehört, an den Grenzen Russlands stehen würden.
Mit dem Verschwinden der UdSSR und der DDR von der politischen Landkarte veränderte sich nicht nur Europa, sondern auch die Welt. Länder wie Kuba und Vietnam, Staaten in Afrika, Asien und Lateinamerika verloren ihre natürlichen Verbündeten. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Untergang der Sowjetunion als eine globalpolitische Katastrophe am Ende des vergangenen Jahrhunderts. In diesen weltgeschichtlichen Kontext ordne auch ich die Vorgänge von 1989 bis 1991 in Osteuropa ein.
Es ist ziemlich weltfremd, wenn einige »Bürgerrechtler« den Eindruck erwecken wollen, es sei ihr Widerstand gewesen, der den Untergang der DDR bewirkt habe. Da waren ganz andere Kapazitäten am Werke, die im Hintergrund die Strippen gezogen haben.
Als jemand, der bis Dezember 1989 nicht Zaungast, sondern einer der Akteure dieser Periode war, überrascht es mich schon, wie Politiker, staatstreue Historiker und ihre Sprachrohre die Ereignisse von September bis Dezember 1989 interpretieren. Sie nehmen die Vorgänge für ihre These in Anspruch, zum Anschluss der DDR an die Bundesrepublik habe es keine Alternative gegeben. Der Protest des Volkes, sagen sie, sei von Anfang an gegen das »SED-Regime« gerichtet und für die »freiheitlich-demokratische Ordnung der Bundesrepublik« gewesen. Woher eigentlich nehmen sie diese Überzeugung? Eine Befragung des Volkes hat es doch nie gegeben. Vorschläge für einen Volksentscheid hingegen schon.
Dass die Sache keineswegs so einfach und klar war, machte im Dezember 1989 der Direktor des Instituts für Internationale Politik und Wirtschaft der DDR, Max Schmidt, in einem Brief27 an mich deutlich: In den letzten Wochen hätten Forderungen nach einer »Wiedervereinigung« zugenommen. Das hinge damit zusammen, dass viele Menschen nicht jahrelang darauf warten wollten, bis sich die Situation in der DDR verbessert habe. Nach ihrer Meinung wäre es günstiger, kein neues Experiment zu wagen, sondern lieber gleich die »Wiedervereinigung« anzustreben. Würden wir auf diese Frage nicht eingehen, könnte die »Wiedervereinigung« zum hauptsächlichsten Thema der bevorstehenden Wahlen zur Volkskammer werden. Zum Wahlkampf sei eine solche Schicksalsfrage der DDR aber nicht geeignet.
Schmidt unterstrich allerdings auch: Noch gebe es den Grundkonsens der SED und der anderen Parteien mit den Führungskräften des Neuen Forum, des Demokratischen Aufbruchs, der Bewegung Demokratie jetzt!, der Sozialdemokratischen Partei, der Grünen sowie der beiden großen Kirchen, dass die »Wiedervereinigung« nicht aktuell sei. Auch hinsichtlich der antifaschistischen Traditionen und der sozialistischen Perspektive gebe es noch eine bestimmte Übereinstimmung. Es wäre daher an der Zeit, in offenen Gespräche mit den anderen Parteien, demokratischen Organisationen und den Kirchen zu treten, um dem Konsens über die Nichtaktualität der »Wiedervereinigung« politischen Ausdruck zu geben. Die geeignete Form könnte eine Volksbefragung sein. Die Bevölkerung solle darüber abstimmen, dass die deutsche Einheit nicht auf der Tagesordnung stünde, sondern dass freie Wahlen für eine neue DDR-Regierung Vorrang hätten.
Soweit Prof. Max Schmidt im November 1989.
Entgegen der Warnung vieler wurde die deutsche Einheit Thema des Wahlkampfes, der wesentlich von den etablierten Parteien der BRD auf dem Territorium der DDR geführt wurde. Weder die DDR-Regierung noch die Bundesregierung waren bereit, das Volk zu befragen. Hingegen wurde die Mär genährt, es könne ein »Deutschland, einig Vaterland« auf gleichberechtigter Grundlage entstehen. »Blühende Landschaften« wurden ebenso versprochen wie eine Zukunft, in der es keinem schlechter, aber allen besser gehen würde. Keine der Parteien warnte vor der weit verbreiteten Illusion, es sei möglich, die »guten Seiten« beider Staaten in einem neuen zu vereinen. Für die damaligen Wortführer gab es ohnehin keine guten Seiten an der DDR.
Die Ereignisse im Sommer und Frühjahr 1989 waren aber keineswegs auf die deutsche Einheit gerichtet. Sie begannen mit der Forderung, den Sozialismus in der DDR zu reformieren. Auf den Straßen Leipzigs war anfangs zu hören: »Wir bleiben hier.« Das waren jene Menschen, die im Unterschied zu den Botschaftsflüchtlingen auf eine Erneuerung der DDR setzten. Das SED-Politbüro, das Honecker leitete und dem ich angehörte, flüchtete sich jedoch in eine folgenschwere Sprachlosigkeit. Der Generalsekretär ließ dann noch trotzig mitteilen: »Die Flüchtlinge haben durch ihr Verhalten die moralischen Werte mit Füßen getreten und sich selbst aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Man sollte ihnen deshalb keine Träne nachweinen.«
Erst in Folge der Sprachlosigkeit des Politbüros gingen die Menschen mit der Losung demonstrieren »Wir sind das Volk!«. Dies war eine unüberhörbare Erinnerung daran, wer laut DDR-Verfassung im Lande eigentlich das Sagen haben sollte. Das Volk war und ist der Souverän, nicht eine einzelne Partei, ein Führungszirkel oder ein Generalsekretär. Auf der Straße waren zu dieser Zeit in der Mehrheit noch loyale, aber mit der Situation unzufriedene Bürger, darunter sehr viele SED-Mitglieder. Den meisten der Montagsdemonstranten lag das Schicksal der DDR am Herzen.
Am 9. Oktober 1989 antwortete der Schriftsteller Hermann Kant auf die Frage nach dem Besten an der DDR: »Dass es sie gibt.« Und nach dem Schlechtesten: »Dass es sie so wie derzeit gibt.«28 Diese der treffenden Bemerkung innewohnende Dialektik hatte eine Gruppe im Politbüro nicht wahrhaben wollen. Tatsache ist dennoch: Die Mehrheit von denen, die an diesem Montag, dem 9. Oktober 1989, demonstrierten, forderten nicht die Beseitigung der DDR. Ein geflügeltes Wort war: »Wir wollen eine bessere DDR«.
Einer der Protagonisten jener Zeit, der Wittenberger Theologe Friedrich Schorlemmer, drückte dies mit den Worten aus, es ginge nicht um die »Emeritierung des Sozialismus, sondern um seine Erneuerung«.29
Als Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, der Theologe Dr. Peter Zimmermann, der Kabarettist Bernd-Lutz Lange sowie die Sekretäre des SED-Bezirksleitung Leipzig Dr. Kurt Meier, Jochen Pommert und Dr. Roland Wötzel am 9. Oktober die Leipziger Bevölkerung zur Besonnenheit aufriefen, forderten auch sie nicht die Beseitigung der DDR, sondern: »Wir alle brauchen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land.«30
In diesem Aufruf findet sich übrigens kein Wort der Mahnung oder gar Warnung an die DDR-Führung, sie solle es unterlassen, gegen die Demonstranten vorzugehen. Hätte es tatsächlich Anzeichen dafür gegeben, dass die Staatsmacht ihr Gewaltmonopol rücksichtslos einsetzen würde, hätten sich die »Leipziger Sechs« wahrscheinlich mit all ihrer Energie und Autorität dagegen gewandt.
Prof. Walter Friedrich, Direktor des Instituts für Jugendforschung in Leipzig, gehörte zwar nicht zu den Unterzeichnern des Aufrufes, stand aber mit Roland Wötzel, einem der Initiatoren, in direktem Kontakt. Ihn informierte er auch, dass er am frühen Vormittag des 9. Oktober bei mir im Zentralkomitee der SED in Berlin gewesen war und ich ihm definitiv gesagt habe: »Es wird keine Gewalt geben. Politische Probleme müssen auch politisch gelöst werden.« Diese Entscheidung, so sagte ich, sei am 8. Oktober auf einer Beratung mit Generälen aller Sicherheitsorgane durch mich abgesprochen worden.
Mit dieser verbindlichen Zusage kehrte der Institutsdirektor nach Leipzig zurück. Er war damit gewissermaßen einer der wichtigen Informanten für die »Sechsergruppe«.
Dass es keine Gewalt geben würde, hatte ich auch der Leitung der Evangelischen Kirchen in der DDR zugesichert. Wenn einige Pfarrer später behaupteten, in Leipzig habe nach Vorstellung der SED-Führung Blut fließen sollen, legen sie falsch Zeugnis ab. Zu keinem Zeitpunkt existierten in Berlin Pläne, mit Gewalt gegen das eigene Volk vorzugehen.
Das kann ich auf meinen Eid nehmen.
Als ich am 18. Oktober 1989 als neuer SED-Generalsekretär von einer »Wende« sprach, habe ich nicht in Richtung der deutschen Einheit gedacht, sondern an eine souveräne DDR, die Bewährtes bewahren, Fehler korrigieren und den Sozialismus mit mehr Demokratie verbinden sollte. Am 4. November 1989 sprachen auf der Kundgebung auf dem Alexanderplatz in Berlin 29 Politiker, Schriftsteller, Theologen, Journalisten, Juristen, Hochschullehrer und Studenten. Nicht einer von ihnen forderte die Abschaffung der DDR. Als dann – mit kräftiger Nachhilfe und Unterstützung aus der BRD – in der zweiten Novemberhälfte 1989 zum ersten Mal in Leipzig skandiert wurde »Wir sind ein Volk«, warnten bekannte Persönlichkeiten aus der DDR vor einer Vereinnahmung der DDR durch die Bundesrepublik. In ihrem Aufruf »Für unser Land« hieß es: »Entweder können wir auf Eigenständigkeit der DDR bestehen und versuchen, mit all unseren Kräften und in Zusammenarbeit mit denjenigen Staaten und Interessengruppen, die dazu bereit sind, in unserem Land eine solidarische Gesellschaft zu entwickeln, in der Frieden und soziale Gerechtigkeit, Freiheit des einzelnen, Freizügigkeit aller und die Bewahrung der Umwelt gewährleistet sind. Oder: Wir müssen dulden, dass, veranlasst durch starke ökonomische Zwänge und durch unzumutbare Bedingungen, an die einflussreiche Kreise der Wirtschaft und Politik in der Bundesrepublik ihre Hilfe für die DDR knüpfen, ein Ausverkauf unserer materiellen und moralischen Werte beginnt und über kurz oder lang die Deutsche Demokratische Republik durch die Bundesrepublik vereinnahmt wird.
Lasst uns den ersten Weg gehen. Noch haben wir die Chance, in gleichberechtigter Nachbarschaft zu allen Staaten Europas eine sozialistische Alternative zur Bundesrepublik zu entwickeln. Noch können wir uns besinnen auf die antifaschistischen und humanistischen Ideale, von denen wir einst ausgegangen sind.«31
Die politische Breite dieses Aufrufes ist allein an den Namen der Erstunterzeichner zu erkennen: Stefan Heym, Christa Wolf, Volker Braun, Konrad Weiß, Tamara Danz, Bischof Christoph Dehmke, Friedrich Schorlemmer, Generalsuperintendent Günter Krusche, Sebastian Pflugbeil, Ulrike Poppe …
Niemand sollte nachträglich solche Bekenntnisse als Zustimmung zum Anschluss der DDR an die Bundesrepublik umdeuten. Die Erneuerung des Sozialismus in der DDR war damals noch Konsens unterschiedlicher politischer Kräfte. So hieß es zum Beispiel im Aufruf des Neuen Forum, man fordere »Spielraum für wirtschaftliche Initiative, aber keine Entartung in eine Ellenbogengesellschaft«.32
Zwanzig Jahre danach leben die Ostdeutschen in einer Gesellschaft, in der Geld mehr bedeutet als der Mensch und der Ellenbogen zum Synonym für Rücksichtslosigkeit geworden ist. Das hat wohl niemand so gewollt, der zu jener Zeit demonstrierte. 70.000 Leipziger waren es am 9. Oktober 1989. Heute finden sich eben so viele auf den Arbeitsämtern der Messestadt wieder.
Für die jetzt Herrschenden war die Losung »Wir sind das Volk« nur solange gut, wie sie auf die DDR beschränkt blieb. Für die Bundesrepublik gilt sie nicht. Wer auch nur vorsichtig darauf hinweist, dass die gegenwärtige Politik »soziale Unruhen« hervorrufen könnte, wird attackiert. Welche Rolle spielt denn hier und heute das Volk?
Am Beginn der staatlichen Einheit stand ein Verfassungsbruch. Dem Volk wurde verweigert, was im Artikel 146 des Grundgesetzes für den Fall der deutschen Einheit vorgesehen war: sich in freier Entscheidung eine Verfassung zu geben. Was kann denn das Volk heute wirklich verändern? Nicht einmal die Hoheit über ihre eigene Vergangenheit wird den Ostdeutschen gestattet. Sobald sich Menschen differenziert an die DDR erinnern und sich nicht an die Deutungsvorgaben halten, wird ihnen mit Basta-Urteilen über den Mund gefahren. Nicht selten werden sie von Außenstehenden belehrt, wie ihr Leben in der DDR angeblich gewesen sein soll.
Wo bleibt denn heute jene Freiheit der Andersdenkenden, die einst von der DDR ultimativ eingefordert wurde? Andersdenkende über die DDR, die sich nicht in die staatlich verordnete Bewusstseinsbildung einfügen wollen, werden als »Ewiggestrige«, »Nostalgiker« und »Ostalgiker«, als »Geschichtsfälscher« und »Geschichtsrevisionisten« diffamiert und als unglaubwürdig ins Abseits gestellt. Die Kanzlerin nennt sie »Spitz- oder Spitzelbuben«, die Thüringische Landtagspräsidentin unterstellt ihnen gar Anflüge von Demenz. Der SPD-Vorsitzende Müntefering bescheinigt seinen ostdeutschen »Brüdern und Schwestern« zwar, sie hätten im Allgemeinen »keinen Dreck am Stecken«. Wer aber die DDR nicht aus einer »Drecksperspektive« sieht, hat auch für ihn auf der falschen Seite gelebt.
Noch ist zwar die Idee, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die leugnen, dass die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei, nicht in die Tat umgesetzt worden. Aber allein dass so etwas offiziell gefordert wurde, zeigt, wie vergiftet die Atmosphäre der politischen Auseinandersetzung gegenwärtig ist. Selbst Konrad Adenauer hat Vorhaben dieser Art schon 1956 zurückgewiesen: »Die Errichtung eines neuen Regierungssystems darf […] in keinem Teile Deutschlands zu einer politischen Verfolgung der Anhänger des alten Systems führen. Aus diesem Grunde sollte nach Auffassung der Bundesregierung dafür Sorge getragen werden, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands niemand wegen seiner politischen Gesinnung oder nur, weil er in Behörden oder politischen Organisationen eines Teils Deutschlands tätig gewesen ist, verfolgt wird.«33
2009 ist Großwahljahr. Mit allen Mitteln wird um die Gunst der Ostdeutschen gebuhlt. Ihre Stimmen könnten ja das Zünglein an der Waage sein. Da entdecken die bürgerlichen Parteien samt SPD termingerecht die »liebenswerten Seiten« der Ostdeutschen. Sie loben deren Bescheidenheit, ihre Freundlichkeit, den Fleiß und ihren Arbeitseifer. Sogar Kinkels Delegitimierungsauftrag wird beim »normalen« DDR-Bürger außer Vollzug gesetzt. Die Menschen in der DDR, heißt es, seien ja in Ordnung. Sie hätten ein ganz alltägliches Leben geführt. Selbst die Verkehrsregeln und die Eheverträge seinen korrekt gewesen. Sonst hätte man ja in der Bundesrepublik neu heiraten müssen, erklärte die aus der DDR stammende Regierungschefin. Nur das System habe eben nichts getaugt.
Wird da etwa die Achtung vor den Leistungen der Ostdeutschen doch noch Staatsdoktrin? Falsch! Gemeint ist die Anerkennung erfolgreichen »Nischenlebens«, umgeben von gesellschaftlichem Unglück im Sozialismus. Würden die individuellen Leistungen in der Summe als gesellschaftliche Leistungen des Staates DDR gewürdigt werden, dann würden ja die von den Herrschenden nicht gewollten Erinnerungen an Vollbeschäftigung, menschliche Solidarität, ein bezahlbares Alltagsleben ohne Hartz IV, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Chancengleichheit für alle Kinder aufgerechnet werden gegen die Lebensqualität der Gegenwart.
Und auch das ist klar: Wenn selbsternannte parteipolitische Deuter von DDR-Biografien plötzlich auch das Gute im DDR-Menschen entdecken, dann sind von dieser Anerkennung jene ausgenommen, die nicht bereit sind, sich auf diese oder jene Weise von der DDR zu distanzieren. Deren Stimmen gelten bei Wahlen ohnehin als verloren. Die bürgerlichen Parteien verfolgen erkennbar eine Doppelstrategie: Abwertung und Diffamierung des Staates DDR einerseits und Schmeicheleien und Komplimente an die ostdeutschen Wähler andererseits.
Was ist das nur für eine schlimme Streitkultur? Noch dazu in einem Jahr, wo man vorgibt, die Friedlichkeit einer Revolution feiern zu wollen? Sollte nicht jeder, der in der DDR gelebt hat, selbst beurteilen dürfen, wie er sein Leben sieht? Die Deutungshoheit über die DDR-Geschichte liegt beim Volk. Nicht beim Bundespräsidenten, nicht bei der Bundeskanzlerin, nicht bei Behörden und Kommissionen, nicht bei »Bürgerrechtlern« und selbstverständlich auch nicht bei mir. Frühere DDR-Bürger sind in der Lage, ihr gelebtes Leben frei von politischen Zwängen und Zwecken zu beurteilen. Sie müssen nichts rechtfertigen und verteidigen, was nicht gerechtfertigt und verteidigt gehört. Sie müssen auch nichts attackieren und kritisieren, nur weil dies der Zeitgeist von ihnen verlangt. Sie haben es nicht nötig, sich von Zugereisten ihr Leben erklären zu lassen. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Urteile der Bürger, die in der DDR zu Hause waren, läge wohl auch im Sinne des Leitgedankens von 1989: »Wir sind das Volk.«
Die Verleumder der DDR sollten endlich respektieren, dass es heute wahrscheinlich so viele Sichten auf die DDR gibt, wie einst Menschen hier lebten. Jede Erinnerung ist individuell. Es kann und darf nicht sein, die Sicht einiger oder auch bestimmter Gruppen zur Auffassung aller zu erheben. Aber gerade das geschieht fortgesetzt.
In letzter Zeit werde ich wiederholt als eine Art Kronzeuge benannt, obwohl ich für den falschen Sachverhalt, der behauptet wird, weder hafte noch als Zeuge tauge. Ein CDU-Parteitag und der Bundespräsident berufen sich in trauter Einigkeit auf eine Analyse der ökonomischen Situation der DDR vom Oktober 198934, die ich seinerzeit in Auftrag gegeben hatte. Darin werde festgestellt, heißt es, »dass aufgrund des dramatischen Schuldenstands im kapitalistischen Ausland bereits 1990 mit der Zahlungsunfähigkeit der DDR zu rechnen war, die nur noch mit drastischen Maßnahmen wie einer Senkung des Lebensstandards um 25 bis 30 Prozent zu stoppen war«. Dies habe die DDR »faktisch unregierbar« gemacht. Folglich, so die Interpreten, habe die DDR im Jahr 1989 kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch gestanden.
Ich leitete damals die Sitzung des Politbüros, auf der das 24-seitige Papier behandelt wurde. Im vorliegenden Buch berichte ich darüber unter dem Datum 30. Oktober 1989. Die Befürchtung, die DDR könne »unregierbar« werden, hing mit der Rolle des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank zusammen. Die Einreicher der Vorlage hatten Sorge, diese Institutionen könnten auch Zugriff auf die DDR bekommen, wie schon vorher auf Polen und Ungarn. Deren »Reformanweisungen« hätten dann tatsächlich einen außergewöhnlichen Einschnitt in den Lebensstandard der DDR-Bürger bedeutet. Gerade das sollte mit den in der Analyse benannten Problemlösungen verhindert werden.
Das Papier war keine Kapitulation, sondern ein Wegweiser, wie eine souveräne DDR mit den Schwierigkeiten aus eigener Kraft hätte fertig werden können. Die DDR stand 1989 nicht vor einem »wirtschaftlichen Zusammenbruch«. Die Analyse fußte auf der Absicht ihrer Autoren, die Partei- und Staatsführung zu einer sozialistischen Wirtschaftsreform zu drängen. Ihr Hauptproblem war, Leistung und Verbrauch wieder in Übereinstimmung zu bringen. Für den Fall, dass dies nicht gelingen würde – und nur dafür – prognostizierten Schürer und seine Mitautoren die Gefährdung der Zahlungsbilanz der DDR. Tatsächlich hat es diese aber nicht gegeben.
Das geht sogar aus einer offiziellen Verlautbarung der Deutschen Bundesbank über die Verschuldung der DDR hervor.35 »Ende 1989«, so heißt es darin, »betrug die Nettoverschuldung 19,9 Milliarden Valutamark«.
Das sind etwa 30 Milliarden Valutamark weniger als im vergilbten »Schürer-Papier« enthalten sind, das heute wie die letzte Wahrheit über die DDR zitiert wird. In Euro umgerechnet sind dies nicht einmal zehn Milliarden.
Davon, das weiß der Ökonom Köhler sehr wohl, geht kein Staat bankrott. Im Vergleich zur Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland von über 1,5 Billionen Euro relativieren sich die DDR-Zahlen erheblich. Mit über 86 Milliarden Euro erreicht die Bundesrepublik die höchste Neuverschuldung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist für nur ein Jahr mehr als achtmal soviel, wie die DDR insgesamt Schulden hinterließ.
Der wirkliche Kollaps der DDR-Industrie ereignete sich zudem nicht zu DDR-Zeiten, sondern erst nach 1990. Binnen dreier Jahre ging das DDR-Industrie-Potenzial um 70 Prozent, das der industriellen Forschung sogar um 80 Prozent zurück. Und vor allem: Die Eigentumsverhältnisse wurden auf dem Territorium der DDR radikal zu Gunsten des Privatkapitals geändert. Kein DDR-Bürger hat von dem auch durch ihn geschaffenen und von Privatfirmen meist zu Spottpreisen einverleibten DDR-Vermögen auch nur einen Pfennig gesehen.
Könnte es vielleicht sein, dass die Regierenden von Anfang an die DDR-Wirtschaft als marode bezeichneten, damit sie sie für ‘nen Appel und ‘n Ei verhökern konnten? Oder auch, um ihre eigenen Vergehen bei der Übernahme der DDR zu verdecken? Zuständig für die Treuhand war immerhin der Staatsekretär im Finanzministerium Horst Köhler, heute Bundespräsident.
Der erste Treuhandchef Detlev Karsten Rohwedder hatte gegenüber Edgar Most36, wie ich dessen Memoiren entnehme, erklärt: »Ich gehe davon aus, 70 bis 80 Prozent der DDR-Betriebe bleiben erhalten, wenn nicht sogar mehr.«37 Rohwedder wurde am 1. April 1991 von bisher noch immer nicht ermittelten Tätern ermordet. Danach übernahm Frau Breuel die Bundesbehörde und korrigierte die Rohwedder-Linie. An die Stelle der Sanierung trat nun die radikale Privatisierung. »Ohne Not die Industrie eines Landes zu vernichten, empfinde ich als menschenverachtende Geste gegenüber der ehemaligen DDR-Bevölkerung«, konstatiert der ehemalige Deutsch-Banker Edgar Most. Er kommt bezüglich der Folgen zu dem erhellenden Schluss: »Der Aufbau Ost bedeutete eine entschiedene Stabilisierung West. Denn das war ein zusätzlicher Markt mit 17 Millionen Menschen (plus Marktgebiete Osteuropa), Realisierung von Investitionen Ost durch Unternehmen West zuzüglich der Leistungen von Architekten, Ingenieuren, Vermessern etc. in großem Umfang, Ausbau des Dienstleistungsbereiches: Rechtsanwälte, Unternehmensberatungen, Banken, Versicherungen, Steuerberater usw., Besetzung von Verwaltungen des öffentlichen Sektors, von Stellen in Universitäten, Hoch und Fachschulen …«38
Das alles wird verschleiert, indem die DDR-Volkswirtschaft einfach für marode erklärt wird.
Aufmerksam verfolge ich die aktuelle Berichterstattung über den 9. November 1989. Wenn mein Eindruck nicht trügt, wird er quasi zum bedeutendsten Gedenktag des 20. Jahrhunderts hoch geredet und hoch geschrieben. Zum einem solchen Superfest eignet sich dieser Tag aber nicht. Man bedenke nur, welchen Platz er in der wechselvollen deutschen Geschichte einnimmt. Der 9. November 1938 war Auftakt zu einem der schrecklichsten Verbrechen überhaupt, dem Völkermord an den Juden. Das Unglück der Deutschen war also nicht die DDR, sondern der deutsche Faschismus, den ich aus guten Gründen nicht, wie in der Bundesrepublik üblich, Nationalsozialismus nenne. Er war weder national noch sozialistisch.
Auch deshalb bedauere ich, dass ein anderes wichtiges Datum dieses Jahres im Verhältnis zum 9. November 1989 im Vorfeld nur eine untergeordnete Rolle spiel: der 1. September, der 70. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen, der den Zweiten Weltkrieg auslöste. Es gibt starke Kräfte in Deutschland, die die Verbrechen des faschistischen Deutschland im Zweiten Weltkrieg durch allerlei Legenden relativieren. Dabei vermittelt dieses Datum eine wichtige Lehre, die heutzutage leider kaum noch ausgesprochen wird: Ohne den von Deutschland ausgelösten Krieg hätte es keine Flüchtlingstrecks aus Ost- und Westpreußen, Pommern und Schlesien gegeben, keine Besatzung durch fremde Truppen und keine Teilung in Zonen, folglich auch keine Grenze quer durch Deutschland und Berlin. Und darum auch keine zwei deutschen Staaten.
Die Kausalkette zieht sich durch die deutsche Geschichte. Ohne 1933 kein 1939. Ohne jenen 1. September 1939 keinen 8. Mai 1945. Ohne Beginn des Kalten Krieges 1946 kein 1. Juli 1948, als die Militärgouverneure der drei Westmächte den westdeutschen Ministerpräsidenten den Auftrag zur Gründung eines Weststaates erteilten. Ohne diese Vorgabe keine Konstituierung der Bundesrepublik am 23. Mai 1949 und darauf folgend die Bildung der Deutschen Demokratischen Republik am 7. Oktober 1949 …
Vor einigen Wochen offenbarte ein Journalist, seine Frage nach dem Zeitpunkt der Grenzöffnung auf der Pressekonferenz am 9. November 1989 an Schabowski sei gar nicht spontan gewesen. Er teilte mit, er habe zuvor telefonisch einen Hinweis vom Chef der DDR-Nachrichtenagentur ADN erhalten. Nun, Günter Pötschke, den ich sehr schätzte, ist inzwischen leider tot, und Schabowski wird den Deibel tun, den ihm verliehenen Lorbeer als »Grenzöffner« von sich zu werfen. Ob es so war, wie der Italiener es sagt, oder nicht, ist für die Sache auch unbedeutend. Halten wir uns an Fakten: Nicht die Frage eines Journalisten war der Auslöser der vom 10. auf den 9. November vorverlegten Grenzöffnung. Es war Schabowskis falsche Antwort.
Einige Stunden vor der Pressekonferenz hatte ich auf einer Tagung des SED-Zentralkomitees die neue Reiseverordnung verlesen. Sie besagte, dass alle DDR-Bürger ab dem 10. November 1989 frei reisen können. Nach ihrer Bestätigung auch durch das Parteigremium übergab ich das gleiche Exemplar, aus dem ich vorgelesen hatte, an meinen damaligen Genossen Schabowski. Jenen »berühmten Zettel« also, dessen Urheberschaft manche mal dem KGB, mal der CIA, mal dem MfS oder auch dem BND andichten. Schabowski hatte die Reiseverordnung jedoch von mir. Allerdings mit dem Auftrag, den Beschluss auf der internationalen Pressekonferenz exakt vorzustellen. Statt ihn zu erläutern, antwortete er erst kurz vor Ende der Pressekonferenz auf die bekannte Frage nach dem Zeitpunkt der Grenzöffnung ziemlich verwirrt: »Sofort! Unverzüglich!«
Korrekt wäre gewesen: »Ab 10. November!« oder: »Ab morgen«.
Von der Fehlleistung meines Politbürogenossen, der anschließend ungerührt nach Wandlitz in den Feierabend fuhr, erfuhr ich erst kurz vor 21 Uhr. Meine Nervosität konnte ich in diesem Moment nur schwer verbergen. Mir war klar, dass Schabowskis Falschaussage jene Frauen und Männer, die als Angehörige der Grenztruppen, der Staatssicherheit, der Volkspolizei und der Zollverwaltung der DDR in diesen Stunden an den Grenzübergängen Dienst taten, vor eine außergewöhnliche Situation stellen würde. Im Vertrauen auf die Mitteilung in den Medien – und zwar sowohl der DDR als auch der BRD – waren viele Bürger der DDR auf dem Weg zur Grenze, als die notwendigen Befehle und Anordnungen erst zur Unterschrift vorbereitet wurden. Die Grenzer mussten also in der ersten Phase auf sich allein gestellt handeln. Was, so meine Sorge, wenn auch nur einer dieser Situation nicht gewachsen wäre? Was, wenn Überreaktion oder Panik entstünden? Was, wenn gar ein Schuss fiele?
Zum Glück trat all dies nicht ein.
Gerade deshalb sollten alle, die sich über den 9. November freuen, den verantwortlichen Kommandeuren der Grenztruppen und ihren Untergebenen vor Ort danken, statt sie zu schmähen oder, wie geschehen, vor Gericht zu zerren. Erzogen im Geiste der Friedenssicherung und der Humanität, verhinderte ihr besonnenes Verhalten einen durchaus möglichen Bürgerkrieg. Und auch das gehört zur Wahrheit dieses Tages: Die Angehörigen der Grenztruppen handelten an den Grenzübergangsstellen in engem Zusammenwirken mit den Passkontrolleinheiten. In ihnen dienten Männer und Frauen des Ministeriums für Staatssicherheit. Es ist mir kein Fall bekannt, dass auch nur einer von ihnen die Grenzsoldaten zu anderem als dem bekannten Handeln angehalten hätte. Aber sie werden alle ohne Ansehen der Person bis heute offiziell geächtet und sozial bestraft. Weder in der damaligen Partei- und Staatsführung noch bei den handelnden Personen an den Brennpunkten hat es in dieser kritischen Zeit jemals den Gedanken an Gewaltanwendung gegeben.
Ungeachtet dessen bleibt festzuhalten: Wir standen an diesem Abend einer militärischen Auseinandersetzung näher, als dies viele heute wahrhaben wollen. Das hat auch UdSSR-Präsident Gorbatschow so beurteilt. Er sprach von möglichen »militärischen Aktionen mit weitreichenden Folgen«39. Selbst Helmut Kohl nannte die Situation »dramatisch«40.
Für mich hatte dieses Ereignis eine Staats-, ja weltpolitische Dimension. Es ging schließlich um die Außengrenze der Warschauer Vertragsstaaten. In Moskau und den anderen Hauptstädten der sozialistischen Länder wusste zu diesem Zeitpunkt niemand, dass die DDR gerade dabei war, einen kollektiven Beschluss des Bündnisses, der zu den Maßnahmen vom 13. August 1961 geführt hatte, eigenmächtig außer Kraft zu setzen. Als Staatsoberhaupt stand ich vor der Frage: entweder alle Machtmittel des Staates zur Grenzsicherung einzusetzen oder den Dingen freien Lauf zu lassen. Wir haben uns bewusst gegen die Gewalt entschieden.