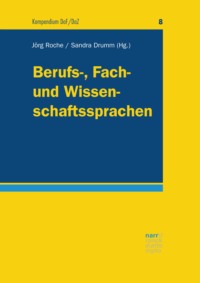Kitabı oku: «Berufs-, Fach- und Wissenschaftssprachen», sayfa 4
1.2 Gliederung der Fachsprachen
Sandra Drumm
Im vergangenen Kapitel haben wir uns damit beschäftigt, was Fachsprache überhaupt ist und wie man sie definieren kann. Nun wollen wir der Frage nachgehen, wie sich die Fachsprache unterteilen lässt und welche Kriterien für eine Gliederung sinnvoll sind. Dazu müssen wir davon ausgehen, dass es nicht nur eine Fachsprache gibt, sondern unterschiedliche Ausprägungen. Aber sind dies tatsächlich unterschiedliche Fachsprachen? Oder handelt es sich lediglich um Varianten einer Fachsprache? Und wie kann man diese Unterschiede greifbar machen, um im Fremdsprachenunterricht darauf einzugehen? Diesen Fragen wollen wir in diesem Kapitel nachgehen. Die Forschung hat unterschiedliche Einteilungen entwickelt, um bestimmte fachsprachliche Phänomene unterschiedlichen Ebenen zuzuordnen und so ein System herauszubilden, das alle fachsprachlichen Aussagen und Texte umfasst. Zunächst befassen wir uns mit diesen unterschiedlichen Ordnungssystemen von Fachsprachen. Dabei betrachten wir zuerst die Unterteilung anhand der ihnen zugehörigen Fächer. und gehen im Anschluss auf die innersprachliche Schichtung einer Fachsprache ein. Den Abschluss bildet eine Einteilung anhand von Sprachverwendungssituationen und Textsorten
Lernziele
In dieser Lerneinheit möchten wir erreichen, dass Sie
aus der Ordnung der Fächer einzelne Fachsprachen ableiten und zuordnen können;
einzelne Fachsprachen intern gliedern und deren Abstraktionsgrad bestimmen können;
Textsorten kennen und deren Bedeutung für den Unterricht einschätzen können;
von der Unterscheidung in einzelne Subsprachen Ableitungen auf die Gestaltung von Unterricht treffen und begründen können.
1.2.1 Horizontale Gliederung
Bei der Einteilung von Fachsprachen lohnt es sich, erneut einen Blick auf den grundlegenden Begriff zu werfen und zu untersuchen, wie sich einzelne Fächer entwickelten. Die Unterteilung in Fächer ist noch nicht sehr alt und erst seit dem 19. Jahrhundert in schriftlichen Quellen belegt, doch der damit gemeinte Sachverhalt – die Verbindung von Wissen und Können in einem bestimmten Bereich – ist weitaus älter. Schon in frühhistorischer Zeit zeichnen sich Kulturen durch Arbeitsteilung aus, durch die sich effektiver wirtschaften lässt. Damit einher geht eine gewisse Professionalisierung, die im Laufe der Zeit zunimmt und bestimmte Gruppen prägt. Aus Personen, die bestimmte Tätigkeitsfelder bestellen, werden Fachleute. Dabei werden schon früh mehr theoretische und mehr praktische Felder unterschieden (vergleiche Möhn & Pelka 1984: 30f). Die so entstehenden Berufe bilden die Basis für fachliche Spezifizierung und Differenzierung, die schließlich zu eigenen sprachlichen Formen führt. Die zunehmende Koordination von Arbeitsteilung umfasst eine fortschreitende Zerlegung von immer komplexer werdenden Arbeitsschritten. Dies gewinnt durch die im 18. Jahrhundert einsetzende Mechanisierung ein neues Bewegungsmoment und gipfelt in der heutigen Vielzahl von Fächern der Wissenschaft und Praxis. Doch nicht nur beruflich und wissenschaftlich sind Fächer auszumachen. Mit der Erfindung der Freizeit wird es möglich, Tätigkeiten als Hobby zu betreiben, die schließlich ein eigenes Professionalitätsniveau erreichen. Diese Prozesse, die immer neue Fachsprachen und Untersprachen hervorbringen, sind längst nicht abgeschlossen, sondern werden durch digitale Technik und Datenverarbeitung auf völlig neue Kontexte ausgedehnt (vergleiche Möhn & Pelka 1984: 32f).
Es scheint sinnvoll, wenn wir uns im Vorfeld des Unterrichts Gedanken dazu machen, was das Fach, dessen Fachsprache gelernt werden soll, charakterisiert. Wir haben uns in der Lerneinheit 1.1 der Frage, was Fachsprachen sind, dadurch genähert, dass wir den zugrundeliegenden Begriff genauer bestimmt haben. So sind wir zu dem Schluss gelangt, dass mit Fächern Fachleute verknüpft sind, die bestimmte fachliche Gegenstände sprachlich und nichtsprachlich behandeln. Damit einher geht die Abgrenzung von Gruppen zu anderen Gruppen durch deren Fachbezogenheit: Bauingenieure und Bauingenieurinnen grenzen sich durch Verwendung von Zeichen und die behandelten Gegenstände von Maschinenbau-Ingenieurinnen und Maschinenbau-Ingenieuren ab; beide wiederum haben Gemeinsamkeiten, die sie von Philosophen und Philosophinnen und Historikerinnen und Historikern abhebt. Gleiches gilt für die Fachsprachen: Die Fachsprache der Ingenieure und Ingenieurinnen weist Gemeinsamkeiten auf, die sie von der Fachsprache der Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen unterscheidet. Beide Fachsprachen stellen aber eine spezifische Auswahl aus dem Inventar der AllgemeinspracheAllgemeinsprache Deutsch dar, weisen also auch Gemeinsamkeiten mit Allgemeinsprache und anderen Fachsprachen auf (vergleiche Abbildung 1.6).
 Abbildung 1.6:
Abbildung 1.6:
Horizontale Gliederung der Fachsprachen
Eine Unterteilung der Fachbereiche und der dazugehörigen Fächer ermöglicht es, die unterschiedlichen Ausprägungen von Fachsprachen zu verdeutlichen. Die sogenannte horizontale Gliederung der Fachsprachen folgt den Fächergliederungen und Fachbereichseinteilungen. Dabei ist zu beachten, dass diese Einteilungen unabhängig von sprachlichen Erscheinungen zustande kommen. Fächer entwickeln sich stetig weiter, indem zum Beispiel neue technische Möglichkeiten entwickelt und neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. Dies wollen wir uns an einem Beispiel genauer ansehen.
Mit der Entwicklung des Automobils und dessen Verbreitung als Privatfahrzeug ging die Notwendigkeit einher, diese privaten Fahrzeuge zu reparieren. Es entstand der Beruf des KFZ-Mechanikers und der KFZ-Mechanikerin, der oder die, in privaten Werkstätten angestellt, Autos repariert. Diese Gruppe entwickelte eine eigene Fachsprache, um Gegenstände und Handlungen im Berufsfeld zu benennen. Mit der fortschreitenden Digitalisierung verändert sich das Berufsfeld jedoch rasant, was unter anderem in der veränderten Bezeichnung des Berufs zum Ausdruck kommt: KFZ-Mechatroniker und KFZ-Mechatronikerin. In diesem Zuge verändern sich auch die Benennungen und Handlungen im Arbeitsumfeld und damit die Fachsprache. Die sprachliche Entwicklung ist also von den Entwicklungen im Fach abhängig. Nebeneinander existierende oder sich aus anderen Fächern heraus entwickelnde Fächer weisen Gemeinsamkeiten in den Fachsprachen auf, beispielsweise in Überschneidungen der Lexik und ähnlichen syntaktischen Mitteln. Die Entwicklung der Fächer wiederum unterliegt fächergeschichtlichen und fächerpolitischen Bedingungen.
Fachsprachen sind eng an das Fach gebunden, in dem sie verwendet werden, verbinden aber auch benachbarte Fächer miteinander. Sie haben den Vorteil, dass sie für Fachleute relativ klar organisiert und motiviert sind. Nur wenige syntaktische Regeln werden im Rahmen einer Fachsprache intensiv genutzt, weshalb nicht so viele verschiedene wie im allgemeinsprachlichen Unterricht zu lernen sind. Sind bei den Lernern fachbegriffliche Kenntnisse, besonders bezogen auf das Verständnis der dahinterliegenden Konzepte, bereits vorhanden, kann das Hauptaugenmerk auf die terminologische Arbeit gerichtet werden (vergleiche Thielmann 2010: 1057). Deshalb müssen Lerner besonders die Abgrenzung der eigenen Fachsprache zu benachbarten kennen.
Die horizontale Gliederunghorizontale Gliederung sortiert, wie erläutert wurde, Fachsprachen anhand ihrer Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Fächern. Problematisch ist dabei, dass nicht jedes Fach eine eigene Fachsprache hat. Manche Fächer liegen inhaltlich so nah beieinander, dass die Behandlung der Gegenstände sich sehr ähnelt. Da Fachsprache eine sprachliche Form der Behandlung fachlicher Gegenstände ist, ergibt sich daraus, dass sich auch die Fachsprachen einander sehr ähnlicher Fächer kaum unterscheiden. Eine zu feine Einteilung ergibt in solchen Fällen wenig Sinn. Eine horizontale Betrachtung lohnt sich immer dann besonders, wenn es sich um voneinander entfernte Fächer handelt. Die Gegenstände und Arbeit der Philosophie unterscheiden sich von denen des Maschinenbaus, und ebenso unterscheiden sich deren Fachsprachen. Diesen unterschiedlichen Ausprägungen wollen wir uns in den Kapiteln 6, 7 und 8 diesem Band zuwenden.
1.2.2 Vertikale Gliederung von Fachsprachen
Neben der horizontalen Gliederung, die Fachsprachen anhand ihrer Zuordnung zu einzelnen Fächern unterscheidet, gibt es auch die Möglichkeit einer vertikalenvertikale Gliederung von Fachsprachen Schichtung von Fachsprache. Diese folgt nicht der Fächereinteilung, sondern betrachtet die unterschiedlichen kommunikativen Ebenen innerhalb eines einzelnen Faches. Das wollen wir uns an einem Beispiel ansehen.
 Abbildung 1.7:
Abbildung 1.7:
Beispiel aus einem universitären Chemie-Lehrwerk (Kurzweil 2015: 185f)
 Abbildung 1.8:
Abbildung 1.8:
Beispiel aus einem schulischen Chemie-Lehrwerk (Kanz & Moll 2013: 85)
Fachliche Texte lassen sich anhand ihres Wortschatzes und ihren speziellen Redewendungen und Strukturen klar von anderen Sprachformen unterscheiden (vergleiche Roche 2008a: 162). Der erste Text ist in der universitären Lehre angesiedelt. Er ist abstrakt formuliert und verwendet in hohem Maße Fachvokabular. Außerdem nutzt er Symbole, die stellvertretend für Zusammenhänge stehen. Die Sätze sind komplex und beinhalten kompakte Strukturen. Des Weiteren setzt der Text für das Verständnis der Inhalte Wissen voraus. Der zweite Text hingegen richtet sich an Schüler und Schülerinnen mit geringen Vorkenntnissen. Er verwendet Begriffe, die auch in der Alltagsprache vorkommen, und schließt damit an die Alltagserfahrung an. Außerdem ist er weit weniger komplex und verdichtet formuliert als Abbildung 1.7. Würde man beide Texte auf einem Kontinuum mit steigender Abstraktion und Komplexität anordnen, wäre der zweite Text sehr viel weiter unten anzusiedeln. Wie die beiden Textbeispiele zeigen, treten Fachsprachen in verschiedenen Komplexitätsstufen auf, je nach Sprecher- und Adressatengruppe, Kommunikationsfunktion oder Inhaltsdichte. Fachsprache in Schule und Ausbildung ist notwendigerweise immer weniger komplex und verdichtet als der DiskursDiskurs der betreffenden Wissenschaftsdisziplin (vergleiche Roche 2008a: 162).
Wie sich an diesem Beispiel erkennen lässt, bewegt sich die Unterteilung innerhalb einer einzelnen Fachsprache zwischen den Polen konkret und abstrakt beziehungsweise spezifisch und allgemein. Mit zunehmender Abstraktion und Allgemeingültigkeit des Gegenstands nimmt die sprachliche Abstraktion und Dichte zu. Sprache wird mit steigender Ebene komplexer, kontextenthobener und für Laien schwieriger verständlich. Die unterschiedlichen Abstraktionsstufen unterscheiden sich auch in der Verwendung der Begriffe. Je fachlicher ein Text, desto festgelegter sind die verwendeten Begriffe. Dies findet seinen Höhepunkt in der Wissenschaftskommunikation: Wissenschaftssprache hat zum Ziel, Tatsachen festzustellen und Aussagen zu prüfen, woraus sich die Notwendigkeit zu starker Normierung ergibt (vergleiche Roche 2008a: 161). Hinter Fachsprachen steht das Ziel der möglichst ökonomischen und reibungslosen Kommunikation (siehe auch Lerneinheit 1.3). In dieser Hinsicht lässt sich also ein steigender Abstraktionsgrad zwischen unterschiedlichen Fachsprachen beobachten.
Es liegen in der Fachsprachenlinguistik unterschiedliche Vorschläge zur vertikalen Gliederung vor. Im Folgenden wird die von Hoffmann (1985) entwickelte Einteilung vorgestellt, da sie für unsere Zwecke am besten nutzbar ist. Hoffmann unterscheidet fünf mögliche Abstraktionsstufen innerhalb einer Fachsprache.
 Abbildung 1.9:
Abbildung 1.9:
Abstraktionsgrade der Fachkommunikation nach Hoffmann (1985)
Die Sprache der theoretischen Grundlagenwissenschaften nimmt die höchste Abstraktionsstufe ein. Sie beinhaltet alltägliche sprachliche Mittel nur in geringer Frequenz, dafür macht sie umfangreichen Gebrauch von künstlichen Symbolen für Elemente wie beispielsweise Relationen. Verwendet wird sie hauptsächlich von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um wissenschaftliche Thesen und Erkenntnisse auf theoretischer Ebene zu debattieren.
Die nächste, ebenfalls hoch abstrakte Ebene bezeichnet Hoffmann (1985) als Sprache der experimentellen Wissenschaften. Auch hier finden sich künstliche Symbole für die Bezeichnung von Elementen, die Relationen werden aber in natürlicher Sprache ausgedrückt. Kommunikative Verwendung findet diese Sprache zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Technikerinnen und Technikern. Ziel ist es, theoretische Erkenntnisse in Experimenten zu bestätigen, wozu Hypothesen in konkrete Aufbauten überführt werden müssen.
Als dritte, ebenfalls hoch abstrakte Stufe ist die Sprache der angewandten Wissenschaften und der Technik zu bezeichnen. Die Sprache ist in weiten Teilen natürlich mit starker Tendenz zur Terminologisierung und einer spezifischen Syntax (zum Beispiel Passivkonstruktionen, Funktionsverbgefügen und so weiter). Sie dient der Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Technikerinnen und Technikern und Produktionsleitenden. Die praktische Anwendbarkeit erreicht hier ein neues Niveau, da nun wissenschaftliche Erkenntnisse für praktische Zwecke nutzbar gemacht werden sollen, was veränderte Ansprüche an Fachkommunikation stellt.
Die vierte Abstraktionsstufe wird von Hoffmann (1985) als niedrige charakterisiert und als Sprache der materiellen Produktion bezeichnet. Es handelt sich dabei um natürliche Sprache mit verhältnismäßig starker Terminologisierung und vergleichsweise unverbindlicher Syntax. Verwendung findet diese Fachsprache zwischen Produktionsleitenden und ausgebildeten Fachkräften der Produktion. Sie dient der Kommunikation über technische Abläufe und Bedingung zur Herstellung, Aufarbeitung, Reparatur und so weiter.
Die fünfte und niedrigste Abstraktionsstufe ist die Sprache der Konsumption. Natürliche Sprache mit wenigen (Fach-)Termini und weitgehend unverbindlicher Syntax sind für sie kennzeichnend. Sie wird von Mitgliedern der Produktion, des Handels und schließlich den Konsumenten und Konsumentinnen selbst verwendet. Ihr Zweck ist die Kommunikation über Gegenstände, die in arbeitsteiligen Prozessen hergestellt oder anderweitig behandelt worden sind und nun verkauft werden.
Fachbegriffe diffundieren durch die einzelnen Schichten nach unten und gehen in die alltägliche Sprache über. Was vor 20 Jahren von einer spezialisierten Gruppe von Theoretikern und Theoretikerinnen entwickelt wurde, ist heute Allgemeingut – und das gilt ebenso für die Fachsprache. Das bedeutet, dass die genannten Schichten der vertikalen Ausrichtung nicht undurchlässig sind und sich in stetiger Veränderung befinden. Was vor 50 Jahren noch für viele Menschen unbekannt und damit unverständlich war, ist aktuell möglicherweise Allgemeinwissen. Begriffe als inhaltliche Konzepte stellen den Kern der fachsprachlichen Texte dar und können für Lerner wichtige Verstehensinseln bieten. Gerade Lerner, die bereits fachliche Kenntnisse haben, können dies nutzen, um sich eine Orientierung über den Textinhalt zu verschaffen, ehe sie diesen tatsächlich zu lesen beginnen. Aber: Fächer sind dynamische Konstrukte, die sich mit der Zeit verändern, und ebenso verändert sich ihre Fachsprache. Besonders der Bereich der Lexik ist davon betroffen, da ehemals rein fachsprachliche Begriffe in die Alltagsprache eingehen und dort mitunter eine weniger spezifische Bedeutung erlangen.
Für den Fremdsprachenunterricht ist bedeutsam, dass unterschiedliche Abstraktionsstufen in den Unterricht eingebunden werden. Fachleute müssen stets auf mehr als einer Ebene sprachlich kompetent sein, da sie mit Personen der anderen Ebenen kommunizieren müssen. Daher sollten Texte unterschiedlicher Zielrichtung für ein Fachgebiet ausgewählt und behandelt werden. Das sind einerseits theoretische Beispiele, aber andererseits auch praktische Handreichungen.
Bei der Einteilung von Fachsprachen tritt ein Problem auf, dass auch für den Unterricht bedeutsam ist. Die Einteilung wird von Sprachforschern und Sprachforscherinnen vorgenommen, die in erster Linie Linguisten und Linguistinnen sind. Bezogen auf das Fach und dessen Inhalte stellen sie aber häufig Laien dar. Die genannten Einteilungen entbehren also häufig einer Insiderperspektive. Auch Sprachlehrerinnen und Sprachlehrer besitzen in der Regel nicht die fachliche und fachkommunikative Kompetenz im betreffenden Fach, die nötig wäre, um die Ausrichtung des Unterrichts auf die fachlichen Inhalte sinnvoll zu gestalten. Umgekehrt verfügen die inhaltlichen Experten und Expertinnen des Faches nur in seltenen Fällen über die nötige sprachdidaktische Kompetenz, um die sprachliche Seite des Faches zu vermitteln (vergleiche Roche 2003: 153). Es stellt sich also die Frage, wie viel Fachwissen der Sprachunterricht benötigt, um fachbezogen Sprachkenntnisse zu vermitteln. Wenn Sie bereits fachorientierten Sprachunterricht gegeben haben, kennen Sie diese Problematik sicher aus Ihrem eigenen Unterricht.
Da wir Sprachlehrkräfte häufig weniger über das Fach wissen als unsere Lerner, ist es sinnvoll, diese als Experten und Expertinnen für die fachlichen Gegenstände in den Unterricht einzubeziehen. Bevor fachliche Texte und Kommunikationssituationen behandelt werden, kann es ertragreich sein, zuerst die Ziele des Faches (abgesehen von Sprache lernen) zu thematisieren. Was wird im Fach auf welche Weise getan und welche Mittel werden dabei verwendet? Was sind zentrale Textsorten? Anhand dieser gemeinsam erarbeiteten Zielsetzungen können dann sprachliche Mittel gesucht und begründet werden. Dennoch ist es für uns Lehrkräfte ebenso sinnvoll, das Fach, dessen Sprache gelernt werden soll, vor dem Beginn des Unterrichts grob einzuteilen. Roelcke (2010) präsentiert ein Modell der Einteilung von Fachsprachen, das sowohl horizontale als auch vertikale Zuteilungen ermöglicht. Es hat den Vorteil, dass es abstrakt genug bleibt, um handhabbar zu sein, aber genau genug unterteilt, um eine Vorstellung von der Fülle der fachsprachlichen Varianten zu vermitteln.
 Abbildung 1.10:
Abbildung 1.10:
Gliederung der Fachsprachen (Roelcke 2010: 31)
Fachsprachen lassen sich demnach grob unterteilen in Theorie- und Praxissprache. Die Theoriesprache wiederum betrifft vor allem die Fachsprache der Wissenschaft, die ihrerseits in die beiden Bereiche Natur- und Geisteswissenschaft unterteilt werden kann. Ein Teil der Theoriesprache betrifft auch die Sprache der Technik, besonders da auch Technik mittlerweile wissenschaftlich aufgearbeitet wird.
Wie wir gesehen haben, lassen sich fachsprachliche Erscheinungen auf unterschiedliche Arten und Weisen gruppieren und einer Analyse zugänglich machen. Dazu zählt auch die Einteilung in Textsorten, die im Fach Verwendung finden.
1.2.3 Fachliche Textsorten
Als Textsorte bezeichnet man eine Gruppe von Texten, die bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben, die sie von anderen unterscheiden. So sind Briefe zum Beispiel immer mit einer Anrede und Grußformel versehen, Gesetzestexte hingegen nicht. Die Eigenschaften können textexterne und textinterne Kriterien sein. Textexterne Kriterientextexterne Kriterien sind zum Beispiel die Textfunktion, der Kommunikationskanal und die Kommunikationssituation, in der ein Text entsteht. Textinterne Kriterientextinterne Kriterien sind zum Beispiel der Wortschatz und das Satzbaumuster.
 Abbildung 1.11:
Abbildung 1.11:
Beispiel zur Bestimmung von fachlichen Textsorten (Bayer 2015)

Bei diesem Textausschnitt handelt es sich ganz eindeutig um eine Packungsbeilage, die die Einnahme eines Medikaments erläutert und auf eventuelle Risiken hinweist. Typisch für die vorliegende Textsorte ist die Unterteilung in Zweck des Medikaments und zu beachtende Punkte.
Textinterne Kriterien sind die immer wiederkehrende Wiederholung des Markennamens Aspirin, bestimmte Floskeln (vor der Einnahme), Fachwörter (Acetylsalicylsäure) und die Nutzung von zahlreichen Aufzählungen. Die textexternen Kriterien orientieren sich am Kommunikationszusammenhang.
Dazu zählen vor allem die Textfunktionen „Medikamentenbeschreibung“ und „Einnahmehinweise“, das Trägermedium „Beipackzettel aus Papier“ und die Kommunikationssituation, bei der die Akteure der Kommunikation sich nicht in derselben Situation aufhalten. Daher muss der Text so verfasst sein, dass er ohne die Möglichkeit Nachfragen zu stellen verstanden wird.
In Fachsprachen verwendete Textsorten sind an den fachlichen Inhalt gebunden und weisen innerhalb der fachlichen Kommunikation jeweils bestimmte funktionale und formale Gemeinsamkeiten auf (vergleiche Roelcke 2010: 40f). Dabei können Fachtexte unterschiedlich abstrakt sein, sie lassen sich also ihrerseits auf der vertikalen Achse der Fachsprachengliederung einsortieren. Sie unterliegen aber auch bestimmten fachbezogenen Traditionen, sind also auch auf der horizontalen Gliederungsebene verortet.
Es gibt jeweils eher zentrale und eher randständige Vertreter einer Textsorte. Texte, die unter den gegebenen kommunikativen Bedingungen für die fachliche Verständigung besonders geeignet sind, gelten als prototypisch für die Textsorte. Die oben gezeigte Packungsbeilage kann als prototypisch angesehen werden. Prototypen sind gut geeignet, um Fachsprache zu vermitteln, da die immer wieder kehrenden Muster in Textsorten sich als Vorbild für die eigene Produktion von Texten der Lerner eignen. Sie stellen sprachliche Handlungsmuster dar, die Zweck, Zielgruppe und Abstraktionsgrad der Fachkommunikation bündeln und zur Nachahmung bereitstellen.
In Bezug auf die Übertragung fachlichen Wissens von Experten und Expertinnen auf Laien sind besonders die Textsorten der fachexternen Kommunikation und Konsumption interessant. Es lassen sich in Fachtexten unterschiedliche Funktionen ausmachen, die diese für die Laien übernehmen sollen. Didaktisierte Texte haben zum Ziel, Wissen aufzubauen und Kenntnisse zu vermitteln, während Ratgebertexte eher Anleitungscharakter haben. Produktbegleitende Texte und Werbetexte hingegen haben auffordernden Charakter.
Der Lehrbuchtext führt neue Themen (ph-Wert) ein und definiert sie in möglichst einfachen Worten. Dies wird grafisch durch einen Absatz hervorgehoben. Danach wird die Beschreibung ausgeweitet und Anwendungswissen vermittelt, indem auf Dinge Bezug genommen wird, die die Lerner aus dem Alltag kennen (Sprudelwasser, Magensaft). In jüngster Zeit befasst sich die Fachsprachenforschung vermehrt mit der Analyse der Prozesse und Strategien zur Vermittlung fachlichen Wissens und fachlicher Fähigkeiten. Dabei ist zentral, dass diese Vermittlung nicht unilateral erfolgt, also nicht nur von den Expertinnen und Experten hin zu den Laien, sondern dass auf beiden Seiten aktive Prozesse stattfinden. Laien bringen Vorkenntnisse in den Kommunikationsakt mit ein und sind aktiv am Erwerb neuen Wissens und neuer Fähigkeiten beteiligt. Lehrbuchtexte greifen dieses Wissen auf und binden es ein.
Es lässt sich hier bereits absehen, dass die Analyse und Einteilung fachlicher Texte immer abhängig von deren Funktion ist. Dem wollen wir uns in Lerneinheit 1.3 eingehender zuwenden. Zunächst ist es bedeutsam festzuhalten, dass es gerade die prototypischen Strukturen festgelegter Textsorten und ihre Funktionen für den Fachunterricht sind, die dem fachbezogenen Fremdsprachenunterricht zuarbeiten. Wenn Lerner die Struktur einer Textsorte durchschauen, können sie schneller und effektiver Informationen entnehmen oder eigene Texte textsortengerecht verfassen. Dabei sollten sprachliche Mittel und Wissen über spezifische Textsorten nicht als Regeln verinnerlicht werden, sondern als Instrumente der selbstgesteuerten Aneignung neuen fachlichen Wissens (vergleiche Thielmann 2010: 1056).