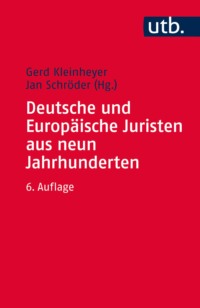Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 10
[Zum Inhalt]
|71|Johann Caspar BluntschliBluntschli, Johann Caspar (1808–1881)
(1808–1881)

Geb. am 7.3.1808, stammt aus einer alteingesessenen Zürcher Familie. Sein Vater war Kerzen- und Seifenfabrikant und Schreiber der Metzgerzunft „Zum Widder“. B. studierte in Zürich Rechtswissenschaft am Politischen Institut. Zur Vertiefung seiner juristischen, philosophischen und historischen Bildung hielt er sich von 1827 bis 1829 in Berlin (Einflüsse → SavignysSavigny, Friedrich Carl v. (1779–1861), mit dem B. bis zum Ende seiner Zürcher Zeit in regem Briefwechsel stand, und Schleiermachers) und in Bonn (Hasse und Niebuhr) auf. 1829 wurde er in Bonn zum Doctor iuris promoviert (Dissertation über das römische Noterbrecht nach der Novelle 115). Nach einem kurzen Aufenthalt in Paris kehrte B. 1830 nach Zürich zurück. Dort wurde er zunächst Auditor beim Amtsgericht und Sekretär der Regierungskommission des Inneren, insbesondere der Kommission für administrative Streitigkeiten, 1831 Bezirksgerichtsschreiber und zugleich Notar der Stadt Zürich, deren Rechtskonsulent er auch noch in späteren Jahren war. Daneben hielt B. Vorträge am Politischen Institut.
Von 1833 an war er außerordentlicher, von 1836 an bis 1848 ordentlicher Professor für römisches Recht, für deutsches Zivilrecht und für Rechtsgeschichte an der neugegründeten Universität Zürich. In dieser Zeit schrieb B. u.a. die „Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich“, die er → SavignySavigny, Friedrich Carl v. (1779–1861) und → EichhornEichhorn, Karl Friedrich (1781–1854) widmete und die als die bedeutendste wissenschaftliche Arbeit B.s überhaupt gilt. In diesem Werk versucht er die Darstellung eines alemannischen Partikularrechts, das vom römischen Recht wenig beeinflußt ist, von den Anfängen bis zur Gegenwart nach den Grundsätzen der historischen Rechtsschule. Diese Staats- und Rechtsgeschichte, die tiefe allgemein-historische Einsichten enthält, gewann für die nun in der Schweiz einsetzende rechtshistorische Forschung große Bedeutung. 1840 wurde B. beauftragt, die von Friedrich Ludwig Keller begonnenen Arbeiten an einem Privatrechtlichen Gesetzbuch für den Kanton Zürich |72|fort zusetzen. Es wurde 1854–56 in Kraft gesetzt und von B. in vier Bänden mit Erläuterungen herausgegeben. Man rechnet es oft zu den besten gesetzgeberischen Leistungen des 19. Jhs. Es stellt eine gelungene Verbindung schweizerischer Überlieferung mit dem modernen (gemeinen) Zivilrecht dar und hat auf die Fassung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches von 1907 (→ HuberHuber, Zacharias (1669–1732); niederl. Jurist) großen Einfluß gehabt. Wie dieses zeichnet es sich durch Verzicht auf einen allgemeinen Teils und schlichte Sprache (beides im Gegensatz zum deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch) aus. Das Gesetzbuch wurde von mehreren Nachbarkantonen übernommen und blieb dort und in Zürich zu einem großen Teil bis Ende 1911 – also bis zur Ablösung durch das neue, bundeseinheitliche Zivilgesetzbuch – in Kraft.
B. hatte zeitlebens einen großen Hang zur Politik. Er selbst stimmt in seinen „Denkwürdigkeiten“ der Bemerkung eines Münchener Kollegen zu, er, B., sei zu vier Siebteln Politiker und zu drei Siebteln Professor.
So war B. von 1838 bis 1848 Mitglied des Großen Rates des Kantons Zürich, ab 1845 dessen Präsident und wurde 1839 in die Oberste Behörde berufen. Als er 1844 bei der Bürgermeisterwahl knapp unterlag, zog er sich im darauf folgenden Jahr enttäuscht aus der Politik zurück. Die Ursache seiner Niederlage lag zum größten Teil in seiner engen Bindung an den Philosophen Friedrich Rohmer, dessen Psychologie er auf die Staatslehre anwenden wollte. U.a. übertrug er die von Rohmer entdeckten sechzehn Grundkräfte der menschlichen Seele auf den Staatskörper und schrieb auch ihm sechzehn Grundorgane zu. Weiter teilte er die Geschichte von 1740 bis 1840 in sechzehn gleiche psychologisch gegliederte Perioden ein. Mit all dem setzte sich B. der Lächerlichkeit aus, was ihm und seiner Partei im Zürcherischen Großen Rat schweren politischen Schaden zufügte. Damit konnten sich B.s politische Absichten in Zürich nicht erfüllen, er ging deshalb 1848 nach München, wo er ordentlicher Professor für deutsches Privatrecht und für Staatsrecht wurde. Aber auch hier gelangte B. nicht zu der von ihm erhofften politischen Bedeutung. Dafür war seine schriftstellerische Produktivität um so größer.
Die Arbeiten B.s am „Privatrechtlichen Gesetzbuch für den Kanton Zürich“ fallen schon in die Münchener Periode. 1851/52 erschien dann sein „Allgemeines Staatsrecht“, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde und durch das B. europäischen Ruhm gewann. Die Zeitgenossen lobten außer der klaren und eleganten Darstellung vor allem die vergleichende Heranziehung amerikanischen und schweizerischen Verfassungsrechts, die zum wissenschaftlichen Verständnis des modernen |73|deutschen Bundesstaats mehr beigetragen habe als etwa die Arbeiten → StahlsStahl, Friedrich Julius (1802–1861) und → MohlsMohl, Robert v. (1799–1875). „Seit Montesquieu war auf dem Boden des allgemeinen Staatsrechts kein Werk erschienen, das an Lesbarkeit, anregender Kraft, idealem Gehalt, praktisch-politischem Blick und historischer Übersichtlichkeit mit Bluntschlis Arbeit verglichen werden könnte“ (Holtzendorff).
Ergänzt wurden die staatsrechtlichen Arbeiten B.s durch das zwischen 1857 und 1870 von ihm und Karl Brater herausgebrachte „Deutsche Staatswörterbuch“ (11 Bde.), das jahrzehntelang eines der meistbenutzten politisch-juristischen Nachschlagewerke blieb. Es löste das → v. RotteckRotteck, Karl v. (1775–1840)-WelckerscheWelcker, Karl Theodor (1790–1869) „Staatslexikon“, die einstige Bibel des deutschen Liberalismus, ab, übertraf dieses aber an wissenschaftlicher Solidität. In der liberalen Grundhaltung ist es ihm allerdings verwandt.
Als B. 1860 einen Ruf der badischen Regierung auf den Lehrstuhl für Staatsrecht und Staatswissenschaft in Heidelberg – als Nachfolger von → Robert v. MohlMohl, Robert v. (1799–1875) – erhielt, entschloß er sich ohne Zögern, ihn anzunehmen, zumal ihm gleichzeitig ein Sitz in der Ersten Kammer (eine Art Oberhaus) angeboten wurde, von dem sich B. ein politisches Betätigungsfeld erhoffte.
Das bedeutendste Werk B.s während seiner Heidelberger Zeit ist „Das moderne Völkerrecht der zivilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt“, das nicht nur in europäischen, sondern auch in ostasiatischen Übersetzungen erschien. Es war gedacht als Entwurf für eine zukünftige Kodifikation des Völkerrechts, insbesondere des Kriegsrechts, und erlangte internationale Geltung. B. hat übrigens als Mitbegründer und zeitweiliger Vizepräsident des „Institut de droit international“, einer freien völkerrechtlichen Akademie (1873), auch praktisch für die Fortschritte des Völkerrechts gewirkt.
Die beiden letzten Lebensjahrzehnte B.s waren außerdem mit intensiver politischer Tätigkeit ausgefüllt: Von 1861 bis 1871 und von 1879 bis zu seinem Tode war er Mitglied der Ersten Kammer, ab 1873 Abgeordneter und zuletzt Präsident der Zweiten Kammer, wo er für ein Kleindeutschland unter Preußens Führung eintrat. Am 21.10.1881 ist B. in Karlsruhe gestorben.
Hauptwerke: Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich, 2 Bde., 1838/39, 21856. – Allgemeines Staatsrecht, 1851/52, weitere Aufl. in 2 Bden. 21857, 41868 u. ab 51875/76 u.d.T. „Lehre vom modernen Staat“ (dazu ein 3. Bd. Politik als Wissenschaft, 1876, Ndr. 1965), 61885/86 hrsg. v. E. Loening (Ndr. 1965). – Deutsches Privatrecht, 1853, 31864 (hrsg. v. E. Dahn). – Geschichte des allgemeinen Staatsrechts |74|und der Politik (später Geschichte der neueren Staatswissenschaften) 1864, 31881 (Ndr. 1964). – Das moderne Völkerrecht der zivilisierten Staaten als Rechtsbuch dargestellt, 1868. – Denkwürdiges aus meinem Leben (Selbstbiographie), 3 Bde., 1884 (hrsg. v. R. Seyerlen). Dort auch Bibliographie (III 514–524).
Literatur: M. Affentranger: Besitzbegriff und Besitzesschutz im Zürcher Privatrechtlichen Gesetzbuch Johann Caspar Bluntschlis, 1987. – H. Bluntschli: Johann Caspar Bluntschli in seiner Stellung zu geistigen Strömungen seiner Zeit, 1908. – M. Bullinger: Johann Kaspar Bluntschli, in: JZ 1958, 560ff. – E. Eichholzer: Johann Caspar Bluntschli als Sozialpolitiker, in: Zürcher Taschenbuch auf das Jahr 1950 (1949), 132ff. – F. Elsener: Die Schweizer Rechtsschulen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, 1975, 381–405. – M.H. Fassbender-Ilge: Liberalismus – Wissenschaft – Realpolitik, 1981. – H. Fritzsche: Johann Caspar Bluntschli, in: Schweizer Juristen der letzten hundert Jahre (hrsg. v. H. Schultheß), 1945, 135ff. – W. Hochuli: Johann Caspar Bluntschli (1808–1881), in: Zeitschr. f. schweiz. Recht N.F. 101 (1982), 87–104. – F. v. Holtzendorff: J.C. Bluntschli und seine Verdienste um die Staatswissenschaften, in: Deutsche Zeit- und Streitfragen 11 (1882), 4ff. – E. Jayme: Johann Kapar Bluntschli (1808–1881) und das Intern. Privatrecht, in: B.-R. Kern u.a. (Hrsg.): Humaniora. FS für A. Laufs zum 70. Geb., 2006, 135–144. – C.-H. Kim: Von Heidelberg nach Han-Seong. Die Bedeutung von Bluntschlis „Völkerrecht“ für die Proklamation des koreanischen Kaiserreiches, 2015. – Y. Lei: Auf der Suche nach dem modernen Staat. Die Einflüsse der allgemeinen Staatslehre Johann Caspar Bluntschlis auf das Staatsdenken Liang Qichaos, 2010. – F. Meili: Johann Caspar Bluntschli und seine Bedeutung für die moderne Rechtswissenschaft, 1908. – C. Metzner: Johann Caspar Bluntschli. Leben, Zeitgeschehen und Kirchenpolitik, 1808–1881, 2009. – M. Rehbinder: J.C. Bluntschlis Beitrag zur Theorie des Urheberrechts, in: C. Schott u.a. (Hrsg.): FS f. C. Soliva, 1994, 183–194. – B. Röben: Johann Caspar Bluntschli, Francis Lieber und das moderne Völkerrecht 1861–1881, 2003. – D. Schindler: Jean-Gaspard Bluntschli (1808–1881), in: Institut de droit international, Livre du centenaire 1873–1973 (1973), 45–60. – Stefan Dieter Schmidt: Die allgemeine Staatslehre Johann Caspar Bluntschlis, Diss. München, 1966. – A.K. Schnyder: Heimatrecht und internationales Privatrecht in der Schweiz – Bluntschli, in: E. Jayme u.a (Hrsg.): Nation und Staat im internationalen Privatrecht, 1990, 135–144. – K.-P. Schroeder: „Eine Universität für Juristen und von Juristen“. Die Heidelberger Juristische Fakultät im 19. und 20. Jh., 2010, 215–223. – M. Senn: Rassist. u. antisem. Elemente im Rechtsdenken von J.C. Bluntschli, in: ZRG (GA) 110 (1993), 372–405. – Ders.: Bluntschlis Konzept des Zürcher Aktienrechts, in: FS f. P. Forstmoser z. 60. Geb., 2003, 137–152. – Stintzing-Landsberg: GDtRW III 2, 552–558. – Stolleis: Gesch., II, 430–433. – E. Strobel: Johann Caspar Bluntschli, in: Badische Heimat 49 (1969), 147ff. – J. Vontobel: Johann Caspar Bluntschlis Lehre von Recht und Staat, Diss. Zürich, 1956. – ADB 47 (1903), 29–39 (Meyer v. Knonau). – HRG2 I (2008), 620f. (M. Senn). – Jur., 89f. (J.P. Arquint). – Jur.Univ. III, 218–222 (B. López-Jurado). – NDB 2 (1955), 337f. (H. Mitteis). – StL 1 (1985), 839–841 (D. Schindler).
F.
[Zum Inhalt]
|75|Jean BodinBodin, Jean (1529/30–1596)
(1529/30–1596)

B. ist 1529 oder 1530 in Angers geboren. Mit sechzehn Jahren tritt er in den Karmeliterorden ein, den er drei Jahre später wieder verläßt; wohl, um einem Häresieprozeß zu entgehen. Sein Jurastudium absolviert er ab 1550 in Toulouse, wo er dann auch selbst unterrichtet. Später, wohl 1561, geht er nach Paris, um den Anwaltsberuf am „Parlament“ auszuüben. Dort beginnt er auch, wissenschaftliche Arbeiten zu publizieren. Er gewinnt großen Einfluß als Berater des Königs Henri III; in den siebziger Jahren ist er dann im Dienste von dessen Bruder, des Herzogs François von Alençon, tätig. Durch seine Vermählung mit Françoise Trouillart (1576) erlangt er 1577 die Stelle eines Staatsanwalts in Laon. Wie bei vielen bedeutenden Juristen seiner Zeit, war auch B.s Leben durch die Religionskämpfe geprägt. In der Bartholomäusnacht 1572 entkam er nur knapp einem Mordanschlag. Sein Wunsch, den Bürgerkrieg in Frankreich zu beenden und ein friedliches Zusammenleben der Konfessionen zu erreichen, erwies sich jahrzehntelang als unrealisierbar. Nach der Gründung der „Liga“ (1576) geriet B. sogar in Opposition zum König und zur katholischen Partei, als er die Ständeversammlung von Blois dazu brachte, die Steuerforderungen des Königs zugunsten der Liga zu verweigern; 1588 mußte er aber nach dem Übergang Laons zur Liga 1588 selbst Ligist werden. Bis zur Einnahme der Stadt durch den neuen König Henri IV (1594) zunehmend isoliert, blieb B. zwar in seinem Amt, zog sich aber aus der öffentlichen politischen Diskussion zurück. 1596 starb er in Laon an der Pest.
B.s Hauptwerk sind die „Six livres de la République“, eine Staatslehre auf rechtsvergleichender Grundlage. B. hat in diesem Werk wesentliche Elemente des modernen Staatsdenkens, vor allem die Lehre von der Souveränität und von der zentralen Bedeutung der Gesetzgebungsrechts entwickelt. Ein Staat ist „die am Recht orientierte, souveräne Regierungsgewalt über eine Vielzahl von Haushaltungen und das, was |76|ih nen gemeinsam ist“. Souveränität wiederum bedeutet nach B. „die dem Staat eignende absolute und zeitlich unbegrenzte Gewalt“, souverän ist, „wer außer Gott keinen Höheren über sich anerkennt“. Damit findet B. ein Charakteristikum, durch das sich der moderne Staat von den nur relativ unabhängigen (gleichwohl im älteren Sinne „souveränen“) Gemeinwesen oder Herrschaften des Mittelalters unterscheidet, die keine Staatsgewalt im modernen Sinne besaßen. Vor allem macht er deutlich, daß der neuzeitliche Staat keine Herrschaft der Kirche über sich dulden kann, ein Anliegen, das ersichtlich vom Erlebnis der Religionskämpfe und von B.s Toleranzvorstellungen geprägt ist. Neuartig sind auch die Aufgaben, die B. dem Souverän zuweist: „Wer … souverän sein soll … muß in der Lage sein, den Untertanen das Gesetz vorzuschreiben, unzweckmäßige Gesetze aufzuheben oder für ungültig zu erklären und durch neue zu ersetzen“. B. bricht hier mit der mittelalterlichen Vorstellung, daß das Recht dem Herrscher im wesentlichen vorgegeben ist und seine Aufgabe nur in der Rechtsprechung besteht.
Trotz dieser bahnbrechenden Lehren ist B. allerdings in anderen Punkten noch weit von den modernen Vorstellungen entfernt. Obwohl „legibus solutus“, ist der Herrscher für ihn doch – entsprechend der überkommenen Auffassung – an die göttlichen und natürlichen Gesetze gebunden, und selbstverständlich auch an die von ihm eingegangenen Verträge und die Fundamentalgesetze. Vor allem hat die Gesetzgebung für B. nicht annähernd die Bedeutung wie im modernen Gesetzgebungsstaat: Gesetze sollen möglichst nicht geändert, neue nur bei evidenter Notwendigkeit eingeführt werden. Das alte Recht ist nach Möglichkeit zu bewahren. Gegen eine stark vereinheitlichende Gesetzgebung spricht auch, daß nach B. das Recht dem Volkscharakter angepaßt sein soll, der sich besonders aus den jeweiligen klimatischen Verhältnissen ergibt. Anknüpfend an antike Vorstellungen entwirft B. auf der Basis seines unglaublich umfassenden historisch-ethnologischen Wissens Grundlinien einer Theorie über den Zusammenhang zwischen Klima, Volkscharakter und Recht – einer Lehre, die dann von → MontesquieuMontesquieu, Charles de Secondat, Baron de la Brède et de M. (1689–1755) aufgegriffen und zu einem späten Höhepunkt geführt wird und die seitdem in konservativen Rechtstheorien fortlebt. Vormodern ist auch B.s Stellungnahme zur Entstehung des Staates, denn anders als später etwa bei → AlthusiusAlthusius, Johannes (1557–1638) und den Naturrechtlern (→ LockeLocke, John (1632–1704), → PufendorfPufendorf, Samuel (1632–1694)) hat bei ihm die Theorie von der vertraglichen Entstehung des Staates und damit der Volkssouveränität keinen Platz. Die absolute Monarchie ist für ihn die vorzugswürdige Regierungsform.
|77|B.s Werk hatte schon im 16. Jahrhundert ungeheuren Erfolg. Bis 1600 erschienen 18 Ausgaben der französischen Urfassung und vier der lateinischen Version von 1586, hinzu kamen – gleichfalls noch im 16. Jahrhundert – Übersetzungen ins Italienische, Spanische und Deutsche. In Deutschland wurde die Souveränitätslehre sofort rezipiert. Ihre Übertragung auf die deutschen Verhältnisse stieß allerdings auf Schwierigkeiten, da hier die Frage nach dem Träger der (Organ-) Souveränität angesichts der verzwickten Kompetenzverteilung auf Kaiser und Reichsstände und des bundesstaatlichen Charakters des Reichs nicht leicht zu beantworten war (→ ArumäusArumaeus, Dominicus (1579–1637), → LimnäusLimnäus, Johannes (1592–1663), → ReinkingkReinkingk, Dietrich (1590–1664)). Hier zeigen sich wohl zum ersten Mal die Probleme, die sich aus der bei B. noch fehlenden Unterscheidung zwischen Organ- und Staatssouveränität ergeben.
Weitere bedeutende Werke B.s sind die „Methodus ad facilem historiarum cognitionem“ von 1566 und die „Juris universi distributio“ von 1578. Die „Methodus“ ist eine eigenartige Mischung aus vergleichender Staatengeschichte und Geschichtstheorie, wobei B. in einigen Punkten zum Vorläufer der modernen Geschichtsmethodik wird. In der Vorrede zur „Methodus“ entwirft B. den Plan einer systematischen Gesamtdarstellung des Rechts. Er greift damit die in seiner Zeit verbreitete und für das 16. Jahrhundert charakteristische Tendenz zu einer – von der quellenmäßigen Ordnung unabhängigen – Systematisierung des Rechts (→ DonellusDonellus, Hugo (Doneau, Hugues) (1527–1591)) auf. Über die meisten seiner Zeitgenossen hinausgehend will sich B. dabei aber nicht auf das römische Recht beschränken, sondern alle bekannten Rechte aller Völker einbeziehen. Die „Six livres de la République“ führen diesen Plan in gewisser Weise für das Staatsrecht aus, das Gesamtsystem skizziert B. dann in der „Juris universi distributio“. Mit seiner im 16. Jahrhundert neuartigen universalrechtlichen Methode ist B. auch zu einem Vorläufer des weltlichen Naturrechts (→ GrotiusGrotius, Hugo (Huig de Groot) (1583–1645)), vor allem aber zu einem wichtigen Anreger der Rechtsvergleichung geworden.
Hauptwerke: Methodus ad facilem historiarum cognitionem, 1566. – Les six livres de la République, 1576, zahlr. weit. Aufl.; lateinisch: De republica libri sex, 1586, zahlr. weit. Aufl.; moderne dt. Übers.: Sechs Bücher über den Staat, 2 Bde., 1981/86, von B. Wimmer, eingel. und hrsg. v. P.C. Mayer-Tasch. – Iuris universi distributio, 1578.
Literatur: H. Baudrillart: Jean Bodin et son temps, 1853 (Ndr. 1964). – F. Berber: Das Staatsideal im Wandel der Weltgeschichte, 21978, 203ff. – R. Chauviré: Jean Bodin auteur de la République, 1914 (Ndr. 1969). – M.-D. Couzinet: Jean Bodin, 2001. – Dies.: Histoire et méthode à la renaissance: une lecture de la Methodus |78|ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin, 1996. – M. Chrom Jacobsen: Jean Bodin et le dilemme de la philosophie politique moderne, 2000. – D. Damler: Harmonie und Melodie im Staatsdenken der Neuzeit, in: FS f. Jan Schröder, 2013, 609–632. – J. Dennert: Ursprung und Begriff der Souveränität, 1964. – B. Dennewitz: Machiavelli, Bodin, Hobbes, 1948. – A. Deppisch: Die Religion in den Werken von Jean Bodin und Michel de Montaigne. Ein Vergleich, 2015. – L. Foisneau: Politique, droit et théologie chez Bodin, Grotius et Hobbes, 1997. – E.-M. Fournol: Bodin procédésseur de Montesquieu, 1896 (Ndr. 1970). – J.H. Franklin: Jean Bodin and the sixteenth-century revolution in the methodology of law and history, 1963. – Ders.: Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theory, 1973. – Ders. (Hrsg.): Jean Bodin, 2006. – S. Goyard-Fabre: Jean Bodin et le droit de la république, 1989. – G.-E. Guhrauer: Das Heptaplomeron des J. Bodin, 1941 (Ndr. 1971). – M. Imboden: Johannes Bodinus und die Souveränitätslehre, 1963. – D.R. Kelley: History, law and the human sciences, 1984, VIII. – P. King: The ideology of order: a comparative analysis of Jean Bodin and Thomas Hobbes, 1999. – D. Klippel: Staat und Souveränität VI.–VIII., in: O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck: Geschichtl. Grundbegriffe 6 (1990), 98ff. – H.A. Lloyd: The reception of Bodin, Leiden 2013. – P.C. Mayer-Tasch: Jean Bodin: eine Einführung in sein Leben, sein Werk und seine Wirkung, 2000, 22011 (mit Bibliographie 1800–2010). – M. Philipp (Hrsg:): Debatten um die Souveränität, 2016. – H. Quaritsch: Staat und Souveränität, 1970. – N. Rosin: Souveränität zwischen Macht und Recht: Probleme der Lehren politischer Souveränität in der frühen Neuzeit am Beispiel von Machiavelli, Bodin und Hobbes, 2003. – M. Scattola: Diritto medioevale e scienza politica moderna nella dottrina della sovranità di Jean Bodin, in: Ius commune 26 (1999), 165–209. – R. Schnur: Die französischen Juristen im konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts, 1962. – J. Schröder: Zur Vorgeschichte der Volksgeistlehre, in ZRG (GA) 109 (1992), 1ff. – J.-F. Spitz: Bodin et la souveraineté, 1998. – G. Treffer: Jean Bodin, 1977. – E. Voegelin: Jean Bodin, 2003. – T. Wahnbaeck: Die Reaktion der Kurie auf die Begründung des Absolutismus: Fabio Albergati versus Jean Bodin, in: Zeitschrift für historische Forschung 26 (1999), 245–267. – Y.C. Zarka: Jean Bodin: nature, histoire, droit et politique, 1996. – G. Zecchini (Hrsg.): Storici antichi e storici moderni nella „Methodus“ di Jean Bodin, Milano 2012. – Dict.Hist., 120–122 (D. Quaglioni). – HRG² I (2008), 628f. (T.Gergen). – Jur., 90–92 (U. Speck). – Jur.Univ. II, 241–244 (J.A. Muñoz Arnau). – StL 1 (71985), 861–863 (R. Schnur). Bibliographie: H. Denzer in: Jean Bodin. Verh. der int. Bodin-Tagung in München, 1973; P.C. Mayer-Tasch (s.o.).
K. Stapelfeldt/S.