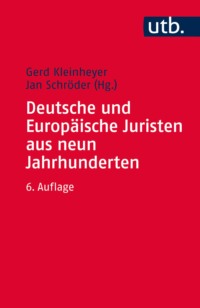Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 11
[Zum Inhalt]
|79|Justus Henning BöhmerBöhmer, Justus Henning (1674–1749)
(1674–1749)

Geb. am 29.1.1674 in Hannover, gest. am 23.8.1749 in Halle. Vater Advokat. 1693–1695 Jurastudium in Jena, dann Advokat in Hannover. Von dieser Tätigkeit unbefriedigt, nimmt er 1697 eine Hofmeisterstelle in Rinteln an, gelangt von dort nach Halle, wo er → Samuel StrykStryk, Samuel (1640–1710) und → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph kennenlernt. Schließt sich eng an → StrykStryk, Samuel (1640–1710) an, wird unter dessen Vorsitz Lizentiat beider Rechte und hält 1699 erste Vorlesungen; Anstellung als außerordentlicher Professor 1701, Doktorwürde 1702, wird dann durch königlichen Spezialbefehl → StrykStryk, Samuel (1640–1710) in der juristischen Fakultät adjungiert. Ordentlicher Professor 1711. Nach dem Tod von Johann Samuel Stryk erhält er 1715 dessen Professur der Institutionen und des Lehnrechts, wird kaiserlicher Pfalzgraf und Hofrat, 1719 Geheimer Rat, 1729 zweiter Professor hinter dem Kanzler v. Ludewig. In der Folgezeit ist er vor allem in der Universitätsverwaltung tätig, auf ein vom König angefordertes Gutachten über Möglichkeiten zur Hebung der Universität wird er 1731 Direktor der Universität und Vize-Ordinarius der juristischen Fakultät. Nach dem Tode v. Ludewigs wird er 1743 zum Regierungskanzler des Herzogtums Magdeburg und Ordinarius der juristischen Fakultät ernannt.
B. ist hinsichtlich der kasuistisch-gründlichen Arbeitsmethode und der Tätigkeit in der Universitätsverwaltung als Schüler → StryksStryk, Samuel (1640–1710) anzusehen, seine kirchenrechtlichen und geschichtlichen Leitgedanken hat er jedoch von → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph entlehnt. Wie → StrykStryk, Samuel (1640–1710) hat er sich auf juristische Arbeiten beschränkt, daneben hat seine tief religiöse Gesinnung in Kirchenliedern Ausdruck gefunden. Von seinen vier Söhnen sind insbesondere Georg Ludwig (Zivil-, Lehn- und Kirchenrecht) und Johann Samuel Friedrich (Strafrecht) hervorzuheben.
Größte Bedeutung haben B.s kirchenrechtliche und privatrechtliche Schriften. Als wichtigstes Werk ist das „Ius ecclesiasticum Protestantium“ (1714–1737) anzusehen. Hier erläutert er die Lehren des |80|katho lischen und protestantischen Kirchenrechts aus der Kirchengeschichte und weist die modifizierte Geltung des kanonischen Rechtes in der evangelischen Kirche in den Grundsätzen der Reformation und der späteren kirchlichen und weltlichen Gesetzgebung nach. Damit gibt er der Lehre von den Quellen des protestantischen Kirchenrechts (Anregungen des → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph folgend) erstmals eine feste historische Grundlage und stellt – in der Sache vermittelnd – einerseits die Eigenständigkeit des evangelischen Kirchenrechts, andererseits die doch wenigstens subsidiäre Geltung des kanonischen Rechts sicher. Obwohl er von der Kirche spricht als einem Kollegium mit der Fähigkeit, sich selbst eine Ordnung ohne Zwangsgewalt zu geben (wie → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph), betont er wie sein Lehrer immer die Obergewalt des Staates, der allein zwingende Regeln erlassen kann. Zwingende Rechtskraft kann die Kirchenordnung nur durch die Staatsgewalt erhalten. Damit ist im Kern das Kollegialsystem abgelehnt, das Territorialsystem betont. Der Staat kann zwingende Regeln für die kirchliche Ordnung erlassen, nicht aber über Glaubenssätze bestimmen (so auch → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph). Dies bedeutet z.B. für das Eherecht, daß der Staat der kirchlichen Eheschließung jede Rechtswirkung nehmen, also die obligatorische Zivilehe einführen kann (so erstmals Frankreich 1792, das Deutsche Reich 1875). B.s Darstellung des protestantischen Kirchenrechts zählt mit seiner gründlichen historischen Methode wohl zu den größten Leistungen der Rechtswissenschaft des 18. Jahrhunderts (und B. ist einer der ganz wenigen Juristen dieser Zeit, die sogar vor der Kritik → SavignysSavigny, Friedrich Carl v. (1779–1861) bestanden haben!).
In der Pandektenwissenschaft führt B. das Werk → Samuel StryksStryk, Samuel (1640–1710) weiter, ausdrücklich im „Usus modernus Strykianus“ (1733). Sein Ruf als Pandektist beruht aber vor allem auf dem Erfolg der „Introductio in ius digestorum“, die bis 1791 vierzehn Auflagen erfuhr und sich in Klarheit, Systematik und praktischer Brauchbarkeit als bestes Lehrbuch des usus modernus erwies. Bei der Anpassung des römischen Rechts an die praktischen Bedürfnisse der Gegenwart zieht B. noch mehr als einige seiner bedeutendsten Vorgänger (→ StrykStryk, Samuel (1640–1710), Lauterbach, Struve, Schilter) deutsches und Naturrecht heran; so will er etwa dem Mieter, abweichend vom römischen Recht, einen umfassenden Besitzschutz gegenüber dem Vermieter und Dritten gewähren.
Im peinlichen Recht lehnt er wie → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph die Strafbarkeit von Hexerei und Ketzerei ab (1745) und sucht die Anwendung der Folter durch die Feststellung einzuschränken, daß Verurteilung auch ohne erzwungenes Geständnis möglich sei, wo voller Beweis vorliege.
|81|Mit der Veröffentlichung von praktischen Anleitungen (zu Disputationen, 1703, zum Referieren und Dekretieren, 1732) folgt er der Tendenz der Frühaufklärung, wie auch in seiner bedeutenden „Introductio in ius publicum universale“, einer naturrechtlichen Darstellung des Staatsrechts in der Nachfolge von → Ulrich HuberHuber, Zacharias (1669–1732); niederl. Jurist.
Hauptwerke: Introductio in ius digestorum, 1704, 141791. – Introductio in ius publicum universale, 1710, 41773. – Kurzer Entwurf des Kirchenstaats der ersten drey Jahrhunderte, 1713. – Ius ecclesiasticum protestantium usum hodiernum juris canonici juxta seriem decretalium ostendens et ipsis rerum argumentis illustrans, 5 Bde., 1714–1737, 51756ff. – (Hrsg. mit J.F. Ludovici und J.S. Stryk) Usus moderni Strykiani continuatio III/IV, 1712. – Exercitationes ad Pandectas, hrsg. v. G.L. Böhmer, 6 Bde., 1745–1764. – (Hrsg.) Corpus iuris canonici, 1747. Bibliographie bei D. Nettelbladt: Hallische Beiträge zu der Juristischen Gelehrten Historie III (1755), 425–482.
Literatur: S. Buchholz: Justus Henning Böhmer (1674–1749) und das Kirchenrecht, in: Ius Commune 18 (1991), 37–49. – Conrad: DRG II, 296, 311. – Döhring: GDtRPfl, 378. – R. Kirstein: Die Entwicklung der Sponsalienlehre und der Lehre vom Eheschluß in der deutschen protestantischen Eherechtslehre bis zu J.H. Böhmer, 1966 (dazu D. Schwab in: FamRZ 1968, 637–640). – P. Landau: Kanonistischer Pietismus bei Justus Henning Böhmer, in: N. Brieskorn u.a. (Hrsg.): Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen Rechtswissenschaft, 1994, 317–333. – H. Liermann: Justus Henning Böhmer, in: ZRG (KA) 35 (1948), 390–399. – W. Rütten: Das zivilrechtliche Werk Justus Henning Böhmers. Ein Beitrag zur Methode des usus modernus pandectarum. 1981. – H. Schnizer: Justus Henning Böhmer und seine Lehre von der media via zur Interpretation der kanonischen Quellen des gemeinen Rechts, in: ZRG (KA) 93 (1976), 383–393. – W. Schrader: Geschichte der Friedrichs-Universität Halle, I, 1894, 147f. – G. Schubart-Fikentscher: Hallesche Spruchpraxis, 1960. – v. Schulte: Gesch., III 2, 1880 (Ndr. 1956), 92–95. – Renate Schulze: Justus Henning Böhmer und die Dissertationen seiner Schüler: Bausteine des Ius Ecclesiasticum Protestantium, 2009. – Stintzing-Landsberg: GDtRW III 1, 145–149. – Stolleis: Gesch., I, 293f. – H. de Wall: Zum kirchenrechtlichen Werk Justus Henning Böhmers, in: ZRG (KA) 87 (2001), 455–472. – Wieacker: PRG 220f. – ADB 3 (1876), 79–81 (R.W. Dove). – HRG2 I (2008), 640f. (H. de Wall). – Jur., 93 (P. Landau). – Jur.Univ II, 506–508 (P. Landau). – NDB 2 (1955), 392f. (H. Liermann). – Nds.Jur., 41–45 (H. Hof).
H.
[Zum Inhalt]
|82|Henry de BractonBracton, Henry de (1200/1210–1268)
(1200/1210–1268)
Geboren im Dorf Bratton Fleming in Devon, studiert B. (auch Bratton geschrieben) wahrscheinlich an der Domschule von Exeter u.a. bei William de Raleigh Theologie, römisches und kanonisches Recht und tritt in den geistlichen Stand ein. Um 1230 beginnt er seine Laufbahn als Schreiber (clericus) des königlichen Richters William de Raleigh, der während der Krisenjahre 1234–1239 Chief Justice ist. Als Raleigh 1239 Bischof wird, bleibt er zunächst in dessen Dienst. 1245 ernennt ihn König Heinrich III. (König 1216–1272) zum „Justice in Eyre“ (Reiserichter). 1247/48 wird er schliesslich Nachfolger Williams von York als Richter am königlichen Gerichtshof „Coram Rege“ (später King’s Bench) und hat dieses Amt zunächst bis 1251 und dann wieder von 1253 bis 1257/59 inne. Er gehört zum Kreis der königlichen Rechtsberater und taucht als Zeuge in Königsurkunden auf. 1264 wird er Domkanzler von Exeter. Nach seinem Tode 1268 wird er dort in der Kathedrale beigesetzt.
Über Jahrhunderte hinweg galt B. als der alleinige Autor des berühmtesten juristischen Werks des englischen Mittelalters „De legibus et consuetudinibus Angliae“ und des „Note-book“, das ca. 2000 Fälle aus der Rechtsprechung der königlichen Gerichte referiert und kommentiert. Neuerdings wird auch die Ansicht vertreten, dass beide Werke auf Anregung des königlichen Richters William de Raleigh von dessen Schreibern verfasst worden seien, zu denen B. gehörte, oder dass Raleigh selbst bereits Ende der zwanziger Jahre des 13. Jahrhunderts mit der Abfassung begonnen habe, als er „senior clerk“ unter Martin de Pattishall war, und dass B. in den vierziger und fünfziger Jahren maßgeblich an Ergänzungen und Überarbeitungen mitwirkte. Die Ermittlung des ursprünglichen Textes des Werks und dessen Datierung ist aufgrund der zahllosen Revisionen wohl unmöglich.
Das Werk gliedert sich nach dem römischen Institutionensystem in drei Teile (personae, res, actiones), wobei mehr als drei Viertel auf den (unvollendeten) Abschnitt über das Aktionenrecht entfallen. In diesem stellt der Verfasser anhand der verschiedenen Klagetypen und -formeln (lat. brevia, engl. writ), die sich seit dem 12. Jahrhundert entwickelt hatten, das gesamte Common Law (Privat-, Lehn-, Strafrecht) dar. Neben dem System hat der Verfasser auch Begriffe, Definitionen und Begründungen der Kanonisten und Glossatoren herangezogen. Namentlich die Summa Institutionum des → Azo v. BolognaAzo (vor 1190–1220) diente ihm |83|als Vorlage. Die Formulierung → MaitlandsMaitland, Frederic William (1850–1906), wonach das Werk „romanesque in form, english in substance“ sei, ist durch neuere Forschungen als ungenau erkannt. Wenngleich eine systematische Rezeption nicht stattgefunden hat, lassen sich in der Abhandlung rund 500 Stellen aus den Digesten und dem Codex nachweisen, bei denen der Verfasser materielle Anleihen beim römischen Recht gemacht hat. Im Strafrecht vertrat B. die Auffassung, dass neben der objektiven Handlung auch ein subjektiver Tatbestand (mens rea) vorliegen müsse.
Bei der Abfassung verwertete der Verfasser eine Sammlung von ca. 2000 Fällen aus der Rechtsprechung der königlichen Gerichte (überwiegend solche der beiden Richter und Geistlichen Pattishall und Raleigh) und war damit der erste, der Präjudizien benutzte. Diese Fallsammlung konnte erst Ende des 19. Jahrhunderts von Vinogradoff zugeordnet werden und wurde darauf von → MaitlandMaitland, Frederic William (1850–1906) als „Bracton’s Note-book“ herausgegeben. Die methodische Einführung der Präzedenzfälle mit Autoritätscharakter muss vor dem Hintergrund der Rechtsentwicklung zwischen → GlanvilleGlanville, Ranulf de (1120/30–1190) und B. gesehen werden, die durch eine zunehmende Verselbständigung des Richterstandes und durch das Gewicht bedeutender Richterpersönlichkeiten in den höchsten Staatsämtern gekennzeichnet ist. Das große Verdienst des Verfassers war, dass er durchweg die besten und bewährtesten Verfahrensweisen der königlichen Gerichtshöfe zum Gegenstand seiner Darstellung machte, entsprechend seiner in der Einleitung angeführten Intention, den Richtern eine Anleitung an die Hand zu geben. Die englischen Juristen wurden durch die Abhandlung mit den Methoden, Regeln und Begriffen ausgerüstet, die sie für die rationale Durcharbeitung und Anwendung ihres heimischen Rechts brauchten. Das lernten sie in den bald entstehenden Inns of Court nicht, weil dort kein römisches Recht gelehrt wurde, während die Universitäten kein Common Law betrieben. Das Werk leistete damit auch einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung eines englischen Juristenstandes.
Die Abhandlung „De legibus et consuetudinibus Angliae“, von → MaitlandMaitland, Frederic William (1850–1906) als „the flower and crown of english jurisprudence“ gewürdigt, übertrifft an Gehalt und Bedeutung sowohl die ähnlich betitelte Schrift → GlanvillesGlanville, Ranulf de (1120/30–1190), als auch die im 15. Jahrhundert entstandenen Werke von Fortescue („De laudibus legum Angliae“) und Littleton („On Tenures“). Sie wurde zum Vorbild der gesamten Rechtsliteratur unter Eduard I. („Fleta“, „Britton“, „Hengham Magna“ und die „Summa de legibus“ Gilbert de Thorntons). Nachdem sie 1596 erstmals im Druck erschien, erlebte sie eine Renaissance als „book of authority“ |84|des Common Law und gewann Einfluss auf die staatsrechtlichen Auseinandersetzungen des 17. Jahrhunderts. „Bracton enjoyed a second life as a suitably venerable source of texts supporting a constitutional monarchy“ (J.H. Baker). Als maßgebliche Aufzeichnung des älteren englischen Rechts wurde sie erst im 18. Jahrhundert durch die „Commentaries“ → BlackstonesBlackstone, Sir William (1723–1780) ersetzt.
Nicht unterschätzt werden darf auch die Rolle, die das Werk bei der Bildung des englischen Staates spielte. Für die verschiedenen lokalen Herrschaftsbereiche im England des 13. Jahrhunderts waren die königlichen Gerichtshöfe, die unter Heinrich III. mit dem Sitz in London vereinigt wurden, die einzige Rechtsquelle für ein gemeinsames Recht. „From this viewpoint the most important events in the thirteenth-century making of an English state were Bracton’s compilation of ‚The Laws and Customs of England‘ and the continuation of the work of the law-book writers in semi-official registers of writs and collections of statutes.“ (Alan Harding)
Hauptwerke: Bracton, On the laws and customs of England (De legibus et consuetudinibus Angliae), ed. by G.E. Woodbine, translated with revisions and notes by S.E. Thorne, Vols. 1 and 2 1968, Vols. 3 and 4 1977 (Text bei http://bracton.law.harvard.edu). – Bracton’s Note Book. A collection of cases decided in the king’s courts during the reign of Henry III., ed. by F.W. Maitland, 3 Vols., 1887. – Bibliographie bei H.H. Jakobs: De similibus ad similia bei Bracton und Azo, Frankfurt a.M. 1996, 125ff.
Literatur: J.L. Barton: Roman Law in England (IRMAE V,13a), 1971, 13ff. – Ders.: Bracton as a civilian, in: Tulane Law Review 42 (1968), 555ff. – Ders.: The mystery of Bracton, in: Journal of Legal History 14,3 (1993), 1ff. – P. Brand: The Date and Authorship of Bracton, in: Journal of Legal History 31 (2010), 217ff. – H. Brunner: Abhandlungen zur Rechtsgeschichte II, 1931, 585ff. – R. v. Caenegem: The birth of the english Common Law, 21988. – H.M. Cam: Law-Finders and Law-Makers in Medieval England, 1962. – W. Fesefeldt: Englische Staatstheorie des 13. Jh., Henry de Bracton und sein Werk, Diss. Göttingen, 1962. – C. Güterbock: Henricus de Bracton und sein Verhältnis zum Römischen Rechte, 1862. – H.H. Jakobs: De similibus ad similia bei Bracton und Azo, Frankfurt a.M. 1996. – W.C. Jordan: On Bracton and Deus Ultor, in: Law Quarterly Review 88 (1972), 25ff. – H. Kantorowicz: Bractonian Problems, 1941 (Hrsg. D.M. Stenton). – H. Keyishian: Henry de Bracton, Renaissance Punishment Theory, and Shakespearean Closure, in: Law and Literature 20 (2008), 444ff. – G. Lapsley: Bracton and the Authorship of the „addicio de certis“, in: English Historical Review 52 (1947), 1ff. – E. Lewis: King above Law. Quod principi placuit in Bracton, in: Speculum 39 (1964), 240ff. – B. Lyon: A constitutional and legal history of medieval England, 21980, 431ff. – C.A.F. Meekings: Studies in 13th Century Justice and Administration, 1981, VII 141ff. – S.J.T. Miller: The Position of the King in Bracton and Beaumanoir, in: Speculum 31 (1956), 263ff. – T.F.T. Plucknett: Early English |85|Legal Literature, 1958, 42ff., 61ff. – G. Post: A Romano-canonical maxim „quod omnes tangit“ in Bracton, in: Traditio 4 (1946), 197ff. – Ders.: Bracton on Kingship, in: Tulane Law Review 42 (1968), 519ff. – H.G. Richardson: Bracton: The problem of his text, 1965. – Ders.: Azo, Drogheda and Bracton; Tancred, Raymond and Bracton, in: English Historical Review 59 (1944), 22ff., 376ff. – Ders.: Studies in Bracton, in: Traditio 6 (1948), 61ff. – F. Schulz: Critical Studies on Bracton’s Treatise, in: Law Quarterly Review 59 (1943), 172ff. – Ders.: Bracton and Raymond de Penaforte, in: Law Quarterly Review 61 (1945), 286ff. – Ders.: Bracton as a Computist, in: Traditio 3 (1945), 265ff. – Ders.: Bracton on Kingship in: L’Europa e il diritto romano: Studi in memoria di Paolo Koschaker I, 1954, 21ff. – D.J. Seipp: Bracton, the Year Books and the „transformation of elementary legal ideas“ in the early Common Law, in: Law & History Review 1989, 175ff. – A. Simonius: „Lex facit regem“ (Bracton): Ein Beitrag zur Lehre von den Rechtsquellen (Basler Studien zur Rechtswissenschaft 5), 1933. – P. Stein: Roman Law in European History, 1999. – S.E. Thorne: Essays in English legal history, 1985, 75ff., 93ff. – B. Tierney: Bracton on Government, in: Speculum 38 (1963), 295ff. – R.V. Turner: The English judiciary in the age of Glanvill und Bracton, c. 1176–1239, 1985, 234ff. – P. Vinogradoff: The roman element in Bracton’s treatise, in: Yale Law Journal 23 (1923), 751ff. – HRG I, 495f. (H. Peter). – Jur., 96f. (R.-P. Sossna). – Jur.Univ. I, 450–459 (I. Cremades). – A.W.B. Simpson (Hrsg.): Biographical Dictionary of the Common Law, 69ff. (J.H. Baker).
S. Luik
[Zum Inhalt]
Sebastian BrantBrant, Sebastian (1457–1521)
(1457–1521)

Geb. laut Grabinschrift 1457 in Straßburg; Vater: Gastwirt (gestorben 1468); 1475 Baccalaureus Artium; anschließend Studium der Jurisprudenz; 1483 Lizentiat und Dozent; 1489 Doctor utriusque iuris; 1492 Dekan der juristischen Fakultät der Universität Basel; 1499 Aufgabe der Baseler Stelle; 1500 in Straßburg als Rechtskonsulent, 1503 Stadtschreiber in Straßburg; Ernennung zum kaiserlichen Rat (1502), Comes Palatinus und Beisitzer am Reichskammergericht durch Kaiser Maximilian 1., 1520 Teilnahme an einer Gratulationsdelegation der Stadt Straßburg zum |86|neuge wählten Kaiser nach Gent, Bestätigung der auf B.s Veranlassung erweiterten Privilegien der Reichsstadt durch Karl V.; am 10.5.1521 ist der „Archigrammateus“ (Aufschrift seines Grabsteines) in Straßburg gestorben.
Von seinen Schriften ist die satirisch-moralische Sammlung „Das Narrenschiff“ am bekanntesten geworden. B. geißelt in über 100 Kapiteln Mißstände nicht nur seiner Zeit. So wird in Kap. 71 die Prozessiersucht als Versuch dargestellt, der Justitia eine Augenbinde umzubinden. Möglicherweise handelt es sich bei dem zugehörigen Holzschnitt um die erste Darstellung des – also ursprünglich negativ gemeinten – Bindensymbols (Wiethölter). B. geht davon aus, daß es genüge, die aufgezeigten Mißstände als Narrheiten bewußt zu machen, um seine Zeitgenossen zu einer Änderung der Verhältnisse zu bewegen.
In zahlreichen Flugblättern nahm B. am politischen Leben teil. Als großer Verehrer Kaiser Maximilians zielte er auf eine Stärkung der Stellung des Kaisers ab. Tagesereignisse wie den Niedergang eines „Donnersteins“ (Meteorit) bei Ensisheim 1492 oder die „wunderbare geburd des kinds bey Wurmsz des jars 1495“ (siamesischer Zwilling) deutet er als gute Vorzeichen für die Politik Maximilians; z.B. wird die Zwillingsgeburt als Symbol für das Reich genommen, wo auch ein Kopf über mehrere Körper herrschen soll.
Für die Jurisprudenz als Fachstudium nach Erlangung des Baccalaureus Artium entschied B. sich wahrscheinlich mit halbem Herzen unter dem Zwang einer finanziellen Notlage in seiner Familie. Als Jurist der Rezeptionszeit befaßte er sich besonders mit dem römisch-kanonischen Recht, das er in seinen juristischen Werken erläutert. Oft tritt er nur als Herausgeber fremder Arbeiten auf; aber auch im Hinblick auf den Inhalt seiner eigenen Schriften ist es berechtigt, ihn nicht als Neuerer, sondern als „Popularisator“ des römischen Rechts zu bezeichnen (Rosenfeld).
Deutlich wird dies an seinen „Expositiones sive declarationes … omnium titulorum legalium“ von 1490. Es handelt sich dabei um einen Versuch, das gesamte römische Recht im Überblick darzustellen. B. schloß so eine damals vorhandene Lücke, die daher rührte, daß die üblichen breiten Exegesen einzelner Teile des Rechts dem Studenten eine Gesamtschau erschwerten. Man kann die „Expositiones“, die aus B.s Vorlesungen hervorgingen, mit unseren heutigen Lehrbüchern vergleichen. Wegen der geringen Durchdringung des Stoffes – B. hielt sich bei der Gliederung genau an die überlieferte Anordnung der oberitalienischen Glossatoren – ist dieses Werk zur populären Rechtsliteratur des |87|15./16. Jhs. zu zählen. B.s Name trug zur überaus großen Verbreitung dieses Buches bei.
1509 lieh er diesen Namen der Herausgabe von → Ulrich TenglersTengler, Ulrich (um 1447 – um 1522) Laienspiegel, für den er ein empfehlendes Vorwort schrieb. Den Klagspiegel, der allgemein mit B. in Verbindung gebracht wird, gab er 1516 nach einer älteren Vorlage heraus. Zusammengestellt worden war dieses Werk, das Formulare für zivil- und strafrechtliche Klagen aufführt und erläutert, wohl schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts von einem gelehrten Juristen. Der von B. hinzugefügte Vorspruch zum ersten Teil wirft ein Licht auf die Zielsetzung des Buches und der ganzen populären Literatur der Rezeptionszeit:
„… Teutsch red ich mit lateinischer zungen
Darumb hab man der wort wol acht
Die ausz lateyn seind teütsch gemacht
Die seind (so vil möglich gewesen)
Verteütscht das jeder die mag lesen
Daraus nemen guten verstandt
Mich hat gemustert Doctor Brant
Und den Clagspiegel recht genannt.“
B.s kritische Haltung ging über die vorgefundene Ordnung nicht hinaus: „So wenig Brant als bahnbrechend wirkt, steht er doch als ein Abschluß, eine letzte große Zusammenfassung am Ende des Mittelalters, allen moralischen und politischen Ideen der vergangenen Jahrhunderte noch einmal Gestalt gebend. Er neben Kaiser Maximilian: Mittelalterliches Rittertum neben mittelalterlichem Bürgertum“ (R. Westermann).
Hauptwerke: Expositio omnium titulorum iuris civilis et canonici, 1488(?), 1490, weitere Aufl. im 16. Jh. – Das Narrenschiff (1494), moderne Ausgaben: F. Zarncke, 1854 (Ndr. 1961); H.-J. Mähl (übers. v. H.A. Junghans), 2012; M. Lemmer, 2004; J. Knape, 2005. – Varia Sebastiani Brant Carmina, 1498. – (Hrsg.) Der richterlich Clagspiegel. Ein nutzbarlicher begriff, wie man setzen unnd formieren sol nach ordnung der Rechte ein yede Clag, Antwurt, und außsprechene Urteilen, 1516 (zahlreiche weitere Aufl. im 16. Jh.). – Flugblätter (hrsg. v. P. Heitz), 1915. Bibliographie: J. Knape u.a.: Sebastian Brant Bibliographie, 2015.
Literatur: K. Bergdolt u.a (Hrsg:): Sebastian Brant und die Kommunikationskultur um 1500, 2010. – H. Coing: Römisches Recht in Deutschland (= IRMAE V 6), 1964, 206f. – A. Deutsch: Der Klagspiegel und sein Autor Conrad Heyden, 2003. – Ders.: Klagspiegel, in: HRG2 II (2012), 1864–1869. – W. Gilbert: Sebastian Brant, Conservative Humanist, in: Arch. f. Reformationsgeschichte 46 (1955), 145–167. – G. Kisch: Die Anfänge der Juristischen Fakultät der Universität Basel 1459–1529, 1962, bes. 77–81, 284, 355. – J. Knape: Dichtung, Recht und Freiheit: Studien zu Leben und Werk Sebastian Brants 1457–1521, 1992. – J. Knepper: Nationaler Gedanke und |88|Kaiseridee bei den elsässischen Humanisten, 1898, 79–106. – H.-J. Mähl: Sebastian Brants Leben und Werk, in: Brant: Das Narrenschiff (hrsg. v. H.-J. Mähl, s.o.). – S. Mausolf-Kiralp: Die „traditio“ der Ausgaben des Narrenschiffs, 1997. – R. Newald: Elsässische Charakterköpfe aus dem Zeitalter des Humanismus, 1944, 85–110. – H.-G. Roloff (Hrsg.): Sebastian Brant (1457–1521), 2008. – Friedrich Schultz: Nachwort zu: Brant: Flugblätter (hrsg. v. P. Heitz) s.o. – Stintzing-Landsberg: GDtRW I, 93–95. – R. v. Stintzing: Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland, 1867 (Ndr. 1959), 45–47, 337–408 (Klagspiegel), 451–462. – O. Stobbe: Geschichte der deutschen Rechtsquellen II, 1864, 167–170. – R. Westermann: Sebastian Brant, in: Verfasserlex. d. dt. MA (hrsg. v. W. Stammler) I (1933), 276–289. – R. Wiethölter: Rechtswissenschaft, 1968, 32. – T. Wilhelmi: Sebastian Brant, 3 Teile, 1990. – T. Wilhelmi (Hrsg.): Sebastian Brant. Forschungsbeiträge zu seinem Leben, zum „Narrenschiff“ und zum übrigen Werk, 2002. – E.H. Zeydel: Sebastian Brant, 1967. – E.H. Zeydel: Wann wurde Sebastian Brant geboren? in: Zeitschr. f. dt. Altertum u. Lit. 95 (1966), 319. – ADB 3 (1876), 256–259 (Steinmeyer). – HRG2 I (2008), 663–665 (K.-P. Schroeder). – Jur., 98f. (J. Otto). – Jur.Univ I, 566–569 (A. Massferrer). – NDB 2 (1955), 534–536. (H. Rosenfeld). Bibliographie: J. Knape/D. Wuttke: Sebastian-Brant-Bibliographie (Forschungsliteratur von 1800–1985), 1990.
P.