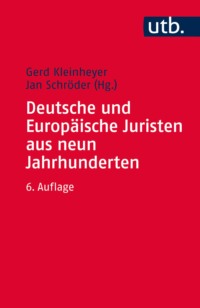Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 9
[Zum Inhalt]
|63|Karl BindingBinding, Karl (1841–1920)
(1841–1920)

Geb. am 4.6.1841 in Frankfurt a.M. 1860–1863. Studium der Geschichte (bei Waitz, Lotze, Ernst Curtius) und der Rechtswissenschaften (u.a. bei H.A. Zachariä und Emil Herrmann) in Göttingen. 1863 Promotion. 1864 Habilitation in Heidelberg (bei → MittermaierMittermaier, Karl Josef Anton (1787–1867)) für Strafrecht und Strafprozeßrecht. Aufnahme der Lehrtätigkeit im Wintersemester 1864/65. Herbst 1866 Annahme des Rufs nach Basel auf einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht (Strafrecht, Rechtsphilosophie und Kirchenrecht). 1870 Übernahme einer Professur in Freiburg i.Br., 1872 Annahme eines Rufes nach Straßburg. Ab 1873 Professor in Leipzig, dort auch Tätigkeit im Spruchkollegium der Fakultät; 1879 bis 1900 außerdem Hilfsrichter am Landgericht Leipzig. 1892 und 1909 (bei der Fünfhundertjahrfeier der Universität) Rektor der Universität Leipzig. 1913 Emeritierung und Übersiedlung nach Freiburg i.Br. Dort am 7.4.1920 gestorben.
Als B.s bedeutendstes Werk auf dem Gebiet der Strafrechtsdogmatik gilt seine Normentheorie, die ihn fast fünfzig Jahre beschäftigt hat. Sie geht von der Feststellung aus, daß der Verbrecher, z.B. der Dieb, das Strafgesetz nicht übertritt, sondern erfüllt („Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen … wegnimmt“). Wenn man gleichwohl den Diebstahl als „Übertretung“ bezeichnet, so deswegen, weil dem Strafgesetz Ge- und Verbote, „Normen“, vorgelagert sind (z.B. „Du sollst nicht fremde bewegliche Sachen wegnehmen!“), gegen die der Verbrecher verstößt. Diese Normen lassen sich aus dem Strafgesetz erschließen, sie haben wie dieses die Qualität von Rechtssätzen. Aus den Normen wiederum lassen sich Werturteile entnehmen. Nach der Richtigkeit dieser Werturteile hat der Jurist nicht zu fragen. B. sieht das Verhältnis der Normen zum Strafgesetz als vergleichbar dem zivilrechtlichen von Recht auf Sachleistung zum Recht auf Schadensersatz: Das aus der Norm resultierende Recht des Staates „auf Botmäßigkeit“ verwandelt sich im Fall der Normverletzung in ein „Recht auf Zwang |64|wegen Ungehorsams“, in das (subjektive) staatliche Strafrecht. – Auf die Normen gründet B. nun sein Strafrechtssystem. „Delikt“ ist für ihn die schuldhaft normwidrige Handlung, „Verbrechen“ das Delikt, „soweit es strafbar ist“. Diese Unterscheidung ist charakteristisch für B.s Normenlehre, sie beruht auf seiner Ansicht, daß das Gesetz nicht jeden Normverstoß unter Strafe stelle. Die Norm (z.B. „Du sollst nicht fremde Sachen beschädigen“) verbiete nämlich nicht nur die vorsätzliche, sondern auch die fahrlässige Begehung des jeweiligen Delikts, das Strafgesetzbuch bestrafe aber nur in Ausnahmefällen auch die fahrlässige Begehung (z.B. ist fahrlässige Sachbeschädigung nach dem StGB nicht strafbar).
In der von B. vertretenen Form hat sich die Normentheorie im Strafrecht nicht durchsetzen können. Immerhin sind mindestens zwei wichtige Dogmen der gegenwärtigen Strafrechtslehre auf sie zurückzuführen. Das eine ist die Figur der „objektiven Strafbarkeitsbedingungen“, die ohne die Unterscheidung von Verbotsnorm und gesetzlicher Strafbarkeit nicht möglich wäre, das andere die von B. gegen die ältere Theorie „error iuris nocet“ energisch verfochtene Lehre von der Beachtlichkeit des Verbotsirrtums. Sie ergibt sich zwangsläufig aus der Normentheorie: gegen den Normbefehl kann nur der verstoßen, der konkret um ihn weiß. Im Ergebnis nähert sich B.s Lehre vom Verbotsirrtum sehr stark der jetzt in § 17 StGB verankerten sog. „Schuldtheorie“. – Darüber hinaus muß die Bedeutung der Normentheorie für die allgemeine Rechtslehre hervorgehoben werden: sie hat den Blick für „imperative“ Strukturen des Rechts geschärft, deren Ausschließlichkeit B. allerdings selbst – mit Recht – nicht anerkannte.
Durch sein Lehrbuch des Besonderen Teils des Strafrechts hat B. auch die Dogmatik der Einzeldelikte stark beeinflußt. Als für die Gegenwart vorbildlich hat sich seine Gliederung der Verbrechen nach der Art des verletzten „Rechtsguts“ erwiesen, die aus der Normentheorie, nach der die Normen dem Rechtsgüterschutz dienen, folgerichtig hervorging. B. wich damit von der, z.B. in A.F. Berners einflußreichem Lehrbuch zugrunde gelegten, Legalordnung des StGB ab, wie auch von der Systematik → FeuerbachsFeuerbach, Paul Johann Anselm (1775–1833), die im wesentlichen auf der Begehungsweise der Delikte aufgebaut war. Im einzelnen bringt das Lehrbuch, das als erste wissenschaftliche Bearbeitung der Einzeldelikte des StGB angesehen werden muß, eine Fülle von Erkenntnissen; auch heute noch ist es für die Beschäftigung mit vielen Problemen des Besonderen Teils unentbehrlich. Als besonders wichtig seien hervorgehoben: die „Substanztheorie“ des Diebstahls, die in der Gegenwart mit guten |65|Gründen wieder belebt wird, der lange Zeit einflußreiche „juristische“ Vermögensbegriff beim Betrug und die „normative“ Ehrauffassung bei den Beleidigungsdelikten.
Ein weniger geschlossenes Bild als seine Strafrechtsdogmatik bietet B.s Straftheorie. Im Vordergrund steht für ihn der schon von Kant mit besonderer Schärfe betonte Vergeltungscharakter der Strafe. Hierbei weist B. die wohl auf Hegel zurückgehenden „Heilungstheorien“ – auf Grund eines naturalistischen Mißverständnisses der Hegelschen „Aufhebung der Verletzung“ durch Strafe – zurück; er sieht in der Strafe nur die „Bewährung der Rechtsherrlichkeit durch Beugung des Verbrechers unter den Rechtszwang“. Als Nebenzweck erkennt er aber bei dazu geeigneten Strafarten die Spezialprävention an. Auch die → FeuerbachFeuerbach, Paul Johann Anselm (1775–1833)sche Lehre von der generalpräventiven Wirkung der gesetzlichen Strafdrohung lehnt er nicht gänzlich ab, wenn er auch eine Abschreckungswirkung nur in begrenztem Umfang für möglich und eine Rechtfertigung der Strafe selbst unter dem Gesichtspunkt der Generalprävention für ausgeschlossen hält. Der ganz auf die Spezialprävention abgestellten „soziologischen Schule“ → Franz v. LisztsLiszt, Franz v. (1851–1919) stand B. mit seiner „klassischen“ Haltung scharf ablehnend gegenüber; zu dem aus dieser Gegnerschaft resultierenden „Schulenstreit“ trug er in scharfen Polemiken bei: Er konnte in jener Lehre, die nach seiner Deutung alle Menschen zu Wahnsinnigen degradierte, nur „rechtlichen Nihilismus“ sehen und meinte, sie liefe auf die „einzige Maßnahme, die radikal helfen würde: die Abschaffung des Menschen überhaupt“ hinaus.
Die übliche Einordnung von B.s strafrechtlichem Werk unter das Schlagwort „Gesetzespositivismus“ trifft nur zum Teil das Richtige. Gesetzespositivist ist B. zwar in der Tat insofern, als er jede außerhalb des Gesetzes liegende Rechtfertigung des Strafrechts für überflüssig und wohl auch unmöglich hält („Hinter Verbot und Gebot beginnt aber für den, der nach der Rechtswidrigkeit sucht, tiefster undurchdringlicher Nebel“). Gleichwohl drängt bereits die Normentheorie mit ihrer Trennung von schuldhaft normwidrigem und strafbarem Verhalten über das positive Recht hinaus: In der von B. vertretenen Form, nach der die Verbote für fahrlässige und vorsätzliche Rechtsgüterverletzung identisch sind, kommt sie zu für die staatliche Rechtsordnung unbekannten Verboten, z.B. dem der fahrlässigen Ehrverletzung. Überhaupt betont B. wiederholt, daß auch der Gesetzgeber an die Eigengesetzlichkeit des Rechtsstoffs (z.B. an den Unterschied zwischen Tat- und Verbotsirrtum, zwischen Täterschaft und Teilnahme) gebunden sei, wenn |66|es ihm auch freistehe, wie er die strafrechtlichen Folgen z.B. dieser Irrtums- oder Teilnahmefälle regelt. Unpositivistisch ist ferner B.s Einstellung zu dem Problem der richterlichen Gesetzesanwendung, wie sich an seiner im Zusammenhang mit der Vorschrift des StGB über die Rechtsbeugung (§ 336) stehenden, fast freirechtlich klingenden Äußerung zeigt: „Für jeden Richter ist nur seine Auslegung des Gesetzes Gesetz.“ Schließlich paßt auch sein Kampf gegen den Grundsatz „nulla poena sine lege“ (→ FeuerbachFeuerbach, Paul Johann Anselm (1775–1833)) in diesen Zusammenhang.
Neben B.s strafrechtlichen Werken und seiner nach den Grundsätzen der Ranke-Waitzschen Schule geschriebenen „Geschichte des burgundisch-romanischen Königreichs“ steht eine Reihe von staatsrechtlichen Schriften. Von ihnen ist die Arbeit über „Die Gründung des Norddeutschen Bundes“ hervorzuheben. In ihr führt B. den Begriff der „Vereinbarung“, als der gemeinsamen Verpflichtung zu gleichartigem zukünftigem Verhalten, ein, den er im Gegensatz zum Begriff des Vertrages (Leistungsaustausch auf Grund gegensätzlicher Interessen) stellt. Der Begriff der „Vereinbarung“ ist durch Heinrich Triepel zum festen Bestandteil des völkerrechtlichen Begriffskanons geworden und hat sich auch im Staats- und Verwaltungsrecht als fruchtbar erwiesen.
Hauptwerke: Die Geschichte des burgundisch-romanischen Königreichs 1868. – Die Normen und ihre Übertretung, 4 Bde. Bd. I: 1872, 31916, Bd. II: 1877. Teil 1: 1914, Teil 2: 21916, Bd. III: 1918, Bd. IV: 1919. – Grundriß des gemeinen deutschen Strafrechts, Allgemeiner Teil, 1879, 51913. – Grundriß des deutschen Strafprozeßrechts, 1881, 51904. – Handbuch des Strafrechts, Bd. I (einziger), 1885. – Die Gründung des norddeutschen Bundes, 1889. – Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts, Besonderer Teil, 2 Bde. Bd. I: 1896, 21902, Bd. II,1: 1901 21904 Bd. II,2: 1905. – Die Entstehung der öffentlichen Strafe im germanisch-deutschen Recht, 1909. – Strafrechtliche und strafprozessuale Abhandlungen, 2 Bde., 1915. – Die staatsrechtliche Verwandlung des deutschen Reiches, 1919. – Zum Werden und Leben der Staaten, 1920. – (zusammen mit A. Hoche) Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form, 1920, 21922 (s. dazu die Jenaer Diss. von K. Hammon, 2011).
Literatur: H. Achenbach: Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen Schuldlehre, 1974, 27–36. – E. v. Bubnoff: Die Entwicklung des strafrechtlichen Handlungsbegriffs von Feuerbach bis Liszt unter besonderer Berücksichtigung der Hegelschule, 1966, 110–127. – Döhring: GDtRPfl., 377. – H.J. Kaganiecz: Karl Bindings Wirken für den Rechtsstaat, Diss. jur. Münster, 1950. – Armin Kaufmann: Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954 (erw. Nachdr. 1988). – R. Müller: Die Normentheorie von Karl Binding, Diss. jur. Tübingen, 1955. – J. Nagler: Karl Binding zum Gedächtnis, in: Der Gerichtssaal 91 (1925), 1–66. – H. Rauch: Die klassische Strafrechtslehre in ihrer politischen Bedeutung, |67|1936, Ndr. 1970. – Schmidt: Einführung, 304–310, 386–388. – H.-L. Schreiber: Gesetz und Richter, 1976, 169ff. – S. Stübinger: Schuld, Strafrecht und Geschichte, 2000, 260–267. – H. Suhr: Karl Binding und das liberale Strafrecht des 19. Jahrhunderts, Diss. jur. Göttingen, 1945. – D. Westphalen: Karl Binding (1841–1920). Materialien zur Biographie eines Strafrechtsgelehrten, Diss. jur. Frankfurt am Main, 1989. – HRG2 I (2008), 594 (A. Koch). – Jur., 86f. (D. Westphalen). – Jur.Univ. II, 498–501 (J.N. Silva Sánchez). – NDB 2 (1955), 244f. (H. Triepel). – StL 2 (1958), 33–35 (Arthur Kaufmann).
S.
[Zum Inhalt]
Sir William BlackstoneBlackstone, Sir William (1723–1780)
(1723–1780)

Geb. am 10.7.1723 in London, 1730–1738 Schulausbildung an der Charterhouse Schule, ab 1738 am Pembroke College an der Universität Oxford. Ab 1741 absolviert B. auf der Rechtsschule Middle Temple die Ausbildung zum Anwalt (barrister) und erhält 1746 die Zulassung. Seine juristische Ausbildung ergänzt er als Mitglied des All Souls College in Oxford 1745 durch den Abschluß eines Bachelors und 1750 durch den Doktortitel. Als Anwalt ist B. wenig erfolgreich; zwar wird er 1749 nebenamtlicher Richter (recorder) im Stadtbezirk Wallingford, Berkshire, und ab 1751 sachverständiger Beisitzer des Chancellor’s Court in Westminster, aber der große Erfolg „at the bar“ bleibt ihm versagt. 1753 wendet sich B. der Lehrtätigkeit und dem akademischen Leben in Oxford zu. Seine Vorlesungen über das englische Recht, die ersten, die überhaupt an einer englischen Universität gehalten werden, finden großen Anklang. Eine Stiftung von Charles Viner ermöglicht es, einen Lehrstuhl für englisches Recht in Oxford einzurichten, den B. ab Oktober 1758 bekleidet. Nicht zufrieden allein mit seinem akademischen Wirkungskreis, wendet sich B. weiteren Aufgaben in London zu. 1761 wird er sowohl Vorstandsmitglied (bencher) von Inner Temple als auch Abgeordneter im |68|Unterhaus und Anwalt der Krone (King’s Counsel). Im gleichen Jahr heiratet er Sarah Clitherow. B.s insgesamt neunjährige parlamentarische Tätigkeit ist nicht herausragend, denn es fehlt ihm ein wirkliches Interesse an Politik, und so beschränken sich seine Beiträge auf juristische und verfassungsrechtliche Fragen. 1763 erhält B. das zweithöchste der juristischen Ämter und wird Vertreter des Kronanwalts (Queen’s Solicitor General). Aufgrund seiner vielfältigen Ämter verbleibt B. immer weniger Zeit für die Lehre, und 1766 gibt er alle Verpflichtungen in Oxford auf. Ab 1770 bekleidet B. ein Richteramt am höchsten Gericht für Zivilstreitigkeiten, dem Court of Common Pleas. B. stirbt am 14.2.1780 im Alter von 57 Jahren in Wallingford, Oxfordshire.
B.s wichtigstes und berühmtestes Werk „Commentaries on the Laws of England“ geht aus seinen Oxforder Vorlesungen hervor. 1765 erscheint der erste von vier Bänden, die restlichen folgen in den nächsten vier Jahren. Auf 2000 Seiten breitet B. darin die Struktur des englischen Rechts aus und faßt die wichtigsten Prinzipien des Common Law zusammen. Die „Commentaries“ beginnen mit der berühmten Einleitung über „The Study, Nature, and Extent of the Law“. Das erste Buch behandelt „Rights of Persons“ sowie die Rolle des Parlaments, die Krone, Judikative und Rechte der Staatsbürger. Im zweiten Buch („The Rights of Things“) folgen Eigentums- und Grundstücksrecht, Buch drei („Private Wrongs“) thematisiert die Verletzung von Bürgerrechten und die Rechtsmittel der Betroffenen, und im vierten und letzten Buch („Public Wrongs“) befaßt sich B. mit dem Strafrecht. B. legt damit die – leicht modifizierte – römischrechtliche Institutionenordnung (personae, res, actiones) zu Grunde, die auch im zeitgenössischen kontinentalen Recht häufig zur Grundlage „wissenschaftlicher“ Gesamtdarstellungen des Rechtssystems gemacht wurde.
Mit den „Commentaries“ hat sich B. das Ziel gesetzt, ein Werk über das englische Recht als Ganzes zu verfassen, das zudem noch durch seine allgemeinverständliche und unkomplizierte Darstellungsweise eine breite Leserschaft anspricht. Daß B. dieses Ziel erreicht hat, zeigt sich an dem großen Einfluß der „Commentaries“ sowohl in England, als auch in Nordamerika, wo B.s Werk bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts als Grundlage der juristischen Universitätsausbildung dient; es ist damals das wichtigste einführende Lehrbuch in die Materie des englischen Rechts. Nach Übersetzungen ins Französische und Deutsche wird B.s Werk auch in Kontinentaleuropa als Überblick über das englische Recht berühmt. Die „Commentaries“ erscheinen allein bis 1800 in zwölf Neuauflagen, bis heute sind es über vierzig.
|69|B. unternimmt in seinen „Commentaries“ den Versuch, eine genaue Beschreibung der undurchsichtigen Praxis englischer Rechtsanwendung zu geben. Das von B. vorgefundene englische Recht entstammt vielen verschiedenen Rechtsquellen: zum einen dem umfangreichen „Common Law“, einem ursprünglich auf Gewohnheitsrecht beruhenden, durch richterliche Entscheidungen weiterentwickelten, lange Zeit auch ungeschriebenen Recht; zum anderen dem eigenständigen Normenbereich der „Equity“ und daneben noch dem vom Parlament erlassenen Recht („statute law“). B. muß für seine Aufgabe, eine umfassende Darstellung zu schaffen, den undurchsichtigen Rechtsstoff zusammenstellen, neu gliedern und derart in einen kohärenten Zusammenhang bringen, daß ein vernünftig aufgebautes und zusammenhängendes System entsteht. Der leitende Gedanke, den Rechtsstoff zu systematisieren, stammt zwar aus der Aufklärung, B.s Umsetzung dieses Gedankens ist jedoch nicht zu vergleichen mit der streng deduktiven Methodik vernunftrechtlicher Systematiker wie → WolffWolff, Christian (1679–1754), → PufendorfPufendorf, Samuel (1632–1694), → DomatDomat, Jean (1625–1696) oder → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph. Diese beginnen mit einer naturrechtlichen Grundlegung abstrakter Prinzipien und entwickeln daraus deduktiv ein Rechtssytem; B.s methodisches Vorgehen ist dagegen stets historisch-empirisch. Ausgangspunkt ist das vorhandene englische Recht, an dessen Vernünftigkeit B. mit einer konservativen, dem Historismus entstammenden Haltung festhält. Die aufklärerischen und naturrechtlichen Ideen seiner Zeit fließen zwar ebenfalls ein, werden jedoch nicht zu methodisch anleitenden Prinzipien. Es soll kein neues besseres Recht geschaffen werden, um das alte zu ersetzen oder zu kritisieren. Das englische Recht in seinen historisch gewachsenen Formen ist Gegenstand der Bewunderung und Verehrung; zu leisten ist lediglich eine logisch schlüssige und widerspruchsfreie Darstellung. Die Institutionen des Common Law erscheinen B. als einzigartig und in ihrer Perfektion dem „statute law“ überlegen. Das gewachsene englische Recht ist für B. Garant der Stabilität und Kontinuität einer Gesellschaftsordnung, die er als gerecht und anderen Sozialordnungen überlegen bewertet. B.s Verklärung des traditionellen Rechts und der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse fordert 1776 seinen schärfsten Kritiker, → Jeremy BenthamBentham, Jeremy (1748–1832), zu einer vernichtenden Analyse heraus. Am Anfang des 19. Jahrhunderts ist B.s Reputation als großer englischer Rechtsgelehrter überschattet von den Einwänden der Reformbewegung um → BenthamBentham, Jeremy (1748–1832), die ihn als verknöcherten, reformfeindlichen Konservativen darstellt. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts erlebt B.s Werk eine Rehabilitierung durch die Historische Schule um → Sir Henry MaineMaine, Sir Henry James Sumner (1822–1888).
|70|Hauptwerke: An Analysis of the Laws of England, 1756. – Law Tracts in Two Volumes, 1762. – Commentaries on the Laws of England, 4 Vol., 1765–69, 181829, dt. Übers.: Handbuch des englischen Rechts im Auszuge …, v. H.F.C. v. Colditz, Vorrede v. N. Falck, 2 Bde., 1822/23.
Literatur: J. Bentham: A Comment on the Commentaries, hrsg. von J.H. Burns, H.L.A. Hart, 1977. – D.J. Boorstin: The Mysterious Science of Law. An Essay on Blackstone’s Commentaries, 1941. – J.W. Cairns: Blackstone, An English Institutist: Legal Literature and the Rise of the Nation State, in: Oxford Journal of Legal Studies 4 (1984), 318–360. – Ders.: Blackstone, the Ancient Constitution and the Feudal Law, in: Historical Journal 28 (1985), 711–717. – P. Carrese: The Cloaking of Power: Montesquieu, Blackstone, and the Rise of Judicial Activism, 2003. – A.V. Dicey: Blackstone’s Commentaries, in: Cambridge Law Journal 4 (1932), 286–307. – I.G. Doolittle: William Blackstone:a Biography, 2001. – D. Douglas: The Biographical History of Sir William Blackstone, 1782, reprinted 1971. – A. Guzmán-Brito: La doctrina de la „consideration“ en Blackstone y sus relaciones con la „cause“ en el „ius commune“, 2004. – H.G. Hanbury: The Vinerian Chair and Legal Education, 1958. – W. Holdsworth: A History of English Law, vol. 12, 1938. – Ders.: Blackstone’s Treatment of Equity, in: Harvard Law Review 43 (1929), 1–32. – Ders.: Gibbon, Blackstone and Bentham, in: Law Quarterly Review 52 (1936), 46–59. – A.J. Laeuchli/J.E. Mooney (Hrsg.): A Bibliographical Catalog of William Blackstone, 2015. – D. Liebermann: The Province of Legislation Determined: Legal Theory in Eighteenth-Century Britain, 1989. – M. Lobban: Blackstone and the Science of Law, in: Historical Journal 30 (1987), 311–335. – P. Lucas: Blackstone and the Reform of the Legal Profession, in: English Historical Review 77 (1962), 456–489. – Ders.: Ex parte Sir William Blackstone, „Plagiarist“: A Note on Blackstone and Natural Law, in: American Journal of Legal History 7 (1963), 142–158. – S.F.C. Milsom: The Nature of Blackstone’s Achievement, in: Oxford Journal of Legal Studies 1 (1981), 1–12. – R.A. Posner: Blackstone and Bentham, in: Journal of Law and Economics 19 (1976), 569–606. – K. Temple: What’s Old Is New Again. William Blackstone’s Theory of Happiness Comes to America, in: The Eighteenth Century. TEC. Philadelphia, 55, 2014, 129–134. – R. Willman: Blackstone and the „Theoretical Perfection“ of English Law in the Reign of Charles II, in: Historical Journal 26 (1983), 39–70. – HRG² I (2008), 614–616 (U. Seif). – Jur., 87–89 (K. Lerch). – Jur.Univ. II, 634–641 (I. Cremades).
N. Dearth