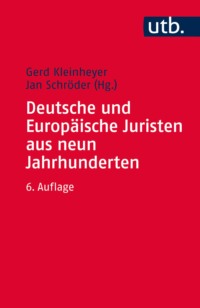Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 12
[Zum Inhalt]
Cornelis van BynkershoekBynkershoek, Cornelis van (1673–1743)
(1673–1743)

Am 29.5.1673 in Middelburg als Sohn eines Segelmachers geboren. Nach Besuch der städtischen Lateinschule 1689, wohl auf Wunsch seiner Eltern, Beginn des Theologiestudiums in Franeker. Nach einem Brief des Professors Cornelis van Eck an die Eltern von B. stimmen diese zu, dass er 1691 zum Studium der Rechtswissenschaft vor allem bei Cornelis van Eck und → U. HuberHuber, Ulrich (1636–1694) wechselt. 16.5.1694 promoviert B. mit der Schrift „Disputatio de pactis juris stricti contractibus in continenti adjectis“. Danach Niederlassung als Rechtsanwalt in Den Haag, wo er zehn Jahre tätig ist. 1704 wird B. Ratsherr beim Großen Rat von Holland, Seeland und Westfriesland. 1724 wird er dessen Präsident. B.s Temperament führt auch zu |89|per sönlich gefärbten Kontroversen mit anderen Juristen. So bezeichnet B. den Groninger Professor Alexander Arnold Pagenstecher als „schwächlichen Denker, Dieb, Schwindler, Vertreter unsinniger juristischer Wahrheiten, übellaunigen Menschen“ und wünscht ihm „Lebe wohl, aber nicht um deinet- oder der Jurisprudenz willen, sondern deiner Frau und Deiner Kinder wegen“. Auch führt B. mit → NoodtNoodt, Gerard (1647–1725) einen Streit über die Frage, ab wann es in Rom verboten war, Kinder auszusetzen. B. stirbt am 16.4.1743 in Den Haag.
B. ist einer der letzten Vertreter der eleganten niederländischen Schule (die deutsche Terminologie ist uneinheitlich und folgt hier R. Zimmermann), einer Strömung in der niederländischen Rechtswissenschaft vom Ende des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, zu der man außer B. auch Brenkman, → NoodtNoodt, Gerard (1647–1725), Schultingh, Vinnius und wohl auch → U. HuberHuber, Ulrich (1636–1694) rechnet. Diese Schule stellt eine Weiterentwicklung des „mos Gallicus“ (→ AlciatAlciatus, Andreas (1492–1550), BudaeusBudaeus, Guilelmus (Guillaume Budé) (1467–1540)) dar, während der gleichzeitige Usus modernus den „mos Italicus“ fortentwickelt. Ziel der eleganten niederländischen Juristen war es, das klassische römische Recht von den Verfälschungen des Mittelalters zu reinigen; sie bedienten sich dabei humanistischer, historischer und philologischer Methoden, wie etwa Textkritik, Interpolationenforschung, Palingenesie und Altertumsforschung. Allerdings geschah dies selbst bei den Anhängern der antiquarischen Richtung (→ NoodtNoodt, Gerard (1647–1725)) im Blick auf das geltende gemeine Recht, das zudem mit örtlichem aktuellem Recht und naturrechtlichen Erwägungen verbunden wurde. Die Bedeutung der niederländischen eleganten Schule wurde von der historischen Rechtsschule in den Schatten gestellt. Der junge → SavignySavigny, Friedrich Carl v. (1779–1861) steht ihr noch eher positiv gegenüber; später wirft er ihr eine Beschränkung auf Details und ein Arbeiten ohne Methode und System vor.→ JheringJhering, Rudolf von (1818–1892) behauptet sogar, das wahrhafte, nämlich juristische und nicht rechtshistorische, Verständnis des römischen Rechts sei durch die elegante niederländische Schule um nichts gefördert und der juristische Sinn durch sie mehr auf Abwege geführt worden. Heute werden die Leistungen der niederländischen eleganten Schule wieder positiv beurteilt. Sie hat durch die Weiterentwicklung der Rechtswissenschaft nach dem mos Gallicus dem römischen Recht den Weg zu weiterer Bedeutung gewiesen und dessen Erforschung durch ihre Methodik in wissenschaftlichere Bahnen gelenkt. Außerdem haben ihre Vertreter das Verdienst, das gemeine Recht mit dem zeitgenössischen Recht in Verbindung gesetzt zu haben.
|90|B. hat das römisch-holländische Recht durch seine Rechtsprechung auf dem Hintergrund der eleganten niederländischen Schule und seine ebenfalls in dieser Tradition stehenden Observationes juris romani (1733) mit geprägt. Darüber hinaus ist B. heute vor allem aus zwei Gründen bekannt:
Zum einen war er für die Entwicklung des Völkerrechts wichtig. In seiner Schrift „De dominio maris dissertatio“ (1702) untersucht B., wie schon vor ihm → GrotiusGrotius, Hugo (Huig de Groot) (1583–1645), die Frage, ob am Meer Eigentum bestehen könne. Anders als → GrotiusGrotius, Hugo (Huig de Groot) (1583–1645) nimmt B. dies im Grundsatz an. Die Grenze des Eigentums zieht er da, wo die Macht des Staates aufhört, die See beherrschen zu können, also zu seiner Zeit die Reichweite der Geschütze. Dies entspricht der lange anerkannten 3-Meilen-Zone. Anders als → GrotiusGrotius, Hugo (Huig de Groot) (1583–1645) vermeidet B. durch die grundsätzliche Eigentumsfähigkeit systemwidrige Ausnahmen für bestimmte Küstenbereiche. Weitere völkerrechtlich relevante Aussagen B.s finden sich in dem Buch „De foro legatorum“ (1721), in dem sich B. mit der Jurisdiktion über Gesandte sowohl in zivilrechtlicher, als auch in strafrechtlicher Sicht äußert und in den „Quaestionum juris publici libri duo“ (1737), in denen sich u.a. Aussagen B.s zum Neutralitätsbegriff finden.
Zum anderen gewährt B. auch einen hervorragenden Einblick in die Gerichtstätigkeit des Großen Rates. B. hat nämlich zu den von ihm entschiedenen Fällen neben seiner Entscheidung auch Gedanken darüber, Einzelheiten aus der geheimen Beratung und abweichende Meinungen aufgeschrieben. Nach seinem Willen sollten diese Aufzeichnungen nie veröffentlicht werden und waren auch lange Zeit verschollen. Doch wurden sie 1914 wieder aufgefunden und sind ab 1926 unter dem Titel „Observationes tumultuariae“ erschienen.
Hauptwerke: Disputatio de cumulatione et concursu actionum, 1692. – Disputatio universi juris feudalis delineationem exhibens, 1693. – Disputatio pro eunomia Romana, 1693. – Disputatio de pactis, juris stricti contractibus in continenti adjectis, 1694 (1697, 1699). – De auctore auctoribusve authenticarum diatriba, 1697 (1699). – Ad legem „Lecta“ XL Dig. De rebus creditis si certum petatur, liber singularis, 1699. – De dominio maris dissertatio, 1702 (1703). – Ad legem axiosis IX De lege Rhodia de jactu, liber singularis, 1703. – Observationum juris romani libri IV, 1710 (1735). – Opuscula varii argumenti …, 1719 (1729, 1743, 1749, 1752). – De foro legatorum, tam in causa civili quam criminali, liber singularis, 1721. – De jure occidendi et exponendi liberos apud veteres Romanos, ad virum clarissimum Gerardum Noodt, amica responsio, 1723. – Curae secundae de jure occidendi et exponendi liberos apud veteres Romanos. Ad virum clarissimum G. Noodt, 1723 (1743). – Lectionum juris civilis libri II, 1727. – Opera minora, olim separatim, conjunctim edita, 1730. – |91|Observationum juris romani libri IV, quatuor prioribus additi, 1733 (1739), libri VIII, 1749. – Quaestionum juris publici libri duo. Quorum primus est de rebus bellicis, secundus de rebus varii argumenti, 1737. – Quaestionum juris privati libri IV. Quorum plerisque insertae sunt utriusque in Hollandia curiae res de his ipsis quaestionibus judicatae, 1744. – Opera omnia, 1744 (1752, 1761, 1767). – Observationes tumultuariae I 1926, II 1934, III 1946. Bibliographie: R. Dekkers: Bibliotheca Belgica Juridica (1951), 15ff.
Literatur: K. Akashi: C. v. Bynkershoek: His Contribution to the Development of International Law, 1996. – J.A. Ankum: De Geschiedenis der „actio Pauliana“, 1962. – G.C.J.J. van den Bergh: Der Präsident, in: Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3 (1995), 423–437. – G.C.J.J. van den Bergh: Die holländische elegante Schule, 2002, v.a. 172ff. – G.C.J.J. van den Bergh: Die Holländische Schule und die Historische Schule: Weiteres zur Geschichte eines Mißverständnisses, in: R. Feenstra/C. Coppers (Hrsg.): Die rechtswissenschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden in Historischer Sicht, 1991, 59ff. – G.C.J.J. van den Bergh: Geschichtsbewußtsein im 17. Jahrhundert. Die Verdunkelung der rechtshistorischen Leistungen der Eleganten Schule durch die Historische Schule, in: D. Simon (Hrsg.): Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages, 1987, 527ff. – G.C.J.J. van den Bergh: Palingenesia in the Dutch Elegant School, in: TRG 65 (1997), 71–84. – H. Bull/B. Kingsbury (Hrsg.): Hugo Grotius and International Relations, 1990. – A.M.M. Canoy-Olthoff/P.L. Nève: Holländische Eleganz gegenüber deutschem Usus modernus Pandectarum?, 1990. – R. Feenstra/R. Zimmermann: Das römisch-holländische Recht, 1992, 32ff. – D. Gaurier: Prises maritimes, piraterie et corsaires à travers les Quaestiones juris publici libri duo de Cornelis van Bynkershoek (1673–1743), in Annuaire de droit maritime et océanique 27 (2009), 103–221. – C.J.H. Jansen: De Hollandse Elegante School, in: Nederlands Juristenblad 2006, 2609–2612. – C.J.H. Jansen: Natuurrecht of Romeins Recht, 1987. – R.D. Kollewijn: Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap, 1937. – F. Lomonaco: Lex Regia, 1990. – J. MacDonell/E. Manson: Great Jurists of the World, 1914, 390ff. – M.S. van Oosten: Van Bijnkershoek Cornelis, Systematisch compendium der Observationes Tumultuariae, 1962. – D.J. Osler: Jurisprudentia Elegantior and the Dutch Elegant School, in: Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte 23 (1996), 339–354. – D.J. Osler: Magna jurisprudentiae injuria, in: Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte 19 (1992), 61–79. – B. Sirks: Bijnkershoek as author and elegant jurist, in: TRG 79 (2011), 229–252. – A.J.B. Sirks: Bijnkershoek over de ‘quade conduites’ van Huibert Rosenboom, president van de Hoge Raad (1691–1722), in: TRG 76 (2008), 49–94. – A.J.B. Sirks: „Sed verum est, sententias numerari, non ponderari“ (C. van Bijnkershoek, Observationes Tumultuariae 2628 & 2678), in: R. van den Bergh (Hrsg.): Ex iusta causa traditum, Essays in Honour of Eric Pool, 2004, 285–303. – O.W. Star Numan: Cornelis van Bynkershoek. Zijn leven en zijne geschriften, 1869. – T.J. Veen/P.C. Kop: Zestig Juristen, 1987, 141ff. m.w.N. (A. Krikke/S. Faber). – R. Zimmermann: Das römisch-holländische Recht für Europa, in: JZ 1990, 825ff. – A.J. van der Aa: Biographisch Woordenboek der Nederlanden Bd. 2 (1854), 1713. – HRG2 I (2008), 799f. (B. Sirks). – Jur., 111f. (R. Feenstra). – Jur.Univ. II, 503–506 (E. Zabalo).
T. Moosheimer
[Zum Inhalt]
|92|Benedikt CarpzovCarpzov, Benedikt (1595–1666)
(1595–1666)

Der eigentliche Begründer einer deutschen gemeinrechtlichen Strafrechtswissenschaft und praktisch wie wissenschaftlich vielleicht einflußreichste deutsche Jurist überhaupt wurde am 27. Mai 1595 als zweiter Sohn des gleichnamigen Juristen und Professors in Wittenberg geboren. Nach philosophischen, sehr bald aber ausschließlich juristischen Studien in Wittenberg, Leipzig und Jena 1619 Promotion in Wittenberg. Die anschließende Bildungsreise nach Süddeutschland, Italien, Savoyen, Frankreich, England und den Niederlanden muß er hier abbrechen, als er im April 1620 zum außerordentlichen Beisitzer des Leipziger Schöppenstuhles berufen wird. 1623 ordentlicher Assessor, 1633 Senior dieses Spruchkollegiums; 1636 zugleich Assessor beim Leipziger Oberhofgericht, 1639 Rat im Appellationsgericht. 1640 Ausschlagung einer Berufung an den Weimarer Hof. 1644 Berufung als kursächsischer Hofrat nach Dresden, doch schon nach vier Monaten Rückkehr nach Leipzig, wo er Ordinariat und Dekretalenprofessur an der Universität übernimmt, daneben die erste Assessur beim Hofgericht, die er nun mit dem Seniorat des Schöppenstuhles in seiner Person vereinigt. 1653 in den Geheimen Rat des Kurfürsten nach Dresden berufen, gibt C. seine anderen Ämter bis auf die Assessur beim Appellationsgericht auf. 1661 zieht er sich für das Alter nach Leipzig zurück, wo er noch fünf Jahre als Beisitzer am Schöppenstuhl wirkt. Am 30.8.1666 ist C. in Leipzig gestorben.
C.s wissenschaftliche Bedeutung ist aufs engste mit seiner Tätigkeit an den sächsischen Gerichten, insbesondere am Leipziger Schöppenstuhl verbunden. Dieses 1574 vom sächsischen Kurfürsten neu ins Leben gerufene Dikasterium, dessen Vorgänger, der Leipziger Oberhof, das angesehenste Spruchkollegium in den Gebieten des sächsischen Rechts gewesen war, verkörperte in seiner Rechtsprechung die Verschmelzung des einheimischen sächsischen, auf dem Sachsenspiegel |93|(→ EikeEike von Repgow (zw. 1180 u. 1190 – nach 1232)) beruhenden, mit dem rezipierten römischen Recht zum „gemeinen Sachsenrecht“.
Nach einem frühen staatsrechtlichen Versuch, dem wohl unter dem Einfluß der Jenaer Schule des → D. ArumaeusArumaeus, Dominicus (1579–1637) entstandenen, zwar von Unrichtigkeiten wimmelnden, doch schon das deutsche vom römischen Staatsrecht trennenden und von der großen systematisierenden Kraft seines Autors zeugenden „Commentarius in legem regiam Germanorum“ (1623), wandte sich C. einer damals neuartigen Aufgabe zu, die ihn zum Begründer einer eigenständigen deutschen Strafrechtswissenschaft werden ließ: der Erschließung der Rechtsprechung des Leipziger Schöppenstuhles und des Dresdener Appellationsgerichts durch systematische, an klare Definitionen anknüpfende, die theoretischen Zusammenhänge dieser Judikatur hervorhebende Darstellung. Auf 400 Foliobände waren die Entscheidungen des Schöppenstuhles angewachsen – eine gewaltige Menge, deren theoretische Durchdringung angesichts der präjudiziellen Bedeutung, die jeder dieser Entscheidungen zukam, an die wissenschaftlich-systematisierende Kraft C.s höchste Anforderungen stellen mußte.
1635 erschien erstmals C.s Hauptwerk, die „Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium“, 1638 der „Peinliche Inquisitions- und Achtprozeß“, durch die er die Entwicklung der Strafrechtspflege noch 120 Jahre nach seinem Tode, bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus, nachhaltig prägen sollte. Mehrere Gründe erklären wohl die Wirkung dieser fast gesetzliche Autorität genießenden Werke: die geschlossene Darstellung der angesehenen Leipziger Spruchpraxis besaß wegen ihrer Wirklichkeitsnähe besondere Überzeugungskraft, diese beruhte daneben auf der Berücksichtigung des einheimischen Rechts, das seit C. neben der bis dahin auch in Deutschland fast ausschließlich herrschenden italienischen Doktrin zunehmend wissenschaftliche Bearbeitung fand, da C. andererseits auf den italienisch-gemeinrechtlichen Lehren aufbaute und allenthalben auf das Reichsrecht der Carolina (→ SchwarzenbergSchwarzenberg, Johann v. (1465–1528)) zurückgriff, sicherte er der „Practica“ ihren Einfluß weit über den sächsischen Rechtsbereich, und schließlich mußte die differenzierte Strafzumessungslehre das Werk gerade für die Praxis unentbehrlich machen.
Diese Strafzumessungslehre resultierte aus einem Hauptanliegen C.s: die Anwendungsbereiche von poena ordinaria und extraordinaria oder arbitraria (ordentliche u. außerordentliche Strafe) voneinander abzugrenzen. Schon die Carolina hatte dem Richter unter bestimmten Voraussetzungen die Ermäßigung – wohl auch Schärfung – der |94|ordent lichen Strafe anheimgestellt. Hierfür entwickelte C. aus der Leipziger Praxis entnommene Regeln, die neben anderen Tatumständen insbesondere das Maß des Täterverschuldens berücksichtigten. Dadurch wurde die „Practica“ zum Meilenstein in der Entwicklung der Schuldlehre.
C. ist von späteren wegen der Härte des in der „Practica“ entwickelten Strafensystems als unmenschlich, bigott, ja, als „juristisches Ungeheuer“ angegriffen worden. In der Tat erschloß C., selbst frommer Lutheraner, der 53mal die Bibel gelesen haben soll und jeden Monat das Abendmahl empfing, von seiner Auffassung her, daß die Strafe den Respekt vor der Obrigkeit herstellen, spezial- und generalpräventiv wirken, insbesondere aber die Versöhnung Gottes durch Tatvergeltung am Verbrecher, ja durch dessen Ausstoßung aus der menschlichen Gemeinschaft bewirken müsse, der Todesstrafe einen weiten Anwendungsbereich, nicht nur bei Delikten gegen das Leben, sondern auch bei den Sittlichkeits- und Religionsdelikten, wo sie teilweise schon außer Übung, teilweise jedenfalls zweifelhaft war (→ GrotiusGrotius, Hugo (Huig de Groot) (1583–1645) hatte 10 Jahre zuvor das Recht zu strafen auf Delikte gegen die menschliche Gemeinschaft und einzelne Menschen beschränkt). Doch wäre die Wirkung C.s nicht erklärlich, hätte seine harte, theokratische Strafauffassung, die auf die Bibel, insbesondere auch das Alte Testament als geltendes Recht zurückgriff – nicht nur in ihrer Gliederung lehnt sich die „Practica“ an den Dekalog an –, nicht dem Geist einer Zeit entsprochen, die der Verwilderung im Gefolge des 30jährigen Krieges eine abschreckende Strafrechtspflege glaubte entgegensetzen zu müssen. Immerhin folgte aus dieser theokratischen Sicht auch die durchgehend festzustellende Weigerung C.s, die Angehörigen der höheren Stände bei der Strafverhängung zu privilegieren, und von Gerechtigkeitssinn wie Lebenserfahrung zeugt sein Beharren auf einem rationalen Beweisverfahren (Ablehnung der noch gebräuchlichen Bahrprobe) und den prozeßrechtlichen Garantien für den Angeklagten („in dubio autem mitior poena eligenda est“). Im Prozeß gegen Hexen, an deren Existenz C. keineswegs zweifelte, treten diese Garantien zurück, obwohl C. ansonsten bei den delicta excepta nur die Überschreitung des Strafmaßes, nicht ein Abgehen von den Verfahrensregeln zulassen will.
Allgemein ist C.s Dogmatik erkennbar von dem Bemühen bestimmt, die Verurteilung eines Angeklagten nicht an Beweisschwierigkeiten scheitern zu lassen. So insbesondere bei der von C. im Anschluß an die Doktrin des „versari in re illicita“ entwickelten dolus-indirectus-|95|Lehre (Zurechnung aller, auch unbeabsichtigten, wenn nur voraussehbaren Folgen eines verbotenen Handelns), die auch in heute vertretenen Lehren zu aberratio ictus, Notwehrprovokation, actio libera in causa und Rauschtat nachklingt.
Seine strafrechtlichen Werke lassen C. als den deutschen Hauptvertreter einer theokratisch-absolutistischen Staats- und Rechtsauffassung erscheinen, gegen die die Aufklärung Stellung bezog (→ HommelHommel, Karl Ferdinand (1722–1781), → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph, → WolffWolff, Christian (1679–1754)). Man griff daher im 18. Jahrhundert zu unkritisch Legenden auf, die C. für 20000 Todesurteile, die meisten davon zudem gegen Hexen, verantwortlich machten. Das Thema der Hexenverfolgungen und der Tortur war ja ausnehmend gut geeignet, die eigene Fortschrittlichkeit ins rechte Licht zu rücken, und was lag näher als die Personalisierung dieser Kritik in dem bedeutendsten Vertreter jener Epoche des gemeinen Strafrechts. Nachweisbar ist keine einzige Beteiligung C.s an einem Todesurteil gegen Hexen, im übrigen die Mitwirkung an allenfalls ca. 300 Todesurteilen – eine zwar hohe, aber für die Dauer von C.s Richtertätigkeit und die Härte der damaligen Strafdrohungen nicht eben extreme Zahl.
Ziel der aufklärerischen Kritik ist C. gerade wegen seiner strafrechtlichen Werke geworden. Das hat etwas aus dem Blickfeld geraten lassen, daß er durch die der „Practica“ folgenden, ebenfalls die Spruchtätigkeit des Leipziger Schöppenstuhles und des Dresdener Appellationsgerichts erschließenden Werke in gleichem Maße Einfluß auf die Rechtspraxis seiner Zeit ausgeübt hat – wie sich schon an den bis weit in das 18. Jh. hinein wiederholten Neuauflagen ablesen läßt sowie an den Bearbeitungen, die seine Werke noch später durch andere Autoren erfahren haben. Hervorzuheben sind insbesondere die dem Prozeß-, Privat- und Lehnrecht, daneben dem Strafrecht gewidmete Jurisprudentia forensis Romano-Saxonica (1638), die aus der Lehrtätigkeit an der Leipziger Juristenfakultät erwachsene Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis (1649), die als das erste vollständige System des protestantischen Kirchenrechts gilt und erst durch das Werk → Justus Henning BöhmersBöhmer, Justus Henning (1674–1749) abgelöst wurde, und schließlich der Processus iuris in foro Saxonico (1657). Mit Ausnahme des letzteren, das seine Autorität auch der Übernahme einiger Prinzipien des sächsischen Prozesses in das Verfahren der höchsten Reichsgerichte (Reichskammergerichtsordnung v. 1654) verdanken dürfte, beruhte der Einfluß dieser Werke im ganzen Reiche darauf, daß auch hier C. allenthalben vom gemeinen Recht ausging und die sächsische Praxis eben als – beispielhafte – Anwendung dieses Rechts darstellte.
|96|Hauptwerke: Commentarius in legem regiam Germanorum sive Capitulationem Imperatoriam iuridico-historico-politicus, 1623, 21640 (weitere Ausg. bis 1697). – Practica nova Imperialis saxonica rerum criminalium, 1635, (letzte Ausg. 1752). Dt. Übers. der Ausg. v. 1635 u. 1739: Strafrecht nach neuer kurfürstlich-sächsischer Praxis, v. D. Oehler, 2000. – Peinlicher sächsischer Inquisitions- und Achtprozeß, 1638, 61733. – Iurisprudentia forensis Romano-Saxonica secundum ordinem constitutionum D. Augusti Electoris Saxoniae, 1638 (auch u.d.T. Opus Definitionum forensium; weitere Ausg. bis 1721). – Responsa iuris electoralia, 1642 (weitere Ausg. bis 1709). – Decisiones illustres saxonicae rerum et quaestionum forensium, I 1646, II 1652, III 1654 (weitere Ausg. bis 1729). – Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis, 1649 (auch u.d.T. Opus definitionum ecclesiasticarum seu consistorialium; weitere Ausg. bis 1721). – Volumen disputationum historico-politico-iuridicarum, 1651 (weitere Ausg. bis 1710). – Processus iuris in foro saxonico, 1657 (weitere Ausg. bis 1708).
Literatur: E. Boehm: Der Schöppenstuhl zu Leipzig und der sächsische Inquisitionsprozeß im Barockzeitalter. ZStrW 59ff., (1940ff.) insbes. 61(1942) 300–403. – J. Fr. Heine: Zur Methode in Benedikt Carpzovs zivilrechtlichen Werken, Diss. jur. Frb., 1964, Teilabdr. ZRG (RA) 82 (1965) 227ff. – R. Hoke: Die Souveränitätslehre des Benedict Carpzov, in: Staat und Recht 1997, 319–336. – G. Jerouschek u.a. (Hrsg.): Benedict Carpzov: neue Perspektiven zu einem umstrittenen sächsischen Juristen, 2000. – P. Jessen: Benedikt Carpzov. Ein sächs. Jurist und Leipziger Schöffe, in: Leipzig. Stadt der Rechtsprechung, 1994, 30–52. – S. v. Köckritz: Die Bedeutung des Willens für den Verbrechensbegriff Carpzovs, Diss. jur. Bonn, 1955. – K. Kuhne: Der Einfluß des Leipziger Schöppen Benedict Carpzov auf die Prozesse gegen die Hexen um Delitzsch, 1967. – A.R. v. d. Linden: Die Strafrechtsanalogie in Carpzovs Practica criminalis. 1947. – M. Lipp: Recht u. Rechtswiss. im frühen neuzeitl. Kursachsen. Zur 400-jähr. Wiederkehr des Geb. v. Benedikt Carpzov, in: JuS 1995, 387–393. – H. Lück: Benedict Carpzov, in: G. Wiemers (Hrsg.): Sächsische Lebensbilder, 2015, 105–118. – D. Oehler: Benedict Carpzovs Practica Nova (1635) in heutiger Betrachtung, in: FS für H.J. Hirsch, 1999, 105–113. – R. Polley: Die Lehre vom gerechten Strafmaß bei Karl Ferdinand Hommel (AD 1722–1781) und Benedikt Carpzov (AD 1595–1666), Diss. jur. Kiel, 1972. – H. Rüping: Benedict Carpzov und Christian Thomasius, in: ZStrW 109 (1997), 381–389. – T. Schaetze: Benedict Carpzov als Dogmatiker des Privatrechts, 1999. – F. Schaffstein: Raub und Erpressung in der deutschen gemeinrechtlichen Strafrechtsdoktrin, insbesondere bei Carpzov, in: FS f. K. Michaelis, 1972, 281–293. – F. Schaffstein: Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts, 1930 (Ndr. 1973). – H. Schieckel: Benedict I. Carpzov (1565–1624) und die Juristen unter seinen Nachkommen, in: ZRG (GA) 83 (1966), 310–322. – W. Schild (Hrsg.): Benedikt Carpzov: 1595–1666. Werk und Wirken, 1997. – Ders.: Der große Leipziger Ordinarius Benedict Carpzov, in: Festschrift der Juristenfakultät zum 600jährigen Bestehen der Universität Leipzig, 2009, 3–26. – Schmidt: Einführung, bes. 153–157. – P. Schneider: Die Rechtsquellen in Carpzovs Practica, 1940. – W. Sellert/H. Rüping: Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, I, 1989, 242–340. – Stintzing-Landsberg: GDtRW I, 723; II, 55–100. – H. Thieme: Benedict |97|Carpzov zum Gcdächtnis, Bad. Ztg. v. 30.8.1966. – H. v. Weber: Benedict Carpzov. Ein Bild der deutschen Rechtspflege im Barockzeitalter, FS Rosenfeld, 1950, 29–50. – H. v. Weber: Benedict Carpzov, in: JuristenJb. 7 (1966/67), 1–14. – Th. Würtenberger: Benedikt Carpzov (1595–1666). Zu seinem 300. Todestag, in: JuS 1966, 345–347. – ADB 4 (1876), 11–20 (T. Muther). – HRG2 I (2008), 819–821 (G. Jerouschek). – Jur., 119f. (J. Otto). – Jur.Univ II, 381–383 (F.J. Casinos Mora). – NDB 3 (1957), 156–157 (E. Döhring). Weitere Angaben bei H. v. Weber in: Jur.-Jb. a.a.O. 13f.
K.