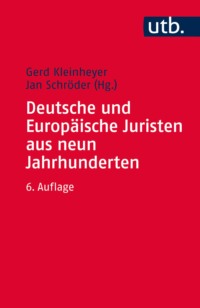Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 13
[Zum Inhalt]
Bogislaus Philipp von ChemnitzChemnitz, Bogislaus Philipp v. (1605–1678)
(1605–1678)
Geb. 9.5.1605 in Stettin, Lutheraner. Vater: Professor der Rechte in Rostock, Kanzler bei Herzögen v. Pommern u. Holstein-Gottorp. Großvater: Berühmter prot. Theologe, Martin Ch. Studium Jura und Geschichte in Rostock und Jena (bei → Dom. ArumaeusArumaeus, Dominicus (1579–1637)); 1627 Eintritt in niederländische Kriegsdienste; 1629 Teilnahme an der Belagerung von s’Hertogenbosch; 1630 Überwechseln zum schwedischen Heer nach dessen Landung in Deutschland; 1637 Ausscheiden aus dem aktiven Dienst als Capitän, weiter in der Militär-Verwaltung; 1644 Bestallung als deutscher Historiograph der königlich schwedischen Majestät; 1648 Erhebung in den schwed. Adelsstand; 1675 Ernennung zum schwedischen Hofrat; 17.5.1678 gestorben auf seinem Gut Halstaed in der Provinz Westmanland.
Ch.s Hauptwerk auf dem Gebiet des Staatsrechts ist die „Dissertatio de Ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico.“, die er unter dem Pseudonym Hippolithus a Lapide 1640 (so die Jahresangabe des Erstdruckes) veröffentlichte. Die Verfasserfrage ist endgültig geklärt, Zweifel an der Richtigkeit der Jahreszahl in der Erstausgabe (v. Stintzing) als zu wenig begründet zurückgewiesen worden.
Die Dissertatio muß im Zusammenhang mit der umfangreichen Flugschriftenliteratur des Dreißigjährigen Krieges gesehen werden. Sie überragt jedoch die anderen Schriften bei weitem an Ausmaß und Gehalt. Schon die Abfassung in Latein erhebt einen Anspruch auf Überdurchschnittlichkeit. Antihabsburgisch von Geburt (Protestant) und Studium her (Jena galt als ein Zentrum des pro-fürstlichen Geistes), verfaßte Ch. dieses Pamphlet, wenn auch noch nicht in schwedischem Auftrag, sondern aus selbständiger Beschäftigung mit der Materie, so doch ganz im Sinne der schwedischen Partei.
|98|Im ersten Teil legt er seine Verfassungsdoktrin dar: Das Reich, verstanden als die Gesamtheit der Reichsstände, ist eine Aristokratie. Souverän in diesem Staat ist der Reichstag, dessen Leiter und bloßes Ausführungsorgan der Kaiser. Monarchische Elemente sind nur in der „administratio accidentalis“, der vom Kaiser im Auftrag der Reichsstände (bei denen die originäre „administratio essentialis“ liegt) ausgeübten Reichsverwaltung, vorhanden. Zeremonielle Tradition und „tönende Titel“ sagen nichts mehr über das Wesen der Verfassung aus. Der Reichstag wird als unvergleichbar mit Versammlungsgremien anderer Staaten besonders hervorgehoben. Jeden Vergleich mit dem römischen Staat weist Ch. unter Hinweis auf die deutsche Geschichte zurück.
Neben diese Doktrin hält Ch. im 2. Teil die Verfassungswirklichkeit und kommt zu einer flammenden Anklage gegen das Haus Habsburg, die „familia Germaniae nostrae fatalis“, schwächer auch gegen die Kurfürsten, die unberechtigt Privilegien an sich gerissen haben, und schließlich gegen alle Territorialherren, die sich im Wunsch nach Beendigung des Krieges seit 1635 (Prager Friede) wieder stärker dem Kaiser zugewendet hatten.
In seinem Begriff der Staatsräson folgt Ch. Arnold Clapmar, der gezeigt hatte, daß jede Staatsform ihre eigene Staatsräson habe. So konnte er jetzt genau sagen, was diese aristokratische Staatsräson denn nun zu tun gebiete. Ch. benutzte also die – nur durch ius divinum, religio, pietas, fides, iustitia und naturalis honestas eingeschränkte – Staatsräson zu einem antiabsolutistischen Zweck; er wurde damit ungewollt zum Vorkämpfer des fürstlichen (territorialen) Absolutismus. Aus den Maximen dieser Staatsräson leitet er im 3. Teil die Mittel ab, mit deren Hilfe die Aristokratie im Reich verwirklicht werden soll:
Amtskaisertum mit nur „simulacra maiestatis“ (nicht „iura maiestatis“). – Um die durchaus mögliche Abspaltung Österreichs vom deutschen Reich nach der geforderten Neuwahl eines Kaisers aus anderem Hause zu verhindern, empfiehlt er die „exstirpatio Domus Austriacae“, die Ausschaltung der Habsburger als Kaiserfamilie und als Reichsstand. Die Erblande sollten dann als Reichsdomäne eingezogen werden. → PufendorfPufendorf, Samuel (1632–1694) vermerkte in seinem „Monzambano“ zu dieser Forderung, Ch. spiele hier mehr den Henker als den Arzt.
Einigkeit der Reichsstände – durch Beendigung der religiösen Streitigkeiten und eine vom Reichstag zu erlassende Amnestie.
Alles staatliche Handeln soll nur mit Zustimmung der Stände geschehen. – Dazu fordert Ch. die Wiederbelebung des Reichstags, der zwischen 1613 und 1640 nicht zusammengetreten war, und zu dessen |99|Entlastung die Wiederherstellung des (1530 aufgelösten) Reichsregiments als zentralen Regierungsorgans. – Schließlich soll ein stehendes Reichsheer eingerichtet werden.
Das Widerstandsrecht begründet Ch. aus dem Homagium, das dem Reich und dem Kaiser als bloßem Amtsträger geleistet wird. Bei Gesetzesuntreue verliert der Kaiser automatisch sein Amt, d.h. er muß auf Grund des Reichseides als Reichsfeind auch mit Waffen bekämpft werden.
Die teilweise sehr einseitige Quellenausschöpfung (die Goldene Bulle wird beispielsweise nur anerkannt, soweit sie den Fürsten Rechte gewährt, während sie etwa in bezug auf die alleinige Bündniskompetenz des Reichs als unverbindlich zurückgewiesen wird) war bei den damaligen Publizisten keine Seltenheit. Man wird sie Ch. nicht vorwerfen dürfen.
Bezeichnend für die Dissertatio ist die Radikalität, mit der Ch. seine Forderung vortrug. Hierin übertraf er seine Zeitgenossen. Sein Ziel war es, die Stände und das Reich in die von ihm als Recht erkannte Verfassung zu bringen und dem Kaiser „die Larve der Majestät abzureißen“. Eine rein zerstörerische Absicht, das Reich für den Zugriff Schwedens zu schwächen, ist ihm jedoch nicht nachzuweisen, da er durchaus Vorschläge für eine starke Zentralgewalt machte, die allerdings nach seinen Vorstellungen ständisch sein sollte.
Eine direkte Wirkung auf seine Zeit, etwa auf die Propositionen Schwedens und Frankreichs im Westfälischen Friedenskongreß, ist nicht zu erkennen, obwohl eine Reihe seiner Forderungen 1648 realisiert wurde. Bis ins 19. Jh. hinein griff man auf den Hippolith zurück, wenn es darum ging, die öffentliche Meinung gegen Österreich zu erregen.
Bedeutender noch als die „Dissertatio“ ist Ch.s „Königlich schwedischer in Teutschland geführter Krieg“, eine sehr genaue Aktenkompilation der schwedischen Kriegshandlungen von 1630 bis 1646. Die vier Teile erschienen 1648 (1. Teil), 1653 (2. Teil); 1855 (1. Buch des 3. Teiles und 4. Teil nach einem aufgefundenen Manuskript). Der Wert des Werkes besteht darin, daß ein großer Teil der wiedergegebenen Akten im Original bei einem Brand verlorengegangen ist. L. v. Ranke gibt Ch. durchaus den Vorrang vor → PufendorfPufendorf, Samuel (1632–1694); der in seinem Geschichtswerk auf den „Königlich schwedischen Krieg“ aufgebaut, aber in späterer Zeit aus anderer Perspektive manche Hintergründe falsch dargestellt hat.
Hauptwerke: (Hippolithus a Lapide): Dissertatio de Ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico, o.O. 1640, Freystadii 1647. – Königlich schwedischer in Teutschland geführter Krieg, 1648 (1. Tl), 1653 (2. Tl.), 1855 (1. Buch d. 3. Tls. und 4. Tl.).
|100|Literatur: H. Breßlau: Einleitung zur Übersetzung von Pufendorfs „De statu imperii Germani liber“, in: Klassiker der Politik, Bd. 3, 1922, 19–25. – W. Burgdorf: Reichskonstitution und Nation, 1998, 56–62. – F. Dickmann: Der Westfälische Frieden, 21965, 137–142. – R. Hoke: Hippolithus a Lapide, in: Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. v. M. Stolleis, 21987, 118–128. – R. Hoke: Staatsräson und Reichsverfassung bei Hippolithus a Lapide, in: Staatsräson, hrsg. v. R. Schnur, 1975, 407–425. – J.J. Moser: Bibliotheca iuris publici, Bd. 3, 1734, 898–923. – L. v. Ranke: Über Chemnitz und Pufendorf in: Zwölf Bücher Preußischer Geschichte, Bd. 3, Analekten 4, 1874 (Ausg. München 1930, 401–411). – F.H. Schubert: Die deutschen Reichstage in der Staatslehre der frühen Neuzeit, 1966, 554–578. – Stintzing-Landsberg: GDtRW II, 45–54. – T. Vielhaber: Bogislaus von Chemnitzs „Dissertatio de ratione status in imperio nostro Romano-Germanico“ (1640): Reformprojekt oder Hetzschrift gegen die Habsburger Kaiser?, in: Neulateinisches Jahrbuch 12 (2010), 343–362. – E. Weber: Hippolithus a Lapide, in: HZ 29 (1873), 254–306. – F.X. v. Wegele: Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus, 1885 (Ndr. 1965), 358–361. – E. Wolf: Idee und Wirklichkeit des Reiches im deutschen Rechtsleben des 16. und 17. Jh., in: Reich und Recht in der deutschen Philosophie, hrsg. v. K. Larenz, Bd. 1, 1943, 117–120. – ADB 4 (1876), 114–116 (E. Weber). – HRG2 I (2008), 833 (C. Hattenhauer). – Jur.Univ II, 385–387 (F.J. Andrés). – NDB 3 (1957), 198–200 (F.H. Schubert).
P.
[Zum Inhalt]
Samuel von CoccejCocceji, Samuel v. (1679–1755)i
(1679–1755)

Den Beginn der Justizreformen des Aufklärungszeitalters bezeichnet in Preußen das Wirken Samuel von Coccejis, des im Oktober 1679 in Heidelberg geborenen dritten Sohnes des Professors des Natur- und Völker-, Lehns- und Pandektenrechts Heinrich v. C. (Mutter: Marie Salome Howard, Tochter des württbg. Kanzlers H.). Nach Studium in Frankfurt/Oder dort 1699 unter dem Präsidium seines Vaters Doktor-Disputation über ein naturrechtliches Thema (De principio juris naturalis unico vero et adaequato). Die anschließende Bildungsreise |101|führt ihn drei Jahre lang durch Italien, Frankreich, England und die Niederlande. 1702 Professor iuris ordinarius in Frankfurt und 1703 Doktorpromotion. 1704 bricht C. die akademische Laufbahn ab und tritt in den preußischen Justiz- und Verwaltungsdienst ein, zunächst als Rat, seit 1710 als Regierungsdirektor in Halberstadt, 1711–13 für Preußen Teilnahme an der Visitation des Reichskammergerichts. Sein in dieser Zeit entstehendes „Jus civile controversum“ (Teil I 1713, Teil II 1718) empfiehlt ihn für die mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. in Preußen einsetzenden Justizreformen. 1714 zum Geh. Justiz- und Ob.-Appellations-Gerichts-Rat ernannt, wurde er 1718 nach Königsberg entsandt, um im Königreich Preußen für die Aufarbeitung der verschleppten Prozesse zu sorgen und ein beschleunigtes Verfahren einzuführen, in dem alle Prozesse innerhalb eines Jahres durch die Instanzen gebracht werden könnten. Der Verkürzung der Prozesse, die man damals als erste Voraussetzung für die Hebung der finanziellen Leistungskraft der Bevölkerung ansah, sollte auch die Revision des Preußischen Landrechts dienen, die C. bereits 1721 zum Abschluß brachte (Verbessertes Landrecht des Königreichs Preußen). 1722 wird C. Präsident des Kammergerichts, 1727 Etats- und Kriegsminister, 1731 Präsident des Ober-Appellationsgerichts. Als der König 1738 den Plan der Abfassung eines allgemeinen Landrechts wieder aufgreift – die Order vom 18. Juni 1714 an die Hallenser Juristenfakultät, unter → ThomasiusThomasius, Jakob (1622–1684); dt. Philosoph’ Leitung „einige Konstitutionen“ zum märkischen Landrecht auszuarbeiten, war ohne Resultat geblieben –, wird C. als „ministre chef de justice“ erstmals in Brandenburg-Preußen die gesamte Justiz unterstellt. Schon ein Jahr später sieht er sich zwischen allen Stühlen: Richterschaft wie Advokaten fühlen sich durch C.s Reformbestrebungen in ihrer Existenz gefährdet, der König vermutet nun in C. den Verantwortlichen für das zu langsame Fortschreiten der Reform. C., dem Geheimratskollegium unterstellt und der Zuständigkeit für die Reformgesetzgebung enthoben, wendet sich wieder literarischer Tätigkeit zu: Im „Novum systema jurisprudentiae naturalis et Romanae“ (1740) sucht er die weitgehende Übereinstimmung von römischem und Naturrecht zu beweisen; die romanisierende Tendenz der späteren materiellrechtlichen Reformgesetze – und damit ihr schließliches Scheitern angesichts entgegengesetzter Zeitströmungen – ist hier grundgelegt.
Einen Auftrag zur Wiederaufnahme der Reformen erhielt C. erst nach dem Regierungsantritt Friedrichs II. Zunächst allerdings wurde er 1741 nach Schlesien entsandt, um die Reorganisation dieser im ersten Schlesischen Kriege neu erworbenen Provinz durchzuführen. In den |102|Verhandlungen mit dem Breslauer Bischof Sinzendorf, in denen er das Territorialprinzip (→ J.H. BöhmerBöhmer, Justus Henning (1674–1749)) durchzusetzen suchte, zeigte er sich als konsequenter Gegner der katholischen Kirche, was ihm noch im 19. Jahrhundert die Wertschätzung kulturkämpferischer preußischer Juristen eintrug. 1744 wurde C. die Organisation des an Preußen gefallenen Ostfriesland übertragen. Mit dem Jahr 1746 beginnen die eigentlichen Coccejischen Justizreformen. Das Institut der Aktenversendung wurde zunächst auf preußische Rechtsfakultäten beschränkt und dann ganz aufgehoben (20.6.1746), die Rechtsprechung damit den Rechtsfakultäten entzogen und allein den Justizbehörden vorbehalten, so daß nun sämtliche Rechtspflegeorgane unter staatlicher Aufsicht standen und innerhalb dieser Organe ein geordneter Instanzenzug notwendig wurde. Die Ernennung C.s zum „Großkanzler“ 1747 (etwa dem Justizminister entsprechend) war Ausdruck der neuen Justizorganisation. Es folgte die Justizreform in Pommern, die dort zur Erledigung fast aller alten Prozesse bis Anfang 1748 führte. Sodann kamen die Mark Brandenburg und die übrigen Provinzen an die Reihe. Überall zeitigte die von dem schon im 7. Lebensjahrzehnt stehenden C. mit Energie, aber auch Rücksichtslosigkeit durchgeführte Reform der Rechtspflege, wie sie auf Grund des Codex Fridericiani Pomeranici v. 6. Juli 1747, des Codex Fridericiani Marchici v. 3. April 1748 sowie der Tribunals-Ordnung v. 1748 durchgeführt wurde, die Erledigung der alten Prozesse – über 10000 davon wurden in den Jahren bis 1755 zu Ende geführt.
C. hat stets daran festgehalten, daß die Justizreform ohne Kodifikation auch des materiellen Rechts, ohne ein „jus certum“, nicht zu vollenden sei. Mit dem „Projekt des Corporis Juris Fridericiani“ wollte er den Schlußstein setzen. Schon Anfang 1749 konnte er dessen ersten Teil, das Personenrecht, vorlegen, 1751 erschien das Sachenrecht, doch das Obligationenrecht, 1753 fertiggestellt, ging bei einer Versendung des Manuskripts verloren. Das Alter hinderte C. daran, diesen Verlust noch einmal wettzumachen – das Werk blieb unvollendet und trat, da nur als Entwurf zur Begutachtung gedacht, auch in den erhalten gebliebenen Teilen nicht in Kraft. Am 4.10.1755 ist C. gestorben.
Das Wirken C.s bedeutet einen entscheidenden Schritt auf dem Wege zum Ausbau der Justiz als „Dritter Gewalt“ in Preußen. Nicht als ob C. jemals an Unabhängigkeit der Rechtspflege durch Gewaltentrennung im Sinne → MontesquieusMontesquieu, Charles de Secondat, Baron de la Brède et de M. (1689–1755) gedacht hätte; er hat nie das oberstrichterliche Amt des absoluten Herrschers an sich in Frage gestellt. Aber die Tendenz zur Verselbständigung des Juristenstandes war in seinen Reformen angelegt. Das eigentlich Neue an diesen Reformen |103|war, daß sie nicht mehr nach den Vorbildern der vorangegangenen zwei Jahrhunderte bei der Revision und Ergänzung des materiellen Rechts ansetzten, auch nicht einer unzulänglich gebildeten Richterschaft den Gesetzesinhalt stärker zu verdeutlichen suchten, sondern die Qualität der Rechtspflegeorgane zu heben unternahmen. Nur von einer besser ausgebildeten, qualifizierten Richterschaft erwartete C., daß sie die Gesetzesbefehle des Herrschers in eine schleunige und zweifelsfreie Rechtsprechung werde umsetzen können. So geht die Einführung des juristischen Vorbereitungsdienstes und der juristischen Staatsexamina auf C. zurück. Die zuverlässige Bindung des Richters an das Gesetz, in den Reformgesetzen wiederholt eingeschärft, war also das Motiv auch für die Reform der Juristenausbildung. Auch die auskömmliche Besoldung der Justizbedienten, damals keineswegs selbstverständlich und von C. stets als Kernpunkt der Reformen betrachtet, diente diesem Ziel: Der Richter sollte nicht mehr aufs „Sportulieren“, also Gebührenschinden, angewiesen sein und so von sachfremden Erwägungen frei bleiben; zugleich sollte dadurch der Anreiz zur Prozeßverschleppung beseitigt und das Prozessieren auch für den Ärmeren wirtschaftlich tragbar werden.
In welchem Maße die Coccejische Justizreform einem gewandelten Staatsverständnis entsprochen hat, zeigt der Verzicht Friedrichs d. Gr. auf „Machtsprüche“ (1748), also auf Eingriffe in schwebende Gerichtsverfahren oder auf die Abänderung gerichtlicher Entscheidungen. Als der König dieser Selbstbeschränkung untreu wurde und 1779 im Müller-Arnold-Prozeß einen Machtspruch fällte, zeigte die einhellige Ablehnung, auf die dieser Schritt des Königs bei der Richterschaft stieß, die Wirkung der Reformen C.s: Eine neue Schicht von Richterbeamten mit Korpsgeist war entstanden, dem Recht und dem Staat – notfalls auch gegenüber der Person des Herrschers – verpflichtet. Aus ihr stammten auch die aufgeklärten Reformer (→ SvarezSvarez, Carl Gottlieb (1746–1798)), die 1794 mit dem ALR das Werk C.s zu seinem eigentlichen Abschluß bringen sollten.
Hauptwerke: Jus controversum civile, 2 Tle., 1713–18; spätere Auflagen, 1727–29, 1740, 1779, u.d.T.: Jus civile controversum. – Novum systema jurisprudentiae naturalis et Romanae, 1740. – Grotius illustratus, 4 Bde., 1744–1752. – Project des Codicis Fridericiani Pomeranici, 1747. – Project des Codicis Fridericiani Marchici, 1748. – Project einer Tribunals-Ordnung, 1748. – Project des Corporis Juris Fridericiani, 2 Tle., 1749/51.
Literatur: K. Darkow: Samuel Freiherr von Cocceji. Zum 300. Geburtstag des Kammergerichtspräsidenten und preußischen Großkanzlers am 20.10.1979, in: DRiZ 1980, |104|65–69. – H. Klemm: Samuel von Cocceji, in: 200 Jahre Dienst am Recht, hrsg. v. Fr. Gürtner, 1938, 305–330. – H. Mohnhaupt: Zur Kodifikation des Prozeßrechts in Brandenburg-Preußen: Samuel von Coccejis „Project des Codicis Fridericiani Marchici“ von 1748, in: Menschen und Strukturen in der Geschichte Alteuropas (FS f. J. Kunisch), 2000, 279–297. – H. Neufeld: Die friedericianische Justizreform bis zum Jahre 1780, Diss. jur. Göttingen, 1910. – H.P. Schneider: Die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Leibniz und den beiden Cocceji (Heinrich und Samuel), in: Humanismus und Naturrecht in Berlin-Brandenburg-Preußen, hrsg. v. H. Thieme, 1979, 90–102. – W. Sellert: Samuel von Cocceji, ein Rechtserneuerer Preußens, in: JuS 1979, 770–773. – M. Springer: Die Coccejische Justizreform 1914. – Stintzing-Landsberg: GDtRW III, I (Text) 215–221, (Noten) 138–141. – A. Stölzel: Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung dargestellt im Wirken seiner Landesfürsten und obersten Justizbeamten, Bd. 2, 1888, 50–235. – F.A. Trendelenburg: Friedrich der Große und sein Großkanzler Samuel von Cocceji, 1864. – M. Weigert: Der Nummerntöter, in: Bayer. Verwaltungsbl. 2001, 519–523. – H. Weill: Judicial reform in 18th-century Prussia. S. v. Cocceji and the unification of the courts, in: The American journal of legal history 4 (1960), 226–240. – H. Weill: Frederick the Great and Samuel von Cocceji. A Study in the Reform of the Prussian Judicial Administration 1740–1755, 1961. – ADB 4 (1876), 373–376 (R. v. Stintzing). – HRG2 I (2008), 859f. (I. Ebert). – Jur., 137f. (I.K. Ahl). – Jur.Univ II, 520–522 (X. Basozábal). – NDB 3 (1957), 301f. (E. Döhring).
K.
[Zum Inhalt]
Hermann ConringConring, Hermann (1606–1681)
(1606–1681)

Geb. 9.11.1606 in Norden, Ostfriesland; Vater: prot. Prediger (Lutheraner), in C.s Familie eine Reihe von Juristen, ein Nachkomme C.s war → Rudolf von JheringJhering, Rudolf von (1818–1892); 1613–1620 nach überstandener Pest-Erkrankung Besuch der Lateinschule in Norden; 1620 erregt C. die Aufmerksamkeit eines Helmstedter Professors, der ihn an die dortige Universität holt; 1625 Fortsetzung des inzwischen aufgenommenen Medizinstudiums in Leiden, hier lernt C. → Hugo GrotiusGrotius, Hugo (Huig de Groot) (1583–1645) kennen; 1631 als Erzieher im Hause des braunschweigisch-wolfenbüttelschen Kanzlers; 1632 Lehrstuhl für Naturphilosophie |105|in Helmstedt; 1636 Promotion zum Dr. phil. und Dr. med., Verheiratung; kurz darauf auch Professor der Medizin; 1650 Professor für Politik, nachdem er schon vorher, angeregt durch → LampadiusLampadius, Jacob (1593–1649), staatsrechtliche, historische und politische Studien betrieben hatte; gestorben am 12.12.1681 in Helmstedt.
C. wurde nach einer durch Krankheit und Wissensdrang verkürzten Jugend ein vielseitig gebildeter Gelehrter; er verdient es, daß man ihn als Polyhistor bezeichnet. Auf dem Gebiet der Medizin war er eine geachtete Größe. Er vertrat die damals aufkommende Lehre Harveys vom Blutkreislauf. Verschiedene Titel als Leibarzt deutscher und ausländischer Fürsten (u.a. der Königin v. Schweden) werden allerdings nicht nur aus seinem medizinischen Ruhm zu erklären sein, sondern hier haben sicher auch politische Interessen eine Rolle gespielt. Als Protestant war er ein Gegner des habsburgischen Kaisertums. Während seines Studiums in Leiden schloß er sich den Arminianern an, einer von den Calvinisten abgespaltenen reformierten Gruppe. Es war ihm ein leichtes, die Herrschersouveränität, so wie sie sich im 17. Jh. immer mehr ausbildete, als ideale Herrschaftsform zu preisen. Dagegen bekämpfte er die Volkssouveränitätslehre des → AlthusiusAlthusius, Johannes (1557–1638) als eine den Staat gefährdende Aufruhrdoktrin. Herrschersouveränität bedeutete für ihn aber nicht Zentralgewalt des Kaisers, sondern Absolutismus der Territorialherren. Daher sieht er das Reich auch nicht als Monarchie an, sondern folgt der Lehre vom „status mixtus“ (→ BesoldBesold, Christoph (1577–1638)).
In seinen politischen Schriften wird die Staatsräson als oberste Richtschnur für den starken Fürsten dargestellt. Er betont jedoch in Auseinandersetzung mit Machiavelli, daß die Staatsräson keine bindungslose Machtpolitik rechtfertigt, sondern dem Glück der Staatsbürger dienen soll und durch sittliche und rechtliche Werte begrenzt ist (vgl. auch → ChemnitzChemnitz, Martin (1522–1586); ev. Theologe). Als Hilfsmittel der Politik entwickelt C. auch eine neue Wissenschaftsdisziplin: die empirische (nicht wie bisher theologisch-philosophische) „Staatenkunde“, die als Anfang der wissenschaftlichen Statistik betrachtet werden kann.
C.s besonderes Verdienst für die Rechtswissenschaft liegt darin, daß er als erster in seiner Zeit die Wurzeln des älteren – vor der Rezeption geltenden – deutschen Rechts freigelegt und umfassend dargestellt hat. Im Zusammenhang damit konnte er die damals vorherrschende Auffassung von der Übernahme des römischen Rechts, wonach Kaiser Lothar (III.) von Supplinburg das Justinianische Gesetzeswerk als Ganzes für das Reich verbindlich gemacht haben soll, in das Reich der Fabel verweisen. Das römische Recht sei nicht schon im 12. Jahrhundert und |106|nicht in complexu, sondern erst seit dem 15. Jahrhundert – durch den zunehmenden Einfluß der gelehrten Juristen – gewohnheitsrechtlich in unterschiedlichem Umfang rezipiert und das deutsche (partikulare) Recht dadurch keineswegs völlig verdrängt worden. Daß diese Lehre gut mit C.s kaiserfeindlicher Grundhaltung zusammenpaßte, ändert nichts an ihrer überzeugenden historischen Fundierung, durch die sie sich schnell allgemein durchgesetzt hat. C.s „De origine iuris Germanici“, von 1643 bis 1730 sechsmal aufgelegt, war Anfang und erster Höhepunkt der wissenschaftlichen Beschäftigung mit deutscher Rechtsgeschichte. Noch heute wird immer wieder darauf hingewiesen, mit welch gutem Gespür C. zu Ergebnissen gekommen ist, die von späteren Forschungen weitgehend bestätigt wurden. Von C., dem Historiker und Mediziner ohne juristische Ausbildung, ging die deutsche Rechtsgeschichte als wissenschaftliche Disziplin aus.
Über seinen Charakter ist viel gestritten worden: Besonders Erik Wolf sieht in ihm einen unruhigen, vom Drang zu bloßer Wissensanhäufung getriebenen Geist. Es wird auch oft hervorgehoben, daß C. seine Meinungen von den jeweils dafür versprochenen Vorteilen abhängig machte. Man muß jedoch bedenken, daß das 17. Jahrhundert andere Maßstäbe für die Beurteilung politischer Gesinnungstreue hatte als die Gegenwart. Andererseits wird man allerdings auch kein besonderes Nationalgefühl in C. hineinsehen dürfen. Er war Pragmatiker und spürte nicht etwa einem germanischen Kulturideal nach, wenn er sich um die deutsche Rechtsvergangenheit bemühte. Seine Abneigung gegen das Haus Habsburg und seine Eingenommenheit für den souveränen Fürstenstaat reichen als Motive für die Beschäftigung mit den germanischen Stammesrechten aus.
Seine nicht mehr bloß feststellende, sondern bereits kritische Methode brachte ihn zur Ablehnung des römischen Rechts als der „ratio scripta“, für die es die Humanisten gehalten hatten. Dadurch wurden aber wiederum die Naturrechtler des 17. Jhs. angeregt zu fragen, welches denn nun das vernünftige Recht sei.
Hauptwerke: De origine iuris Germanici, 1643, 31665, 61730 (auch in: Opera, VI, 77). Dt. Übers.: Der Ursprung des deutschen Rechts, hrsg. v. M. Stolleis, 1994. – De Germanorum Imperio Romano, 1643 (Opera, I,26). – De finibus Imperii Germanici, 1654 (Opera, I, 114). – De civili prudentia, 1662 (Opera III, 280). – De nomothetica, 1663. Dt. Übers.: Über die Gesetzgebung, in: H. Mohnhaupt (Hrsg.): Prudentia legislatoria, 2003, 7–94. – Exercitatio historico-politica de notitia singularis alicuius reipublicae, in: Opera, IV, 1. – Examen rerumpublicarum potiorum totius orbis, in: Opera, IV, 47. – Opera, 7 Bde., hrsg. v. I.W. Goebel, 1730, Ndr. 1970–73. |107|Bibliographie v. W.A. Kelly u. M. Stolleis, in M. Stolleis (Hrsg.): Hermann Conring (1606–1681). Beiträge zu Leben und Werk, 1983, 535–572.
Literatur: A. v. Arnswaldt: De Vicariatus controversia. Beiträge Hermann Conrings in der Diskussion um die Reichsverfassung des 17. Jh.s, 2004. – H. Droste: Hermann Conring und Schweden. Eine vielschichtige Beziehung, in: Ius Commune 26 (1999), 337–362. – C. Fasolt: Past sense. Studies in medieval and early modern European history, Leiden 2014, Part 2. – N. Goldschlag: Beiträge zur politischen und publizistischen Tätigkeit Hermann Conrings, Diss. Göttingen, 1884. – H. Hattenhauer: Hermann Conring und die Deutsche Rechtsgeschichte, in: Schlesw.-Holst.-Anzeigen 1969, 69–76. – J. Helle: Große friesische Rechtsdenker: Hermann Conring, in: Justiz an der Jade, hrsg. v. W. Reinhart u.a., 1985, 489–513. – A. Jori: Hermann Conring (1606–1681): Der Begründer der deutschen Rechtsgeschichte, 2006. – R. Knoll: Conring als Historiker, Diss. Rostock, 1889. – K. Kossert: Hermann Conrings rechtsgeschichtliches Verdienst, Diss. Köln, 1939. – W. Lang: Staat und Souveränität bei Hermann Conring, Diss. jur. München, 1970. – G. Lenz: Hermann Conring und die deutsche Staatslehre des 17. Jhs., in: ZStW 81 (1926), 128–153. – K. Luig: Conring, das deutsche Recht und die Rechtsgeschichte, in M. Stolleis (Hrsg.): Hermann Conring (s.o.), 355–395. – E. v. Moeller: Hermann Conring, der Vorkämpfer des deutschen Rechts, 1606–1681, 1915. – P. Oestmann: Kontinuität oder Zäsur? Zum Geltungsrang des gemeinen Rechts vor und nach Hermann Conring, in: A. Thier (Hrsg.): Kontinuitäten und Zäsuren in der europäischen Rechtsgeschichte, 1999, 191–210. – R. Schito: Zum Machiavelli Hermann Conrings, in: C. Zwierlein u.a. (Hrsg:): Machiavellismus in Deutschland, 2010, 95–107. – C. Schott: Hermann Conrings „Respublica Helvetiorum“, in: T.J. Chiusi u.a. (Hrsg.): Das Recht und seine hist. Grundlagen, 2008, 1051–1069. – Stintzing-Landsberg: GDtRW II, bes. 165–188. – O. Stobbe: Hermann Conring, der Begründer der deutschen Rechtsgeschichte (Breslauer Rektoratsrede), 1870. – M. Stolleis (Hrsg.): Hermann Conring (s.o., zahlreiche Beiträge). – M. Stolleis: Hermann Conring und die Begründung der deutschen Rechtsgeschichte, in: H. Conring: Der Ursprung (s.o.), S. 253–267. – Stolleis: Gesch., I, bes. 207f., 231–233 – D. Willoweit: Hermann Conring, in: Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. v. M. Stolleis, 21987, 129–147. – Wolf: Rechtsdenker, 220–252. – R. Zehrfeld: Hermann Conrings (1606–1681) Staatenkunde, 1926. – ADB 4 (1876), 446–451 (H. Breßlau). – HRG2 I (2008), 882–884 (M. Stolleis). – Jur., 141f. (M. Stolleis). – Jur.Univ II, 387–390 (R. Domingo). – NDB 3 (1957), 342f. (E. Döhring). – Nds.Jur., 31–35 (B. Pahlmann/P. Oestmann). Bibliographie bei Wolf: Rechtsdenker, 250–252 und M. Stolleis (Hrsg.): Hermann Conring (s.o.), 573–575.
P.