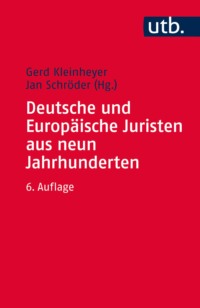Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 14
[Zum Inhalt]
|108|Jacques CujasCujas, Jacques (Cuiacius, Jacobus) (1520–1590)
(1520–1590)

C., lat. Cuiacius, ursprünglich Cujaus, ist 1520 (so sein Testament) oder 1522 in Toulouse als Sohn armer Eltern geboren. Er studierte zunächst an der Universität in Toulouse bei Arnaud du Ferrier, der die Traditionen des → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357) zugunsten des neuen Weges von → AlciatAlciatus, Andreas (1492–1550) aufgegeben hatte und C. stark beeinflußte. 1553/54 bewarb sich C. erfolglos um einen Lehrstuhl in Toulouse und ging an die Universität von Cahors. Nach Toulouse ist er niemals wieder zurückgekehrt; auf spätere Angebote antwortete er: „Frustra absentem requiritis, quem praesentem neglexistis. Valete“. In der folgenden Zeit war er Professor an den Universitäten Bourges (1555), Valence (1557), dann wieder Bourges, Grenoble, Turin (1566) und schließlich erneut Bourges (1575). Zeitweise unterrichtete C. auch in Paris; eine Berufung durch Papst Gregor XIII. nach Bologna lehnte er ab. Die zahlreichen Berufungen beruhten auf C.s ständig wachsendem Ruhm als Gelehrter, während seine Vortragsart selbst nach dem Urteil seiner ergebensten Schüler zu wünschen übrig ließ. In Glaubensdingen bewahrte der Katholik C. vorsichtige Zurückhaltung. Er scheint zwar zeitweise Sympathien für den Calvinismus gehabt zu haben, wohnte aber, als der Katholizismus in Frankreich die Oberhand behielt, calvinistischen Predigten nicht mehr bei. Auf religiöse Fragen pflegte er zu antworten: „Nihil hoc ad edictum Praetoris“.
C. war zweimal verheiratet, in der 1557 geschlossenen ersten Ehe mit Madelaine Raure, einer Arzttochter aus Avignon, in zweiter Ehe seit 1586 mit Gabrielle Hervé; aus der ersten Ehe ging ein Sohn (Jaques), aus der zweiten eine Tochter (Susanne) hervor. C. starb am 25.9., 3.10. oder 4.10.1590 in Bourges.
C. war unbestritten das Oberhaupt der von → AlciatAlciatus, Andreas (1492–1550) begründeten französischen historischen Schule, die sich von der praxisorientierten Methode der italienischen Kommentatoren (mos italicus, → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357), → BaldusBaldus de Ubaldis (1319/27–1400)) abwandte und die römischen Rechtsquellen philologisch-|109|historisch bearbeitete (mos gallicus). Er gilt als der größte Exeget seiner Zeit, vielleicht sogar aller Zeiten, eine „Arbeitsmaschine“ (Jhering) von fast unglaublicher Schaffenskraft. Fast alle großen französischen Juristen der folgenden Generation gehörten zu seinen Schülern. Sein Ziel war es, die Veränderungen aufzudecken, welche die justinianischen Kompilatoren an den Schriften der klassischen römischen Juristen vorgenommen hatten, und so das reine Recht der klassischen Zeit wieder zugänglich zu machen. C. wurde damit zum eigentlichen Begründer der Interpolationenforschung, die erst im 19. und frühen 20. Jahrhundert ihre Blütezeit erlebte. Allerdings verfolgte C. nicht die rein historische Richtung moderner Interpolationenforschung. Die Aufdeckung der Veränderungen durch die Kompilatoren sollte nicht zu einer klassischen statt der justinianischen Lesart führen, sondern nur zum besseren Verständnis des Kontextes einer lex, eines Titels, einer dogmatischen Einheit im Sinne der Kompilatoren beitragen.
Die Methoden seiner Vorgänger wurden von C. perfektioniert. Er versuchte, die Rechtstexte „historisch“ zu verstehen, das zu untersuchende Fragment der justinianischen Kodifikation wieder in das Werk des klassischen Rechtsgelehrten einzufügen, aus dem es entnommen worden war, und es im Lichte von Texten desselben Autors oder derselben Schule zu interpretieren. Dabei stützte er sich auf sein tiefgreifendes Wissen über die Geschichte und die römische Literatur. In seinen „Observationes et emendationes“ erläutert und rekonstruiert er zahlreiche Passagen lateinischer Autoren und Gesetze. In seinen Kommentaren über die Digestenfragmente aus den wichtigsten Werken der großen Juristen vergleicht er Buch für Buch die Bruchstücke, um sie so weit wie möglich in ihre frühere Form zu bringen. So rekonstruierte er Teile von Papinian, Paulus, Julian und Modestin. C. bevorzugte nicht irgendeine bestimmte Methode der Textkritik. Die letzte Entscheidung sollte jeweils dem Urteil des Gelehrten überlassen bleiben; C. gilt als ein Meister der „offenen Rezension“, die „von Fall zu Fall nach problemimmanenten Kriterien neu entscheidet“ (Troje). C. hielt deshalb auch keine Digestenhandschrift primär für unterlegen und die beste Handschrift, die „Florentina“ (→ MommsenMommsen, Theodor (1817–1903)), durchaus nicht immer für vorzugswürdig.
Obwohl C. keineswegs nur historische Absichten verfolgte, stand er doch der Praxis nicht so nah wie die Kommentatorenschule des mos italicus oder die systematisierende Richtung seiner Zeitgenossen (→ BodinBodin, Jean (1529/30–1596), → DonellusDonellus, Hugo (Doneau, Hugues) (1527–1591)). Er wollte Neues schaffen durch die Wiederentdeckung der Antike, mit der Tradition der Glossen und der |110|Kommenta re brechen, um zum wahren römischen Recht zurück zu gelangen und dessen Geist zu erfassen. Deshalb überrascht es nicht, daß schon C.s Zeitgenossen seine Praxisferne kritisiert haben, während er als Meister der Exegese und der historisch-philologischen Analyse noch heute größtes Ansehen genießt.
Hauptwerke: Observationum et Emendationum libri XXVIII, 1556–1585 (Buch 25–28 posthum hrsg. v. F. Pithou, 1595). – Paratitla ad Digesta, 1570. – Opera, 5 Bde., 1577 und 1583; 4 Bde., 1595. Opera omnia, hrsg. v. C.A. Fabrotus, 10 Bde., 1658 (Ndr. 1996), weitere Ausg. in 11 Bden. 1722ff., 1758ff. Bibliographie bei E. Spangenberg: Jacob Cujas und seine Zeitgenossen, 1822 (Ndr. 1967), 231–307.
Literatur: A. Bazennerye: Cujas et l’école de Bourges, 1876. – J. Berriat-Saint-Prix: Histoire du droit romain suivie de l’histoire de Cujas, 1821. – A. Esmein: Cours élémentaire d’histoire du droit francais, 1912, 844. – P.F. Girard: La jeunesse de Cujas. Notes sur la famille, ses études et ses premier enseignements, in: RHDF 40 (1916) 429–504, 590–627. – P. Ourliac/J.-L. Gazzaniga: Histoire du droit privé français, 1985, 154f. – E. Holthöfer: Die Literatur zum gemeinen und partikularen Recht in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, in Coing: Hdb., II 1, 103ff. (149f., 470). – K. Luig: Augustin Leysers Beobachtungen über die „Cujazische Auslegungsart“, in: FS f. R. Knütel zum 70. Geb., 2009, 703–718. – X. Prévost: Jacques Cujas (1522–1590), jurisconsulte humaniste, 2015. – A. Rodière: Les grands jurisconsultes, 1874, 285ff. – E. Spangenberg: (s.o.). – Stintzing-Landsberg: GDtRW, I, 375–377. – A. Tardif: Histoire des sources du droit français, 1890 (Ndr.1974), 480f. – H.E. Troje: Graeca leguntur, 1971, 109ff. – Ders.: Die Literatur des gemeinen Rechts unter dem Einfluß des Humanismus, in Coing: Hdb., II 1, 615ff. (627, 786f.). – Ders.: Indicium aliud imperfectarum Pandectarum (Cujas Observatio 6, 23), in: Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all’età contemporanea (D. Maffei z. 80. Geb.), 2006, 1321–1331. – Dict.Hist., 291–293 (L.Winkel). – HRG² I (2008), 912f. (M. Avenarius). – ABF Fiche-Nr. 269, 118ff. – Jur., 152f. (J. Otto). – Jur.Univ. II, 221–225 (E. Varela).
K. Stapelfeldt
[Zum Inhalt]
|111|Heinrich Gottfried Wilhelm DanielsDaniels, Heinrich Gottfried Wilhelm (1754–1827)
(1754–1827)

D. ist am 25. Dezember 1754 in Köln als Sohn eines Schneidermeisters geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums studierte er an der Kölner Universität Philosophie (wobei er sich besonders der Mathematik widmete) und daneben Rechtswissenschaft. 1769 Lizentiat, 1770 Doktor der Philosophie und 1775 Doktor beider Rechte.
1776 wurde D. beim kurkölnischen Hofrat (kurfürstliche Landesregierung und zugleich Gericht) in Bonn als Advokat angestellt, 1780 zum Kommissar am weltlichen Hofgericht in Köln ernannt. 1783 wurde er an die Akademie (seit 1786: Universität) in Bonn als ordentlicher Professor der Rechte berufen. Er hielt Vorlesungen über Pandekten und juristische Praxis, Wechsel-, Privatfürsten- und kurkölnisches Recht. „Daniels ist wohl derjenige Professor der ersten Bonner Hochschule gewesen, der das höchste und unbestrittenste Ansehen genossen hat und noch genießt, ein Ansehen, das er wahrhaftig verdient.“ (Braubach). Er war ein hervorragender Kenner des Rechts seiner Heimat, des kurkölnischen Landrechts, dem er bedeutende Untersuchungen und Darstellungen widmete. Bei dem Rufe, in dem D. auch außerhalb der Grenzen Kurkölns stand, und bei dem Ansehen, das er beim Kurfürsten hatte, verwundert es nicht, daß er 1786 zum Wirklichen Hof- und Regierungsrat, 1789 zum Referendar in Hoheitssachen, 1792 zum Wirklichen Geheimrat und zum Richter am kurkölnischen Oberappellationsgericht in Bonn, der landeseigenen, letzten Instanz, ernannt wurde. Neben all diesen einflußreichen Ämtern behielt D. seine Professur bei, was sich sowohl für seine richterliche als auch für seine Lehrtätigkeit als besonders vorteilhaft erwies; denn er konnte für die Theorie die Erfahrungen der Praxis verwerten und die Praxis mit seinen theoretischen Kenntnissen befruchten.
In die Bonner Periode D.s fallen die meisten seiner Veröffentlichungen. Zu den bedeutendsten zählen eine Sammlung gerichtlicher Akten und andere Aufsätze über juristische Schreibart und Praxis (1790), |112|eine Abhandlung über Testamente nach kurkölnischem Landrecht (1791) und eine umfangreiche Arbeit über Testamente, Kodizille und Schenkungen auf den Todesfall, die ebenfalls in dieser Zeit entstand, aber erst 1798 gedruckt werden konnte.
1794 besetzten die französischen Revolutionsheere die Rheinlande. In der Folgezeit verlor D. alle seine Ämter; die Universität wurde am 28. April 1798 aufgehoben. D. übersiedelte nach Köln und wurde an der dort von den Franzosen neu errichteten Zentralschule zum Professor für Gesetzgebung ernannt. Er wirkte hier von 1798 bis 1804; Berufungen nach Ingolstadt und Düsseldorf lehnte er ab, ebenso das Amt eines Appellationsgerichtsrats in Trier und Düsseldorf. D. nützte diese Zurückgezogenheit, in die bedeutenden Gesetzeswerke, die unter Napoleon in Angriff genommen wurden, einzudringen, vor allem in den Code Civil, den er 1805 in deutscher Übersetzung herausbrachte. D. brachte es in der Erklärung und Anwendung des neuen Rechts zu einer Meisterschaft, der selbst die Franzosen die größte Hochachtung erweisen mußten.
1804 wurde D. in das öffentliche Ministerium am Kassationshof in Paris berufen, dem höchsten Gericht Frankreichs, das damals von Holland bis Italien reichte. (Es war ein persönliches Gespräch mit Napoleon anläßlich dessen Anwesenheit in Köln im September 1804 vorausgegangen.) Er war zunächst Substitut du Procureur Général, später Avocat Général. Die Eingaben, die D. dem Gericht vorlegte, galten „als Muster der Klarheit und tiefen Erudition“ (Bianco). „Seine Vorträge wurden als meisterhaft anerkannt und sind eine Zierde des Merlin’schen Repertoriums, des Journal des Audiences de la cour de Cassation von Denevers und des Recueil général des lois et des arrets von Sirey“ (Ullmann). Von 1813 bis 1817 war D. am Appellationshof in Brüssel als dessen Generalprokurator.
1817 folgte er dem Rufe des Staatskanzlers Fürst Hardenberg, in preußische Dienste zu treten: D. kam 1818 als Geheimer Staatsrat nach Berlin. Seinen Gutachten ist es zu verdanken, daß in den linksrheinischen Gebieten Preußens das französische Recht in Kraft blieb. Die Franzosen hatten nämlich in den von ihnen innegehabten Landesteilen das französische Recht eingeführt, das der Bevölkerung fortschrittlicher schien als das im übrigen Preußen geltende Allgemeine Landrecht. Die Frage war nun, welches Recht künftig in den an Preußen gefallenen Landesteilen gelten sollte. Mit dieser Frage beschäftigten sich die Immediat-Justiz-Kommission und das dieser vorgesetzte Ministerium für die Revision der Gesetzgebung (Minister v. Beyme). D., |113|der in die Justizabteilung des Staatsrates berufen worden war, sollte Berater der Kommission sein. Als solchem gelang es ihm, die Kommission und v. Beyme von seinen Gründen für die Beibehaltung des französischen Rechts zu überzeugen, so daß es schließlich zu einem entsprechenden Beschluß des Gesamtministeriums und, am 19. November 1818, zu einer Kabinettsorder des Königs kam. So behielten die Rheinlande u.a. ihren öffentlich-mündlichen Straf- und Zivilprozeß sowie die Schwurgerichte in Strafsachen – Rechtseinrichtungen, die später (wenn auch zum Teil modifiziert) auch in Gesamtpreußen und im Kaiserreich eingeführt wurden. D. wurde der erste Präsident des 1819 neu eingerichteten Rheinischen Appellationsgerichtshofs in Köln. Daneben war D. Mitglied der 1820 eingesetzten Rheinischen Immediat-Justiz-Organisations-Kommission. In dieser Funktion ordnete er das rheinische Gerichtswesen.
D. starb am 28. März 1827 in seiner Vaterstadt Köln, einige Monate, nachdem er, vom König und der Bevölkerung hochgeehrt, sein 50jähriges Dienstjubiläum gefeiert hatte.
Hauptwerke: Sammlung gerichtlicher Acten und anderer Aufsätze, 1790. – Von Testamenten, Codicillen und Schenkungen auf den Todesfall, 1798. – Über das Stapelrecht zu Koelln und Mainz, 1804. – Grundsätze des Wechselrechts, 1827. Zwei Nachschriften von Vorlesungen Daniels’ zum (kur-)kölnischen Recht sind hrsg. von C. Becker 2005 und 2008.
Literatur: M. Bär: Die Behördenverfassung der Rheinprovinz seit 1815, Bonn 1919. – F.J. v. Bianco: Die alte Universität Köln und die späteren Gelehrtenschulen dieser Stadt, 1. Tl., 1855, 674ff. – M. Braubach: Die erste Bonner Hochschule, Maxische Akademie und kurfürstliche Universität 1774/77 bis 1798 (= Academica Bonnensia, Bd. 1), 1966, 143ff. – H. Conrad: Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels (1754–1827), in: 150 Jahre Landgericht Koblenz, 1970, 255–274. – F. Dumont: Vermittler französischen Rechts in Deutschland: Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels, in: M. Espagne (Hrsg.): Frankreichfreunde. 1996, 189–220. – J. Hansen (Hrsg.): Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Französischen Revolution 1780–1801, 4 Bde., 1931–1938, bes. Bd. 3, 1021. – N. Reisinger-Selk: Heinrich Gottfried Wilhelm Daniels (1754–1827). Leben und Werk – ein Jurist in drei Zeitaltern, 2008. – Stintzing-Landsberg: GDtRW III, 2, Noten, 48–50. – W. Weisweiler: Geschichte des Rheinpreußischen Notariats, Bd. 2, 1925, 177ff. – J. Wolffram u.a. (Hrsg.): Recht und Rechtspflege in den Rheinlanden (FS z. 150jähr. Bestehen des OLG Köln), 1969 (Beiträge von S. Liermann, 57–77, u. H. Wassermeyer, 285–300). – ADB 4 (1876), 735f. (E. Ullmann). – HRG2 I (2008), 923 (H.-P. Haferkamp). – Jur.Univ II. 789–791 (C. Sánchez-Moreno Ellart). – NDB 3 (1975), 508 (H. Dahm).
F.
[Zum Inhalt]
|114|Jean DomatDomat, Jean (1625–1696)
(1625–1696)

Geb. am 30.11.1625, gest. am 14.3.1696. Studium der alten und neuen Sprachen, der Theologie und der Mathematik im Jesuitenkolleg in Paris. Studium der Rechtswissenschaften in Bourges. 1645 Anwalt in seiner Geburtsstadt Clermont in der Auvergne. Ab 1655 Avocat du Roi am Präsidialgericht in Clermont. Amtserfüllung mit großem Erfolg und zum Schutz der vom Landadel unterdrückten Bevölkerung. Initiator der Grands Jours d’Auvergne von 1665, die der Willkürherrschaft ein Ende bereiten. Freundschaft mit Blaise Pascal, mit dem er sich 1654 der antijesuitischen Strömung des Jansenismus anschließt. Ab 1681 Arbeit am Hauptwerk „Les lois civiles“, dem er sich nach Aufgabe seines Amtes und Gewährung einer Pension durch Louis XIV. ab 1683 ausschließlich widmet.
Erst spät hat D. mit seinem Hauptwerk begonnen, den „Lois civiles“, die er seinem Sohn als Anleitung für dessen Jurastudium zugedenkt. Dabei geht er für das römische Recht in Frankreich von folgender Bestandsaufnahme aus: In der Praxis ist nach D.s Erfahrung der Einfluss des römischen Rechts zumindest im Privatrecht trotz einer Vielzahl sich gegenseitig beeinflussender Quellen ungebrochen. Während in den Provinzen des droit écrit im Süden viele Vorschriften noch unmittelbar auf das römische Recht zurückzuführen sind, dient auch in den nördlichen Teilen des Landes, in denen zahlreiche lokale Bräuche (coutumes) stärker als im Süden Bedeutung gewonnen haben, letztlich das römische Recht zur Klärung von Streitigkeiten. Daneben ist es seit jeher Grundlage der Rechtslehre, die den Gewohnheitsrechten kaum Beachtung schenkt. Dies führt D. auf die räumlich-zeitliche Universalität des römischen Rechts zurück, das für ihn wegen seiner Einfachheit als die „raison écrite“ das Idealbild des Rechts darstellt. Gleichwohl muss D. erkennen, dass trotz dieser großen Bedeutung kaum Kenntnisse des römischen Rechts bei seinen Anwendern vorhanden sind, was er zum einen auf die Sprachschwierigkeiten im Umgang mit den lateinischen |115|Texten, zum anderen auf die Unordnung innerhalb des corpus iuris civilis zurückführt. Sein Ziel ist es daher, ein Werk in französischer Sprache zu schaffen, das der Systematisierung und der Generalisierung des römischen Rechts dient. Damit eröffnet er im Geiste des Zeitalters der Vernunft eine neue Richtung in der Rechtslehre.
Im „Traité des lois“, den D. als Einleitung den „Lois civiles“ voranstellte, legt er die Methode dar, nach der er die natürliche Ordnung zu gewinnen gedenkt; der Hauptteil ist dann nur noch die praktische Anwendung der zuvor aufgestellten Prinzipien. Als Grundlage dient das „corpus iuris“ Justinians als das von der Logik geprägte römische Recht. Dieses ist aber auf der Suche nach den Prinzipien der Gesetze durch die christlichen Ideale zu ergänzen, deren Fehlen D. als Grund der Unordnung betrachtet. Er sieht das Gebot der Nächstenliebe als Grundlage der menschlichen Beziehungen im christlichen Glauben an und macht es zu dem ordnenden Prinzip, das auch das Recht beherrschen muss, denn dieses ist ja nur ein Teil des Ganzen. Auf der Grundlage dieser religiösen Gesellschaftstheorie versucht D. also, Philosophie und Recht zu vereinigen.
Bei der Ausarbeitung des „ordre naturel“ wählt D. eine Methode, die sich von den bisher bekannten grundsätzlich unterscheidet. Für ihn kommt es bei der Auslegung einer Gesetzesvorschrift weder, wie für die französische historische Schule (→ CujasCujas, Jacques (Cuiacius, Jacobus) (1520–1590)), auf die Entstehungszeit, noch, wie bei den Glossatoren (→ IrneriusIrnerius (vor 1100–1125), → AccursiusAccursius (um 1185–1263)), auf den Wortsinn an. Er hält sich vielmehr an den natürlichen Sinngehalt und die offensichtliche Logik der Texte, da er die Vernunft als Grundlage der Gerechtigkeit sieht. Sodann nimmt er einen Vergleich mit den christlichen und philosophischen Wertvorstellungen vor und schließt die diesen Grundgedanken widersprechenden Sätze aus. Die Ordnung der so gewonnenen Gesetze bemisst sich schließlich danach, ob ihnen eine unverzichtbare und absolute Gerechtigkeit zugrunde liegt, die einen eigenen unumstößlichen Wert darstellt, oder ob in ihnen lediglich eine von den Menschen selbst gegebene Ordnung zu Tage tritt. Dabei bedient D. sich fast mathematischer Methoden. Er legt eine Zweiteilung des Rechts in die Gebiete Vertragsrecht und Erbrecht zu Grunde und schließt nach seinem strengen Schema von den generellen Regeln als den Axiomen auf die speziellen Rechtssätze und schließlich auf deren Ausnahmen. Auf diese Weise erlangt er eine Ordnung, die universellen Bestand beanspruchen kann, da sie die „raison“ des römischen Rechts mit den ordnenden Prinzipien der christlichen Philosophie verbindet und die elementaren Grundsätze des Rechts offenlegt.
|116|Nach Abschluss dieses umfangreichen Werkes, das er in seiner großen Bescheidenheit nur mit Zögern und nach ständigen Aufforderungen publiziert, begibt sich D. daran, eine ebensolche Ordnung auch im öffentlichen Recht herzustellen. Dieser Versuch, der auch wegen seiner Gebundenheit an die jeweiligen staatlichen Gegebenheiten nicht die Bedeutung des privatrechtlichen Werkes erlangt hat, bleibt jedoch unvollendet. Gleichwohl macht er eine grundlegende Trennung dieser Rechtsgebiete deutlich.
Mit den „Lois civiles“ erzielte D. einen beachtlichen Erfolg und fand in seiner Zeit allgemeine Anerkennung, die sich in hohen Auflagen und einigen Übersetzungen im benachbarten Ausland niederschlug. Prägend wurde das Werk besonders für das gesetzgeberische Wirken des Chancelier → d’AguesseauD’Aguesseau, Henri-François (1668–1751), der die Endphase der Entstehung miterlebt hat. Doch angesichts der sinkenden Bedeutung des christlichen Denkens gerieten D. und seine Lehre bald weitgehend in Vergessenheit. Die Kritik, die „Lois civiles“ seien ein Rückschritt hinter die Arbeiten der französischen historischen Schule, da D. dem römischen Recht eine Systematik unterstelle, die tatsächlich nicht gegeben sei, wird der Originalität des Werkes, das mit seinen klaren Strukturen, der Ergründung des Geistes des Rechts und der Entwicklung von Interpretationsregeln gerade mehr ist als eine bloße Sammlung von Gesetzestexten, aber nicht gerecht. Gleichwohl ist zweifelhaft, wie der Anteil D.s an den späteren großen Kodifikationen und insbesondere am Code civil einzustufen ist. Der Code civil basiert in erster Linie auf den Kodifikationen des 18. Jahrhunderts und den Werken → PothiersPothier, Robert-Joseph (1699–1772), doch ist ein mittelbarer Einfluss D.s nicht zu verkennen, zumal er mit der Systematik der „Lois civiles“ die späteren Kodifikationen inspiriert hat, und auch → PothierPothier, Robert-Joseph (1699–1772) in dieser Nachfolge schreibt. Daher ist der „Traité des lois“ oft als Vorwort des Code civil bezeichnet worden, und das Fortwirken des römischen Rechts im Code civil wird mit Recht ebenso D. zugeschrieben, wie die Formulierung vieler grundlegender Artikel und die Lehren zur Causa, zur Haftung und zur Privatautonomie.
Wie die von ihm sorgsam herausgearbeiteten Prinzipien des Rechts bezeichnet D. bereits das römische Recht wegen seiner Orientierung an der Vernunft als „droit naturel“. Im Gegensatz zu anderen bedeutenden Naturrechtlern des 17. Jh.s wie → GrotiusGrotius, Hugo (Huig de Groot) (1583–1645) gründet D. sein Naturrecht vor allem auf die christliche Offenbarung. So widerspricht seine Auffassung vom Naturrecht auch nicht dem Absolutismus; vielmehr führt sie zu dessen Verteidigung und zu der uneingeschränkten Akzeptanz der Monarchie. Das Naturrecht erlangt seine Gültigkeit auch ohne |117|Pu blizität. Die königlichen Gesetze hingegen können als „volonté de Dieu“ nicht gegen das Naturrecht verstoßen und bestehen somit unabhängig neben diesem. D. beweist sich insoweit als loyaler Untertan im Zeitalter Louis XIV. und als Vertreter der Werte seiner Zeit. Der Primat der Vernunft und die strenge Logik Descartes’ ziehen sich durch das Werk des „Restaurateurs der Vernunft in der Jurisprudenz“.
Hauptwerke: Traité des loix. Les loix civiles dans leur ordre naturel, 3 Bde., 1689/1694. Neuaufl. 1702 (1 Bd.), Ndr. 1777. – Le droit public, 1697 als 4. und 5. Band der „Loix civiles“. – Legum delectus, 1700, als 6. Band der „Loix civiles“. – Les harangues, 1657–1683, ab 1735 in Gesamtausgaben.
Literatur: A.-J. Arnaud: Imperium et Dominium: Domat, Pothier et la codification, in: Droits. Revue française de théorie juridique, 22 (1995), 55–66. – B. Baudelot: Un grand jurisconsulte du XVII. siècle: Jean Domat, Diss. iur. Paris, 1938. – P. Berhardeau: Vies, portraits et parallèlles des jurisconsultes Domat, Furgole et Pothier, 1789. – V. Cousin (Hrsg.): Documents inédits sur Domat, in: Journal des savants, 1843, 5–18 und 76–93. – B. Edelman: Domat et la naissance du sujet de droit, in: Archives de philosophie du droit 39 (1994), 389–419. – J.L. Gazzaniga: Domat et Pothier. Le contrat à la fin de l’Ancien Régime, in: Droits. Revue française de théorie juridique, 12 (1990), 37. – D. Gilles: La pensée juridique de Jean Domat (1625–1696), Diss. iur. Aix-Marseille, 2004. – Ders.: Claude-Joseph Ferrière et Jean Domat. Deux regards sur le droit romain, in: Les représentations du droit romain en Europe aux Temps modernes, Aix-en-Provence, 2007, 71–111. – Ders.: Jean Domat avocat du roi et jurisconsulte auvergnat, in: Les juristes en Auvergne du Moyen Age au XIXe siècle, 2009, 129–177. – Ders.: Les Lois civiles de Jean Domat, prémices des Codifications? Du Code Napoléon au Code civil du Bas Canada, in: Revue juridique Thémis, 2009, 2–49. – J. Ghestin: Jean Domat et le Code civil français, in: Scritti in onore di Rodolfo Sacco: la comparazione giuridica alle soglie del 3e millennio, 1994, Bd. I, 533–557. – S. Goyard-Fabre: César a besoin de dieu ou la loi naturelle selon Jean Domat, in: H. Méchoulan (Hrsg.): L’État classique, 1996, 149–160. – Dies.: La philosophie du droit de Jean Domat ou la convergence de l’ordre naturel et de l’ordre rationnel, in: Justice et Force: Politiques au temps de Pascal, Actes du Colloque de Clermont 1990, 1996, 187–207. – U. Jahn: Die „subtilité du droit romain“ bei Jean Domat und Robert-Joseph Pothier, Diss. iur. Frankfurt a.M., 1971. – H. Loubers: Domat – Philosophe et magistrat, 1873. – B. Matteuci: Jean Domat, un magistrato giansenista, 1959. – A. de Nitto: Processo e procedura in Domat, in: L’educazione giuridica 6, 1, 1995, 81–103. – P. Nourrisson: Un ami de Pascal: Jean Domat, 1939. – E. Papadopoulos: Mémoire et éléments d’une théorie de l’état dans le Droit public de Jean Domat, Mém. de DEA Paris, 2001.– M.F. Renoux-Zagamé: Domat: du jugement de Dieu à l’esprit des lois, in: Le débat 74 (1993), 54. – Dies.: Domat, le salut, le droit, in: Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 1989, 69–111. – Dies.: La figure du juge chez Domat, in Droits. Revue française de théorie juridique, 39 (2004), 35–52. – St. Rials/S. Goyard-Fabre/M.-F. Renoux-Zagamé: Jean Domat: un juriste au Grand Siècle, in: Revue d’histoire des facultés de droit et de la |118|science juridique, 1989, 69–75. – A. Rodière: Les grands jurisconsultes, 1874, 362. – C. Sarzotti: Jean Domat: fondamento e metodo della scienza giuridica, 1995. – Ders.: Domat criminalista, 2001. – A. Taisand: Les vies des plus célèbres jurisconsultes, 1737, 634. – A. Tardif: Histoire des sources du droit français, 1890, 494. – G. Tarello: Sistemazione e ideologica nelle „loix civiles“ di Jean Domat, in: Materiali per una storia della cultura giuridica Bd. II, 1972, 125, m.w.N. – A. Terrasson: Histoire de la jurisprudence romaine, 1750, 483. – F. Todescan: Domat et les sources du droit, in: Archives de Philosophie du Droit, 1980, 55–66. – Ders.: Le radici teologiche del giusnaturalismo laico, Bd. 2, Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat, 1987. – R. Voeltzel: Jean Domat (1625–1696), 1936. – G.J. Wiarda: Pascal en Domat over de grensvragen van het recht, Speculum Langenmeijer, 1973, 517. – P.G. Aigueperse, in: Biographie des personnages d’Auvergne, 1836, in: ABF Blatt 323, 146. – F.X. Feller, in: Biographie universelle, 1851, in: ABF Blatt 323, 149. – J.C.F. Hoefer, in: Nouvelle biographie générale, 1852–66, ABF Blatt 323, 151. – Dict. Hist., 337–338 (M.F. Renoux-Zagamé). – Jur., 180–182 (E. Holthöfer). – Jur.Univ. II, 408–412 (M.A. Pérez Álvarez). – A. Tardieu, in: Grand dictionnaire biographique du Puy-de-Dôme, 1878, ABF Blatt 323, 158.
H. Nitschke