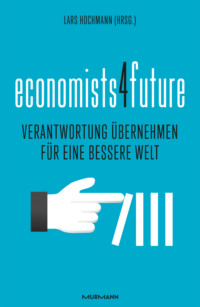Kitabı oku: «Economists4Future», sayfa 4
ZUR GRUNDAUFFASSUNG DER ÖKONOMIE
Die Vermischung von Bewirtschaften und Ökonomie beginnt schon auf der grundsätzlichen Ebene. Ökonomie wird in den gängigen Lehrbüchern definiert als »Wissenschaft vom Einsatz knapper Ressourcen zur Produktion wertvoller Wirtschaftsgüter«, nachzulesen etwa bei Paul Samuelson und William Nordhaus und zurückzuverfolgen sogar bis in die 1930er-Jahre, als Lionel Robbins diese Definition aufgestellt hat. Die Entscheidung darüber, welche Güter wertvoll sind und wie der Einsatz von Ressourcen organisiert ist, treffen nach dieser Diktion »Wirtschaftsakteure«.
Bei dieser Grundannahme – Ökonomie als Wissenschaft von Entscheidungen zwischen Zwecken und knappen Mitteln seitens der Wirtschaftsakteure – werden die Folgen solchen Entscheidens von Anfang an aus der Ökonomie ausgeklammert. Sie werden als »externe Effekte« – als unkompensierte Auswirkungen dieser ökonomischen Entscheidungen – behandelt. Für sie zahlt niemand oder leistet einen Ausgleich, obwohl die Entscheider*innen doch gleichzeitig die Verursacher*innen sind. In den meisten Fällen, in denen die Auswirkungen nicht ausgeblendet werden, werden sie einzig wieder zu Verwertungszwecken in die Ökonomie integriert, nachzuvollziehen etwa an den Emissionsmärkten. Diese, schon im wörtlichen Sinne verantwortungslose, Grunddefinition der Ökonomie ist mit den immer bedrohlicheren Umweltschäden nicht mehr durchhaltbar. Wer darauf hinweist, oder gar die Forderung nach der Begrenzung von Wirtschaftswachstum erhebt, erlebt geradezu erpresserische Abwiegelungen, die nur möglich sind, weil zwischen Bewirtschaftung und Ökonomie nicht unterschieden wird: Es werden Drohszenarien zu deflationären Entwicklungen entworfen, Krisen und Arbeitslosigkeit prognostiziert, Kollapsdystopien ausgemalt und too-big-to-fail-Ansprüche gestellt. Aber Wirtschaftswachstum ist nicht gleichzusetzen mit ökonomischem Wachstum. Auch dies wird an der Corona-Pandemie wie durch ein Brennglas deutlich, wenn auf einmal in Erwägung gezogen wird, dass es Wirtschaftsbereiche geben kann, welche der Konkurrenzökonomie entzogen werden. Dies zeigt: Ob und welche wirtschaftlichen und hier insbesondere physischen Ressourcen der derzeit praktizierten ökonomischen Verwertungspraxis unterliegen, ist letztlich eine Frage politischer Entscheidungen und keine unausweichliche Gegebenheit ökonomischer Zwangsgesetze.
ZUM PROBLEM DER WIRTSCHAFTSAKTEURE
Auch die verzwickte Situation der Wirtschaftsakteure wird als eine quasinatürliche behauptet. Die Kernargumentation ist hier doppelt gelagert: Erstens wird unterstellt, dass eine Begrenzung von Bedürfnissen »natürliche« Ursachen hätte. Und zweitens seien Wirtschaftsakteure auch in ihrer Verwendung ihrer Mittel eingeschränkt, da die Ressourcen des Planeten nun einmal endlich seien. Hier werden die persönliche und die gesellschaftliche Ebene ganz gezielt vermischt und darüber hinaus mit physischen Vorgängen kombiniert: Bei der ersten Argumentationslinie – dass eine Begrenzung der Bedürfnisse eine »natürliche« Ursache hätte – wird auf ernährungsphysiologische Vorgänge insistiert, welche für alle Lebewesen gelten, und daraus ein »Gesetz« postuliert. Dieses »Sättigungsgesetz« wird den Studierenden mit dem Verspeisen von Schwarzwälder Kirschtorte oder dem Trinken von Bier eingetrichtert – ein Magen lasse nun einmal nur eine begrenzte Bedürfnisbefriedigung zu. Und für das zweite Argument – eine quasinatürliche Begrenzung der Mittel – werden die Student*innen sprichwörtlich in die Wüste geschickt, damit sie am sogenannten »Wasser-Diamant-Paradox« einsehen, dass Knappheit situativ als »natürliche« und gleichzeitig »persönliche« hinzunehmen sei – Diamanten seien nun mal selten, und je nach persönlicher Situation könne es auch Wasser sein. Beide Vermengungen – gepaart mit fragwürdiger Personifizierung – sollen gleichzeitig erforderliche Grenzziehungen begründen. Sowohl die Minimum-Grenze (»Sättigung«) wie die Maximum-Grenze (»begrenzte Mittel«) sind Voraussetzung für die mathematische Umsetzung dieses Konzepts – als Grenzwertberechnung.
Wählt man jedoch Wasser statt Bier als Beispiel in der Sättigungsfrage, würde die Frage sofort in die einer notwendigen Versorgung in der Zeit umschlagen. Es würde auf einen der Bereiche rekurriert werden, die man vor ihrer Einverleibung in die Verwertungsökonomie noch als »Versorgungswirtschaften« behandelte. Diese wurden in der Corona-Pandemie zwangsläufig wieder neu »entdeckt«, womit wiederum das gleichmachende Reflexionsproblem angedeutet wird, dem die Wirtschaftsakteure unterliegen: Ob Pflegekraft, Chirurg*in, Diamantschleifer*in oder Börsenmakler*in – es findet keine Differenzierung statt. Es wird weder zwischen Versorgungswirtschaft und übriger Realwirtschaft unterschieden noch zwischen Realökonomie und Finanzökonomie. Diese Gleichstellung unterschiedlicher Bereiche geschieht durch die Konstruktion einer raum- und zeitlosen Allokationstheorie. Die Pandemie verdeutlichte diese Fiktion einmal mehr, weil sie offenbar macht, dass zwischen der Versorgungsökonomie, der darauf aufbauenden Realwirtschaftsökonomie und der Finanzökonomie ein hierarchisches Verhältnis besteht.
Doch selbst jetzt, während wir die Auswirkungen von Corona zu fassen versuchen, wird dies nach wie vor nicht problematisiert und die damit einhergehenden Verwerfungen kaum thematisiert: Neben dem Gesundheitssystem, das Teil der Versorgungsökonomie ist und dem wegen existenziell sichtbarer Mängel nachdrücklich Besserung versprochen wurde, geriet auch die Landwirtschaft in die Schlagzeilen. Die sichtbar gewordenen Missstände und Schräglagen wurden dabei aber kaum infrage gestellt. Der Laie erfuhr im März 2020, dass es für die Ernte in Deutschland genauso viele Arbeitsmigrant*innen braucht, wie es überhaupt Landwirt*innen mit über zehn Hektar Fläche in Deutschland gibt – circa 200 000. Statt Fragen dazu aufzuwerfen, galt es stur, die »deutsche Ernte« zu retten, wozu Mitte März beschlossen wurde, die vom Bundesinnenministerium verhängte Einreisesperre für Arbeitsmigrant*innen wieder aufzuheben – die verhängt worden war, obwohl diese aus Ländern wie Rumänien kamen, die zu diesem Zeitpunkt nur sehr geringe Corona-Fallzahlen aufwiesen. Arbeitsmigrant*innen wurden also in das von der Virus-Pandemie erfasste Deutschland rekrutiert und arbeiteten – in Massenunterkünften oder gar Containern untergebracht – zum üblichen Mindestlohn, nur um den Deutschen den sonntäglichen Spargel zu ernten. Der politische Wille, ökonomische Prozesse zum Wohle der Gesundheit zeitweilig anzuhalten, wurde hier nicht nur nicht an den Tag gelegt, er wurde den osteuropäischen Arbeitsmigrant*innen aktiv verweigert, ihnen wurde sogar das Gegenteil zugemutet: Ökonomische Vernutzung trotz des Wissens um die gesundheitlichen Gefahren.
Kaum jemand stellte zudem die Frage, warum und auf welcher Basis Deutschland viertgrößter (!) Spargelproduzent der Welt ist. Es waren weder Politiker*innen noch Ökonom*innen, sondern zum Beispiel der Pfarrer Peter Kossen, der am 2. März an das hier bestehende System voller politischer, ökonomischer und sozialer Verwerfungen erinnerte, das in der Landwirtschaft nicht nur für Spargel und Erdbeeren gilt, sondern ebenso auch für Schlachthöfe. In Kirche+Leben startete er daher den Aufruf:
»›Will man einfach zusehen, wie Lücken geschlossen werden und die Ausbeutungsmaschinerie für billiges Fleisch weiterläuft oder ist jetzt nicht der Zeitpunkt, die Räder anzuhalten und den Systemwechsel herbeizuführen?‹, fragt Kossen. Das System einer Wertschöpfung, die weitgehend auf der Ausbeutung von Arbeitsmigranten aufgebaut ist, sei krank und mache krank. ›Die Abkehr von diesem kranken System ist längst überfällig!‹«
Ebenso wenig wurden und werden die umweltbezogenen Folgeschäden solcher landwirtschaftlicher Praxis thematisiert. Diese waren während der Corona-Pandemie keineswegs verschwunden, nur spielte die Ausnahmesituation im März 2020 der Bundesregierung in die Hände: Zwei Wochen nach Beginn der Pandemie verabschiedete der Deutsche Bundesrat am 27. März die neue Düngeverordnung, wegen der Landwirt*innen noch im Herbst 2019 mit ihren Trecker-Demos für Schlagzeilen gesorgt hatten. Was hat die Bundesregierung – nun ganz ohne Demonstrationswiderstand – da verabschiedet?
In der intensiven Landwirtschaft sind die Landwirt*innen das unterste Glied in der Hierarchie der Konkurrenzökonomie. Für ein Kilogramm Schweinefleisch bekamen sie 2018 etwa 1,50 Euro. Das entspricht circa drei Euro Gewinn pro Schwein nach Abzug aller Kosten, was zu immer größerer Massenproduktion verleitet, einfach um die geringen Einnahmen durch erhöhte Mengen auszugleichen. Damit steigt auch die Menge der anfallenden Fäkalien, deren Ausbringung zu höheren Nitratbelastungen führen. Zwar hatte die EU Deutschland wiederholt verwarnt, aber die Bundesregierung hat gestellte Fristen immer wieder verstreichen lassen. Also hieß es Ende 2019 seitens der EU: Sollte die Düngeverordnung nicht den Forderungen angepasst werden, drohen Deutschland Strafzahlungen von bis zu 860 000 Euro – pro Tag! Das entspricht über 300 Millionen Euro im Jahr.
Das Ausmaß struktureller Verwerfungen ist hier also noch verheerender als im Spargel-Beispiel: Deutschland ist, nach China und den USA, der drittgrößte (!) Schweinefleischproduzent der Welt und weltweit sogar der größte Schweinefleischexporteur. Mit über 27 Millionen Schweinen fallen so im Jahr – zusammen mit den anderen Tierbeständen – über 200 Millionen Kubikmeter Gülle und Jauche an, die irgendwo hinmüssen. Die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt in Deutschland aber nur 16 Millionen Hektar (in China 520 und in den USA 406 Millionen Hektar).
Von der Politik wird dieser Konkurrenzkrieg und die damit einhergehenden strukturellen Verwerfungen überspielt oder sogar das Gegenteil behauptet. Es ginge, so Agrarministerin Julia Klöckner zur Arbeitsmigrant*innen-Situation in agrar heute, um den Erhalt einer »flächendeckenden, multifunktionalen heimischen Landwirtschaft«.
Wie wird diese gigantische Massenproduktion in Deutschland zu Lasten der Umwelt und der Menschen, die in ihr arbeiten, ökonomisch reflektiert? Die zuständigen Agrarökonom*innen reagieren in althergebrachten Mustern der angeblich unausweichlichen Konkurrenz. Zudem herrscht eine bemerkenswerte nationalistische Konnotation, wenn es beispielsweise heißt, in diesem Wettbewerb ginge »die größte Gefahr von den europäischen Wettbewerbern Spanien und Dänemark aus«, wie sich Achim Spiller und Kolleg*innen zu dem Konkurrenzkampf im Bereich Schweinefleisch ausdrücken. Die Parallele zur Situation im Spargelanbau ist auffällig, denn auch hier redete etwa die Bayerische Landanstalt für Landwirtschaft 2016 davon, dass die Anteile des »griechischen, französischen und spanischen Angebots erfolgreich vom Markt verdrängt« wurden.
Selbst in der aktuell andauernden Krise wird dabei auch die Gleichmacherei aller Wirtschaftsakteure, die im ständigen Kampfmodus gezeichnet werden, fortgesetzt – in gewohnter Manier eines Einheitsbreis aller Wirtschaftsakteure in einem Topf, lediglich perspektivisch in »Anbietende« und »Nachfragende« aufgeteilt. Im »Corona-Krieg« forderte zum Beispiel Hans-Werner Sinn in Project Syndicate am 16. März in üblichem Denkschema, dass in der jetzigen Situation dringend angebotsfördernde Maßnahmen erfolgen müssten:
»Eine heftige Rezession ist nicht mehr zu vermeiden. Manche Ökonomen schlossen daraus, dass man dagegen nun mit nachfragestimulierenden Maßnahmen angehen solle. Diese Position überzeugt nicht wirklich, denn die Weltwirtschaft leidet nicht unter einem Nachfrage-, sondern unter einem Angebotsmangel. […N]achfragestimulierende Maßnahmen könnten sogar kontraproduktiv sein, denn sie würden dem gesundheitspolitisch Gebotenen entgegenwirken, weil sie die Kontaktaufnahme der Menschen fördern.«
Kann diese Herangehensweise weiter überzeugen? Wer genau wurde damit adressiert? Deutsche Nachfrager*innen? Europäische? In Italien, wo etwa fünf Millionen Menschen unter der Armutsgrenze leben, hatten jedenfalls am gleichen Tag die ersten »Nachfrager*innen« in Süditalien und Neapel versucht, Lebensmittelmärkte zu plündern, wie Voce Spettacolo berichtet – weil sie hungerten.
Der unsinnige Streit um das althergebrachte Schema von Angebot und Nachfrage wird so zu Lasten der Betroffenen fortgesetzt. Das ist ebenso eine Folge der nach wie vor üblichen Annahme, dass Zusammenhänge mittels Funktionsgleichungen ermittelt werden können, aber der ewige Streit um die Frage, ob das Angebot vor der Nachfrage oder die Nachfrage vor dem Angebot priorisiert werden soll – aufgrund der mathematisch gegenseitigen Abgängigkeit der beiden Variablen dabei –, letztlich gar nicht beantwortet werden kann. Das verwendete Vokabular verschleiert zudem, um welche Abhängigkeitsverhältnisse es dabei geht. Denn »Anbietende« bieten nicht nur an, sondern müssen andere Waren innerhalb der Konkurrenzökonomie sprichwörtlich um jeden Preis unterbieten, also die eigenen loswerden. Und »Nachfragende« »fragen« nicht nur – egal in welcher Ökonomie –, sondern haben letztlich einen existenziellen Bedarf. Zu diesem grundsätzlichen Bedarf gehörten laut Walter Eucken nach dem Zweiten Weltkrieg Nahrungsmittel, Wohnen, Energie und Verkehr, welche daher subventioniert wurden. Sie waren der »Preis der Marktwirtschaft«, so Irmgard Zündorf. Die Corona-Pandemie zwingt dazu, wenigstens über diese Bereiche neu nachzudenken, während für alle anderen Bereiche gehofft wird, in alter Manier bald wieder »durchstarten« zu können. Ermöglichen soll dies nun der »Staat« mit Milliarden Euro Finanzhilfen, wiewohl gerade eben jener Staat seitens der Ökonom*innen, die diese Hilfen nun fordern, über Jahrzehnte diskreditiert wurde.
ZUR ROLLE DES STAATES
Von den »führenden Ökonom*innen« wird die Regierung aktuell in der Corona-Krise aufgefordert, »man müsse schnell handeln, um jetzt durch die Bereitstellung von Milliarden-Mitteln […] Vertrauen zu schaffen«, so etwa Clemens Fuest, Chef des Münchner ifo-Instituts im Interview der Deutschen Welle. In einer Ökonomie, die von vornherein gedacht wird als »economy in which decisions about production and consumption are made by individual producers and consumers«, wie Paul Krugman und Robin Wells es formulieren, kommt ein Staat als ökonomischer Akteur gar nicht vor.
In Krisenzeiten allerdings wird wie selbstverständlich nach ihm gerufen. Schon 2009 konstatierte der damalige deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, dass »in der Krise eine Renaissance des Staates« als selbstverständlich thematisiert wird, aber Ökonom*innen diesen Staat sonst »weitgehend als Störfaktor in der Wirtschaft« sehen, »den man möglichst weit heraushalten wollte«.
Eine Institution, die von allen Arbeitnehmer*innen sowie allen Unternehmen eines Landes einen beträchtlichen Anteil an Steuern einnimmt – sofern sich diese dem nicht auf illegale Weise entziehen – als ökonomisch irrelevant zu erklären, gehört nicht nur zum fehlenden Reflexionsvermögen der herrschenden Ökonomik, sondern gleicht auch einem antistaatlichen Framing. Das stärkste Argument im politischen Kampf um die vorherrschende Wirtschaftsordnung gegen eine »Planwirtschaft« lieferte Adam Smith schon 1779:
»Ein Staatsmann, der es versuchen sollte, Privatleuten vorzuschreiben, auf welche Weise sie ihr Kapital investieren sollten, würde sich damit […] eine Autorität anmaßen, die man nicht einmal einem Staatsrat oder Senat, geschweige denn einer einzelnen Person getrost anvertrauen könnte […].«
Doch inwieweit gilt diese Warnung vor einer – in den Worten Friedrich von Hayek – »Anmaßung von Wissen« noch, wenn in allen relevanten Wirtschaftsbereichen nur noch eine Handvoll Großkonzerne existieren? Wenn sich in Deutschlands Lebensmitteleinzelhandel Edeka, Rewe, die Schwarz-Gruppe und Aldi 85 Prozent des Absatzmarktes teilen? Beziehungsweise wenn nur ein Unternehmen eine ganze Branche beherrscht, wie Google 90 Prozent des deutschen Suchmaschinenmarktes? Oder wenn es sogar um die weltweite Beherrschung eines Marktes geht – Beispiel Saatgutmarkt, der zu zwei Drittel durch die Chemiekonzerne Bayer-Monsanto, Syngenta und Dupont kontrolliert wird?
Diese Marktbeherrschung wird in der Ökonomik ebenso ungenügend problematisiert, wie die realen Entwicklungen der Wirtschaftsakteure nicht reflektiert werden. Angesichts solcher Konzentrationen wird die in der Ökonomik bis heute bemühte »invisible hand« als »unplanned economy«, wie es von Paul Krugman und Robin Wells heißt, schlichtweg obsolet. Auch diese Auffassung gehört zum unreflektierten Grundrepertoire der herrschenden Ökonomik. Allzu bekannt ist sie als Rhetorik von der angeblichen Selbstlenkung der »Märkte«, die als sich selbst regulierende »Koordination« angepriesen wird, wie Paul A. Samuelson und William D. Nordhaus dies in ihrem Lehrbuch 2007 tun. Sie sprachen 2016 sogar den »Markt« als handelndes Wesen an und fragten enthusiastisch: »Wer löst die drei Grundfragen wirtschaftlicher Organisation, nämlich was, wie und für wen produziert wird?«
Ja – wer löst diese Grundfragen wirtschaftlicher Organisation? Organisationen sind von Menschen gemachte Institutionen. Kein »Markt« existiert »an sich« oder reguliert sich selbst. Märkte sind organisiert. Sie sind, laut Reinhard Pirker, Regulierungsformen des sozialen Lebens. Daher ist jede Marktökonomie eng mit der Legislative, Exekutive und Judikative eines Staates verbunden. Ohne diese Verwobenheit wären weder unternehmensfreundliche Gesetzgebungen erklärbar noch umgekehrt politische Entscheidungen gegen Unternehmensinteressen.
Auch in diesem Punkt wird die Corona-Pandemie zeigen, inwieweit die Politik sich im Zuge der Krisenbewältigung emanzipieren kann oder – wie in der Finanzkrise ab 2008 – nur von Unternehmensinteressen getrieben agiert und »Staatsschulden« anhäuft, ohne das Reglement wirksam neu zu gestalten. Seitens der aktuell zur Tagespolitik befragten und zitierten »führenden Ökonom*innen« beobachten die Medien derzeit zwar mehrheitlich eine »Abkehr von der reinen Lehre«, wenn das Aufkündigen der »Schwarzen Null« im Bundeshaushalt, massive Staatshilfen sowie sogar Staatsbeteiligungen für Unternehmen gefordert werden. Weit wesentlicher für die Zukunft aber wird sein, diese »reine Lehre« endlich umzustellen auf eine realistische Ökonomik, in der die ökonomischen Entwicklungen und deren Folgen und die eigene Gestaltungskraft reflektiert werden. Hierin stehen Ökonom*innen in der Verantwortung, der sie sich nicht entziehen können. Wie würden Sozialwissenschaftler*innen reagieren, wenn Politikwissenschaftler*innen ankündigten, politische Entscheidungsprozesse zu analysieren, aber die politischen Folgen als »extern« ausklammert, mit der Begründung, sie seien kein Thema der Politikwissenschaften?
Das Reflexionsdesaster in der Ökonomik ist endlich zu beenden!

Dr. Katrin Hirte ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft (ICAE) der Universität Linz und forscht u. a. zur gesellschaftlichen Wirkung der Wirtschaftswissenschaften.

»Reflexivität verträgt sich in Lehre und Forschung nicht mit geistiger Monokultur, dogmatischer Starre, methodischer Verengung und erkenntnismäßigem Zwang. Reflexivität als Rückbezogenheit auf die Gesellschaft und Nachdenklichkeit im Analysieren, Interpretieren und Bewerten gesellschaftlicher Veränderungsprozesse trifft den Kern der ›Third Mission‹ von Hochschulen.«
Reinhard Loske
 | HOCHSCHULEN UND DIE »THIRD MISSION« |