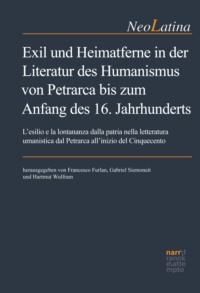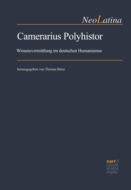Kitabı oku: «Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts», sayfa 13
Bibliografia
Barreto, Joanna: La majesté en images: Portraits du pouvoir dans la Naples des Aragon, Roma 2013.
Cappelletto, Rita: Per l’edizione critica di un’elegia del Porcelio, in: Vincenzo Fera / Giacomo Ferraú (edd.): Filologia Umanistica: Per Gianvito Resta, I, Padova 1997, 241–266.
Cappelli, Guido: Porcelio de’ Pandoni: De vita servanda a regum liberis, Letteratura italiana antica 5, 2004, 211–226.
Cappelli, Guido M.: Petrarca e l’umanesimo politico del Quattrocento, Verbum 7, 2005, 153–175.
Cappelli, Guido M.: La otra cara del poder: Virtud y legitimidad en el humanismo político, in: Guido M. Cappelli / Antonio Gómez Ramos (edd.): Tiranía: Aproximaciones a una figura del poder, Madrid, 2008, 97–120.
Cappelli, Guido: Pandone, Porcelio, in: Dizionario biografico degli italiani 80, Roma 2014, 736–740.
Cappelli Guido: Maiestas: Politica e pensiero nella Napoli aragonese (1443–1403), Roma 2016.
Coppini, Donatella: La polemica Porcelio-Panormita, in Appendice a Un’eclisse, una duchessa, due poeti, in: Roberto Cardini / Eugenio Garin / Lucia Cesarini Martinelli / Giovanni Pascucci (edd.): Tradizione classica e letteratura umanistica: Per Alessandro Perosa, I, Roma 1985, 355–373.
Coppini, Donatella: Poesia umanistica e codice classico: Adesione, deviazione, infrazione, in: Ute Ecker / Clemens Zintzen (edd.): Sæculum tamquam aureum: Internationales Symposion zur Italienischen Renaissance des 14.–16. Jahrhunderts, Hildesheim 1997, 1–29.
Delle Donne, Fulvio: Il potere e la sua legittimazione: Letteratura encomiastica in onore di Federico II di Svevia, Arce 2005.
Delle Donne, Fulvio: La letteratura encomiastica alla corte di Alfonso il Magnanimo, Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medioevo 114, 2012, 221–239.
Delle Donne, Fulvio: Alfonso il Magnanimo e l’invenzione dell’Umanesimo monarchico: Ideologia e strategie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli, Roma 2015.
Delle Donne, Fulvio: Cultura e ideologia alfonsina tra tradizione catalana e innovazione umanistica, in: Fulvio Delle Donne / Jaume Torrò Torrent (edd.): L’immagine di Alfonso il Magnanimo, Firenze 2016, 33–54.
Filelfo Francesco: Collected Letters: Epistolarum libri LXVIII, Critical edition by Jeroen de Keyser, Alessandria 2016.
Flamini, Francesco: La lirica toscana del Rinascimento anteriore ai tempi di Lorenzo il Magnifico, Pisa 1891.
Formicola, Crescenzo: Il canto del cigno caístrio: Introduzione a P. Ovidio Nasone, Epistulæ ex Ponto, libro III, Pisa / Roma 2017, 15–34.
Frittelli, Ugo: Giannantonio de’ Pandoni detto il Porcellio, Firenze 1900.
Gabotto, Ferdinando: Un episodio di storia letteraria del Quattrocento: Il Porcellio a Milano, Verona 1890, 1–15 (poi Id.: Il Porcellio a Milano, Verona 1890).
Giraldi, Lilio Gregorio: Due dialoghi sui poeti dei nostri tempi, A cura di Claudia Pandolfi, Ferrara 1999.
Guarino Veronese: Epistolario, A cura di Remigio Sabbadini, 3 vol., Venezia 1915–1919.
Iacono, Antonietta: Autobiografia, storia e politica nella trattatistica di Tristano Caracciolo, Reti Medievali 13, 2012, 333–369.
Iacono, Antonietta: Porcelio de’ Pandoni, in: Francesco Bausi / Maurizio Campanelli / Sebastiano Gentile / James Hankins (edd.): Autografi dei letterati italiani: Il Quattrocento, I, Roma 2013, 351–355.
Iacono, Antonietta: La nascita di un mito: Napoli nella letteratura umanistica, in: Giuseppe Germano (ed.): Per la valorizzazione del patrimonio culturale della Campania: Il contributo degli studî medio- e neo-latini, Napoli 2016, 48–63.
Iacono, Antonietta: Classici latini e tecniche di autocitazione nella composizione poetica di Porcelio de’ Pandoni, Bollettino di Studî latini 1, 2017, 156–177.
Iacono, Antonietta: Porcelio De’ Pandoni: L’umanista e i suoi mecenati: Momenti di storia e poesia, Napoli 2017.
Iacono, Antonietta: Encomio, celebrazione e antiquaria negli Epigrammata de summis imperatoris laudibus Francisci Sfortiæ Mediolanensium ducis di Porcelio de’ Pandoni, in: Cristina Cocco / Clara Fossati / Attilio Grisafi / Francesco Mosetti Casaretto (edd.): Itinerari del testo: Studî in onore di Stefano Pittaluga, Genova 2018 (in c.d.s).
Iacono, Antonietta: L’officina di un poeta del Quattrocento: La tecnica del riuso nella produzione poetica di Porcelio de’ Pandoni, in: Paul Gwynne / Bernhard Schirg (edd.): Economics of poetry efficient techniques of producing neo-Latin verse, Oxford 2018, 131–154.
Laurenza, Vincenzo: Poeti e oratori del Quattrocento in una elegia inedita del Porcellio, in: Atti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli 24, 1906, 213–223.
Mercati, Giovanni: Codici latini di Pico, Grimani, Pio e di altra biblioteca ignota del sec. XVI esistenti nell’Ottoboniana, Città del Vaticano 1938.
Nociti, Vincenzo: Il trionfo di Alfonso I d’Aragona cantato da Porcellio, Rossano 1895.
Panhormitæ, Antonii: De dictis et factis Alfonsi regis Aragonum libri quattuor, Basileæ ex Off. Hervagiana, 1538.
Petrucci, Franca: Colonna, Propero, in: Dizionario biografico degli italiani 27, Roma 1982, 343–344.
Pfisterer, Ulrich: Filaretes Künstlerwissen und der wiederaufgefundene Traktat De arte fuxoria des Giannantonio Porcellio de’ Pandoni, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz 46, 2002, 121–151.
Pontano, Giovanni: Carmina, A cura di Benedetto Soldati, Firenze 1902.
Pontano, Giovanni: I dialoghi, A cura di C. Previtera, Firenze 1943.
Pontano, Giovanni: De sermone libri sex, A cura di Sergio Lupi / Antonio Risicato, Lugano 1954.
Pontano, Giovanni: I libri delle virtú sociali, A cura di Francesco Tateo, Roma 1999.
Rozza, Nicoletta: Il De talento di Porcelio de’ Pandoni e le sue fonti classiche, Vichiana 54, 2017, 93–101.
Sabbadini, Remigio: La polemica fra Porcelio e il Panormita, Rendiconti del r. Istituto lombardo di Scienze e Lettere, s. II, 50, 1917, 495–501.
Safarik, Eduard A.: Palazzo Colonna, Roma 1999.
Sanfilippo, Matteo: Pio III, in: Dizionario biografico degli italiani 83, Roma 2015, 803–808.
Serio, Alessandro: Una gloriosa sconfitta: I Colonna tra papato e impero nella prima Età moderna (1431–1530), Roma 2008.
Settis, Salvatore / Torraca, Donatella (edd.): La libreria Piccolomini nel duomo di Siena, Modena 1998.
Stornajolo, Cosimo: Bibliotheca Vaticana: Codices Urbinates Latini, II, Roma 1912.
Tavolari, Barbara: Liberaliter agere: Le tre Grazie: un marmo antico nella Libreria Piccolomini, in: Mario Lorenzoni (ed.): Le sculture del duomo di Siena, Cinisello Balsamo 2009, 166–170.
Vitale, Giuliana: Modelli culturali nobiliari nella Napoli aragonese, Salerno 2002.
Wren Christian, Kathleen: Empire without end: Antiquities collections in Renaissance Rome, New Haven / Londra 2010.
Zannoni, Giovanni: Porcellio Pandoni e i Montefeltro, Rendiconti della real Accademia dei Lincei: Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, s. V, 4, 1895, 104–122; 489–507.
Et grauior Scythico mihi uisa Bononia caelo
Das ‚gefühlte Exil‘ Ludovico Emilio Boccabellas
Burkhard Krieger (Leipzig)
Zunächst soll der weitgehend unbekannte Dichter Ludovico Emilio Boccabella kurz vorgestellt werden, um anschließend die Darstellung seines „Exils“ zu untersuchen, inwieweit sie der historischen Wahrheit entsprechen kann oder ob sie eher auf literarischem Spiel nach dem Vorbild Ovids beruht.
Der aus einer adligen Familie stammende Dichter Ludovico Emilio Boccabella,1 bisher im „Dizionario Biografico degli Italiani“ unter dem Namen Paolo Emilio Boccabella geführt,2 kommt aus Rom und ist im Jahr 1453 geboren. Eine gewisse Bedeutung hat er durch sein Mitwirken in der Römischen Akademie um Pomponio Leto erlangt, eine der schillerndsten Figuren des Humanismus in Italien des Quattrocento. Dadurch kam Boccabella, wie sich auch anhand seiner Gedichte belegen lässt, mit sehr vielen weiteren zeitgenössischen Größen in Kontakt, darunter Bartolomeo Platina, Domizio Calderini, Giannantonio Campano, Francesco Filelfo und Porcelio de’ Pandoni. Bekannt ist Boccabella auch durch sein Mitwirken an einer gedruckten Gedichtsammlung für Alessandro Cinuzzi, einen Pagen Pietro Riarios.3
Nachdem sein erster Mäzen, der Kardinal Pietro Riario, im Januar 1474 überraschend verstorben war, fand Emilio Boccabella wohl noch im gleichen Jahr mit dem Kardinal Francesco Gonzaga aus Mantua einen neuen Förderer. Doch unter Gonzagas Ägide musste Boccabella im Jahr 1475 Rom verlassen. Auf Betreiben seines neuen Mäzens war er gezwungen, nach Bologna zu gehen, um dort ein Jurastudium aufzunehmen. Im September 1480 wurde Boccabella jedoch in Bologna von seinem Bruder Alessandro Boccabella vermutlich während eines Streits erstochen.
Sein früher Tod erklärt das überschaubare literarische Erbe des Dichters, das hauptsächlich auf vier Epigrammbüchern beruht, die in ihrer Gesamtheit allein in der Handschrift Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Q 114, überliefert sind. Weitere Überlieferungsträger einzelner Bücher sind die Handschriften Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat.lat. 3603 (Buch 1); ibidem, Ottob.lat. 2280 (Buch 1–3); Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, XII 178 (= 4025, Buch 4).
Die Aufnahme des Studiums in Bologna bildet einen Bruch in der Biographie Boccabellas. Zu seinem Gang in die „gelehrte Stadt“ schreibt er in dem Gedicht Io. Francisco de Gonzaga (2, 3, 5–12), das sich an Giovanfrancesco Gonzaga richtet, den jüngeren Bruder Francesco Gonzagas, folgendes:4
Accipe Felsineae quid agam nouus accola terrae
Quiue recens patria traxit ab urbe calor.
Romulides quondam ueluti studiosus Athenas
Aut Rhodon aut Tharson excoluitque Pharon,5
Hic ego sic aliquos statui dare legibus annos,
Consilio fratris praesidioque tui.
In proprijs Laribus permissa licentia rerum
Ad palmam recta non sinit ire uia.
(Höre, was ich als neues Bewohner der Erde Bolognas mache,
Oder welcher Eifer mich aus der heimatlichen Stadt geschleppt hat.
Wie einst der wissbegierige Nachkomme des Romulus Athen,
Rhodos, Tharsos oder Pharos beehrt hat,
So habe ich beschlossen, hier einige Jahre den Gesetzen zu widmen,
Auf den Ratschlag und unter dem Schutz deines Bruders.
In den eigenen Laren lässt mich die erlaubte Zügellosigkeit in den Dingen
Nicht auf dem rechten Weg zur Siegespalme marschieren).
Mit dem Verb statui deutet Boccabella zwar an, dass die Entscheidung, Rom zu verlassen und ein Studium in Bologna aufzunehmen, auf ihn selbst zurückgeht. Aber im Pentameter des gleichen Distichons lässt er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung der Bruder Giovanfrancesco Gonzagas war, d.h. sein neuer Mäzen Francesco Gonzaga. Boccabella stand in einem Klientelverhältnis gegenüber seinem Mäzen, wie er in der Prosapräfatio zum vierten Buch darlegt:
[…] quin ad innocentiam fidem obseruantiamque nominis tui dies ac noctes plurimas assumpsi, ut optimum clientem decet […].
([…] ja ich habe sogar zur Rechtschaffenheit, Ehrenhaftigkeit und Hochachtung deines Namens Tage und Nächte auf mich genommen, wie es sich für einen sehr guten Klienten gehört […]).
Das Studium in Bologna trat Boccabella wohl im Jahr 1475 an. Dies geht aus der Präfatio des zweiten Buchs hervor, in dem Boccabella vom „im vorherigen Jahr aufgenommenen Studium“ spricht:
Etsi uereor a multis argui posse hoc mihi studium carminis repetitum, quod superiore anno missum feci legibus omnem uitam atque operam daturus […].
(Wenn ich auch fürchte, dass [mir] von vielen diese von mir wieder aufgegriffene Begeisterung um die Dichtung vorgeworfen wird, welche ich im vorherigen Jahr niedergelegt hatte, als ich [mein] ganzes Leben und alle Mühe den Gesetzen widmen wollte, […]).
Seine Studienzeit in Bologna stellt Boccabella in seinen Gedichten als ein seelisches Martyrium dar, das in erster Linie mit Heimweh begründet wird.6 Wiederholt (in mehr als zehn Gedichten) bittet er seinen Mäzen Francesco Gonzaga darum, ihn nach Rom zurückgehen zu lassen (2, 1; 2, 15; 2, 30; 2, 32; 2, 43; 2, 48; 2, 56; 3, 1; 4, 7). Bereits in Gedicht 2, 1, keine zwei Jahre nach Beginn seines Studiums in Bologna, lässt Boccabella diesen Wunsch vorsichtig anklingen (19–20):
Forsitan et nostri non immemor unus et alter
Te capient, ut me tunc redijsse putent.7
(Vielleicht wird der eine oder andere, der unser nicht uneingedenk ist,
Dich einnehmen, damit sie glauben, dass ich dann zurückkehre).
Die nächste Andeutung erfolgt in dem Gedicht Ad Musam (2, 15, 11–12):
Illuc Felsinea ueniam cessurus ab urbe,
In qua me studij uita seuera tenet.8
(Dorthin [sc. Rom] werde ich kommen, indem ich die Stadt Bologna verlassen werde,
In der mich das harte Leben des Studiums festhält).
Die Härte des Studiums, über die sich Boccabella beklagt, uita seuera studii, muss sich allerdings nicht auf Boccabellas Heimweh beziehen, sondern kann auch allein auf das Studium und den großen Konkurrenzkampf gemünzt sein, der an der Universität herrschte und der dem – nicht nur in diesem Gedicht – kranken Dichter eventuell auf das Gemüt schlug.9 Die Betonung, dass der Gang in seine Heimatstadt Rom ihn von dem Druck des Studiums befreie, ist jedoch als Indikator zu sehen, dass ihm nicht nur das Studium, sondern auch Bologna als Stadt missfällt.
In Gedicht 2, 32, 1–4, das sich an Domenico Foschi richtet, wird Boccabella konkreter. Domenico Foschi stammte aus Rimini und lebte, wahrscheinlich als Schreiber in der Kanzlei, schon länger in Bologna. Darüber wundert sich Boccabella in seinem Gedicht. Er bringt sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass Domenico Foschi bereits acht Jahre lang in Bologna lebe, wohingegen er selbst es kaum so viele Monate ausgehalten habe:
Octonos tenuit te Felsina docta per annos
In patriam nec mens ulla redire tibi est.
Ipse ego uix potui laetus tot uiuere menses,
Hic sitio Latiam dum remeare domum.10
(Acht Jahre lang hält dich das gelehrte Bologna
Und du trägst keinen einzigen Gedanken, in die Heimat zurückzukehren.
Ich selbst habe kaum so viele Monate [hier] fröhlich leben können,
Während ich mich hier danach sehne, nach Hause zurückzukehren).
Die Verse sind ein Hinweis darauf, dass Boccabella das gelehrte Bologna geradezu als ein „Provinznest“ ansieht. In diese Richtung weist auch eine despektierliche Äußerung in Gedicht 4, 41, 24. Dort schimpft er Bologna einen ager sterilis.
Neben der Strenge des Studiums und der Verachtung der Stadt führt Boccabella als weiteren Ablehnungsgrund für einen weiteren Aufenthalt in Bologna das dortige Klima an. Mehrfach schreibt er seinem Mäzen Kardinal Francesco Gonzaga, dass in Bologna „skythische Zustände herrschten“,11 beginnend in Gedicht Cardinali Mantuano (2, 43, 11–12):
Et grauior Scythico mihi uisa Bononia caelo,
Quae ter in Elysias paene coegit aquas.
(Und schlimmer als der skythische Himmel scheint mir Bologna,
das mich dreimal fast zu den elysischen Wassern zwang).
Das skythische Klima Bolognas habe Boccabella bereits mehrmals beinahe in die Unterwelt befördert. Mit der Übernahme des ovidischen, in der neulateinischen Dichtung sonst nicht belegten Ausdrucks Scythicum caelum (Ov. Pont. 4, 9, 81: quaere loci faciem Scythicique incommoda caeli) weist Boccabella darauf hin, dass er sich in Bologna als Exilant wie Ovid in Tomis bei den Geten fühlte.
In dem Gedicht Diuo Francisco Cardinali Mantuano (3, 1, 16–21) folgt die nächste Klage:
Quare me Ioue crassiore natum
Romano gelidus molestat äer
Felsinus studio datum Mineruae.
Annus uix abijt quater citatus
Inferni Ditis horrui tribunal.
Nec dum squalor abest. […]12
(Deshalb belästigt mich, der ich unter einem dichteren Himmel geboren bin,
Dem römischen, die eiskalte Luft
Bolognas, mich, der ich mich dem Studium der Minerva hingegeben habe.
Kaum geht ein Jahr hinweg, [schon] viermal herbeigerufen
Habe ich gezittert vor dem Gericht des unterweltlichen Dis.
Noch [immer] ist die Unwirtlichkeit nicht fern. […]).
Auch hier wird das Motiv der Kälte angeführt, verbunden mit dem anschließenden Verweis auf die Unwirtlichkeit des Exilortes. Schon Ovid schildert z.B. in Trist. 3, 10 die Winter in Tomis, die für ihn eine große physische und seelische Belastung bedeuteten. Verknüpft werden die ovidischen Exilklagen über die Kälte und die barbarischen Zustände in Tomis mit dem Motiv der Krankheit, wie es in Trist. 3, 3, aber auch Tib. 1, 3 auftaucht. Dort befindet sich Tibull, der seinen Mäzen Messalla begleitet hatte, krank auf der Insel Corcyra.
Die drastischer werdenden Schilderungen von Kälte, Unwirtlichkeit und Krankheitsfällen in Bololgna dienen Boccabella dazu, seinen Mäzen Francesco Gonzaga – wie einst der verbannte Ovid Augustus – wiederholt darum zu bitten, ihn nach Rom zurückkehren zu lassen. Diese Bitte folgt auch nach dem oben zitierten Ausschnitt aus Gedicht 3, 1, in den Versen 21–24:
[…] Ut ergo possim,
Quod restat mihi, mitiore caelo
Sanus ducere tempus otiosum,
Da sedem placidae nouam quieti, […]
([…]. Damit ich es daher vermag,
Was mir verbleibt, unter einem milderen Himmel
Die der Muße ergebenen Zeit gesund zu verbringen,
Gib einen neuen Wohnsitz von gefälliger Ruhe, […]).
Der Ausschnitt verdeutlicht, dass sich Boccabella während seines Aufenthalts in Bologna als Flüchtling fühlt. Der Ausdruck da sedem wird von römischen Epikern in einschlägigem Kontext verwendet, und zwar in den Punica des Silius Italicus, wo Venus das Schicksal ihres Sohnes Aeneas beklagt, da sedem, genitor (Sil. 3, 567), und in Statius’ Thebais, wo Bacchus sich als Opfer Juppiters betrachtet, da sedem profugo (Theb. 7, 182). In Boccabellas Gedicht 4, 7, das sich an einen Freund richtet, der krank darnieder liegt, bringt der Dichter seine ganze Verbitterung über das Leben in Bologna zum Ausdruck (10):
Hic uitam mihi perditam recepi.13
(Ich habe hier [in Bologna] ein mir hoffnungsloses Leben aufgenommen).
Die von den Humanisten gerne benutzten Motive des Nordens, der Kälte bzw. des Winters und der Krankheit bis hin zum Tod in der Fremde leiten sich, wie Bernhard Coppel in Bezug auf den Humanisten Petrus Lotichius Secundus (1528–1560) bestätigt, „archetypisch von der Elegie her: Das Nord- und Wintermotiv von der Exilpoesie Ovids, das Gedichtthema des se aegrotante von Tibulls Krankheit auf der Insel Corcyra und von Ovids Krankheit in Tomis.“14 Es liegt auf der Hand, dass Boccabella mit dem Rückgriff auf die beiden römischen Elegiker, aber auch auf Statius und Silius Italicus ein literarisches Spiel betreibt. Denn wie sollten die Klagen über das skythische Bologna in den Ohren seines Mäzens Francesco Gonzaga geklungen haben, an den die Gedichte mit Bitte um eine Rückkehr nach Rom gerichtet sind? Ovid konnte mit seinen Klagen über die barbarische Kälte bei aller Übertreibung noch ein gewisses Maß an Überzeugungskraft gewinnen, allein aus Unwissenheit der Leser über seinen fernen Verbannungsort.15 Doch in Anbetracht der Tatsache, dass Francesco Gonzaga aus dem – von Bologna aus betrachtet – nördlicheren Mantua stammte, liegt die Vermutung nahe, dass Boccabellas Klagen über die skythische Kälte in der emilianischen Universitätsstadt bei Gonzaga eher für Erheiterung sorgten und nicht ernst genommen wurden. Mit Blick auf Boccabellas Darstellung seines ‚Exils‘ in Bologna stellt sich daher die Frage nach dem Verhältnis von literarischer Fiktion und historischer Wahrheit.
Es ist möglich, dass Boccabella aufgrund seines Gesundheitszustands die Winter in Bologna als hart empfunden hat. In seinen Gedichten thematisiert er auffällig oft, mindestens elf Mal (2, 15; 2, 24; 2, 30; 2, 45; 2, 48–49; 2, 56; 3, 36; 3, 62; 3, 63; 4, 64), eine eigene Erkrankung. Trotz des bereits dargelegten literarischen Spiels, das hier in Anlehnung an Tibull und Ovid geboten wird, sind die Krankheiten keine bloße Erfindung, was sich zumindest für das Gedicht Ad Musam 2, 15 belegen lässt. Dort schreibt Boccabella, dass er todkrank gewesen sei (1–2):
Iam prope me Stygia Charon deduxerat unda,16
Visus et ex oculis non nisi mortis erat.
(Schon hatte mich Charon fast auf dem stygischen Gewässer fortgeführt,
Und aus meinen Augen kam kein Blick außer dem des Todes).
Dass es sich nicht nicht um eine reine Hyperbel handelt, um Mitleid zu erregen und dem in 2, 15, 11 geäußerten Wunsch Nachdruck zu verleihen, Bologna verlassen zu dürfen, beweist das nachfolgende Gedicht Baptistae Mantuano Poetae (2, 16). Es richtet sich an einen der berühmtesten und angesehensten Dichter seiner Zeit, Giovanni Battista Spagnoli (Baptista Mantuanus), den Erasmus in einem Brief Vergilius Christianus nennt.17 In diesem Gedicht bedankt sich Boccabella bei Spagnoli für ein Gedicht an Apollon, in dem dieser den Heilgott gebeten habe, sich für die Gesundheit seines Freundes einzusetzen:
Carmine, quo nostrae Phoebum, Baptista, saluti
Sollicitas, maius nemo dedisse potest.
Tum quia testatur ueri graue pectus amici
Et uideor membris firmior esse meis.
(Niemand kann etwas Größeres gegeben haben als das Gedicht,
Mit dem du, Battista, Phöbus, für unsere Gesundheit tätig werden ließest.
Daraufhin, weil es die kranke Brust des wahren Freundes bezeugt,
scheine ich kräftiger in meinen Gliedern zu sein).
Tatsächlich findet sich in Spagnolis Silven das Gedicht (2, 7). In dessen Überschrift und in den ersten beiden Versen ist herauszulesen, dass Boccabella krank ist und Apollon daher um Hilfe angerufen wird:
Deprecatio pro salute Aemylii Romani
Phoebe quid Aemylio febrem sinis esse molestam?
In tua quid iuris corpora languor habet?18
(Bitte um Gesundheit für Aemilius Romanus
Phöbus, warum lässt du zu, dass Aemilius ein beschwerliches Fieber hat?
Welche Macht hat die Mattigkeit über deinen Körper?).
Der Kontext des Gedichts legt nahe, dass mit Aemilius Romanus Ludovico Emilio Boccabella gemeint ist, zumal in den Handschriften Boccabellas eigene Epigrammbücher mit diesem Namen versehen sind. Spagnolis Gedicht ist ein Beleg dafür, dass Boccabella tatsächlich von einem Fieber befallen war und in Gedicht 2, 15 somit kein rein literarisches Spiel mit dem Krankheitsmotiv in der Ferne vorliegt.19 Boccabella nimmt die Krankheit, die der historischen Wahrheit entspricht, als Grundlage, um darauf hinzuweisen, wie grausam ein Tod fern der Heimat wäre. Er teilt hier die gleiche Angst, wie sie bereits Tibull äußert (Tib. 1, 3, 3–4):
Me tenet ignotis aegrum Phaeacia terris,
Abstineas avidas, Mors, modo, nigra, manus.
(Mich hält krank in unbekannen Landen Corcyra,
Halte nur, schwarzer Tod, deine gierigen Hände fern).
Auch Ovid fürchtet sich, wie aus Trist. 3, 3, 3–4 hervorgeht, um seine Gesundheit, während er sich fern der Heimat in Tomis befindet:
Aeger in extremis ignoti partibus orbis,
Incertusque meae paene salutis eram.
(Krank in der entlegensten Gegend eines unbekannten Erdkreises
und fast ungewiss bezüglich meines Heils war ich).
In dem Gedicht Io. Baptistae Mantuano phisico (3, 64) rekurriert Boccabella auf Spagnolis Apollon-Gedicht, indem er ihn, den Dichter und Karmeliter, scherzhaft einen Arzt, physicus, nennt, der ihn durch sein Apollon-Gedicht geheilt habe.
Vor diesem Hintergrund ist auch Boccabellas Gedicht Ad quartanam von Bedeutung, in dem er das Quartanfieber schildert, an dem leide (3, 36, 1–4 und 16–18):
Febris pessima, quando te carebo
Totis noxia uiribus meoque
Demens ingenio lyrale plectrum,
Instans pectore sublatenter aegro.
[…]
Infers arctibus anxium sitimque.
In te non Phylarae genus tuetur.
Nostram ne rediens premas salutem!
(Schlimmstes Fieber, wann werde ich dich entbehren,
Du, allen Kräften schädlich, meinem
Verstand das poetische Plektrum wegnehmend,
Verborgen unter der kranken Brust drohend?
[…]
Du bringst den Gliedern Angst und heißes Verlangen.
Gegen dich schützt nicht das Geschlecht der Philyra.
Setze nicht mit deiner Rückkehr meinem Wohlergehen zu!).
Die hier zum Schluss geäußerte Angst um eine Rückkehr des Quartanfiebers ist nicht unbegründet, denn dieses heimtückische Fieber kann nach der Infektion noch fünfzig Jahre lang immer wieder aufbrechen.20 Die gesundheitliche Anfälligkeit, die Boccanalla in seinen Gedichten wiederholt suggeriert, ist aller Wahrscheinlichkeit nach darauf zurückzuführen, dass er an dieser langanhaltenden und unheilbaren Form der Malaria litt. Dieser Umstand rückt Boccabellas Sorge, fern der Heimat zu sterben, in ein realistischeres Licht, fernab bloßer dichterischer Übertreibung. Wie eng die Krankheit, aegritudo, an den Begriff Furcht, timor, gebunden ist, zeigt Cicero, der ebenfalls das Schicksal des Exils erleiden musste, in seinen philosophisch-rhetorischen Schriften auf.21
Boccabella war demnach ein gesundheitlich angegriffener junger Mann, der sich seinen Lebenswandel in Rom zurückwünschte, wie er ihn unter dem großzügigen Mäzen Pietro Riario genossen hatte. Seine Klagen über Bologna bergen einen historischen Kern: Die Ferne von seiner Heimat, seiner Familie (außerhalb Roms lassen sich kaum Spuren der Familie Boccabella nachweisen) und seiner Freunde, gerade jener aus der Römischen Akademie. Genau auf diese fehlende Wärme verweist Boccabella, wenn er seinem Mäzen in dem Gedicht Diuo Francisico Cardinali Mantuano (2, 34, 3–4) schreibt:
Diuidor a patriae longum complexibus urbis.22
Externa iaceo solus et aeger humo.23
(Weit abgeschnitten bin ich von den Umarmungen der heimatlichen Stadt [sc. Rom]
Auf fremdem Boden liege ich allein und krank).
Ihm fehlen die Umarmungen, d.h. die Geborgenheit und der Schutz seitens der Familie und der Freunde. Beides suchte er in Bologna vergeblich, wo er ein hartes Studium zu absolvieren hatte, das ihm nicht gefiel. Hinzu kam das Los einer regelmäßig auftretenden schweren Krankheit, die bewirkte, dass sich Boccabella wie einst Ovid in Tomis oder Tibull auf Corcyra (ob oder inwieweit diese antiken Szenarieren real sind, ist eine andere Frage) gefühlt haben mag: Er fühlte die Angst vor einem Tod in der Ferne, weshalb seine übertriebene Klagewut über das skythische Klima in Bologna und sein Betteln um eine Versetzung nach Rom in ähnlicher Weise und ebenso oft zu vernehmen ist wie die Klagen Ovids in den Tristia und den Epistulae ex Ponto. In diesem Sinne weisen Boccabellas Gedichte ein nicht unerhebliches Maß an autobiographischer Qualität auf, wie sie für humanistische Dichter nicht untypisch ist.24
Wie sehr Boccabella auf eine Versetzung nach Rom hoffte, zeigt zu guter Letzt seine poetische Bitte an Platina, einen guten Freund aus der Römischen Akademie, der unter Papst Sixtus IV. Bibliothekar der Bibliotheca Apostolica Vaticana geworden war (3, 67, 3–6):
Dum potes absentis fortunam tollere amici,
Officium praesta grande piumque tuum!
Viuimus in studio patria procul urbe remoti.
Paene quater campos uidimus Elysios.
(Solange du das Los des abwesenden Freundes beheben kannst,
Gewähre dein großes und väterliches Pflichtbewusstsein!
Wir leben während des Studiums weit entfernt von der väterlichen Stadt,
Viermal haben wir fast die elysischen Gefilde gesehen).
Boccabella bittet hier den einflussreichen Platina um einen Posten an der Kurie, um seinem Schicksal in Bologna zu entgehen und sich dem Einfluss seines Mäzens zu entziehen. Am Ende war Boccabella jedoch wie Ovid genau jenes Los beschieden, das er unter allen Umständen zu vermeiden suchte: Der Epigrammatiker starb 1480 in Bologna, also in der Stadt, die er einerseits mit Hilfe der altbekannten Nord-, Kälte- und Krankheitstopik literarisch zu einem Schreckensort stilisierte und die er andererseits tatsächlich immer dann als Exil empfunden haben dürfte, wenn er von schweren Krankheiten oder der Rückkehr des Quartanfiebers betroffen war. Die so immer wieder neu entfachte Todesangst überwog insgesamt den Schmerz über den von Gonzaga erzwungenen Heimatverlust.