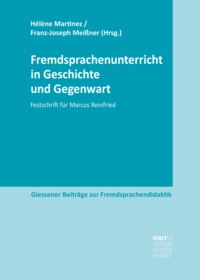Kitabı oku: «Fremdsprachenunterricht in Geschichte und Gegenwart», sayfa 5
Musik im Französischunterricht. Ein historisches Aperçu
Andreas Rauch
1 Einleitung
Das Thema Musik im Französischunterricht erfreut sich seit den 1950er Jahren und besonders seit der ,kommunikativen Wende‘ der 1970er Jahre zunehmender Beliebtheit. Vor 1945, ja vor der neusprachlichen Reformbewegung wurde das Thema bisher kaum beachtet und untersucht (vgl. Rauch 2017, XXVIII-XXIX).
Der vorliegende Beitrag gliedert sich in drei Teile, wobei die neusprachliche Reformbewegung (etwa 1880-1905) im Zentrum der Darstellung steht: Zunächst werden frühe Formen des Musikeinsatzes im Französischunterricht vor der neusprachlichen Reformbewegung untersucht. Im Mittelpunkt des Beitrags steht der Musikeinsatz im Rahmen der neusprachlichen Reformbewegung. Die komplexe Anwendung des Liedeinsatzes durch Integration verschiedener Medien innerhalb der direkten Methode bildet den Abschluss dieses Artikels.
Nach einem Aphorismus des deutschen Philosophen Odo Marquart „Zukunft braucht Herkunft”1 speist sich ein tiefgründiges Verständnis der Gegenwart, also des modernen Französischunterrichts, aus einer profunden Kenntnis und Analyse der historischen Zusammenhänge in ihrer diachronen Evolution. Deshalb soll abschließend mit dem vorliegenden Beitrag auch gezeigt werden, dass heute gängige, verbreitete Konzepte und Unterrichtsformen beim Einsatz von Musik im Französischunterricht keinesfalls Produkte des 21. Jahrhunderts sind, sondern sich bereits in Ansätzen in der über 500-jährigen Geschichte des Fremdsprachenunterrichts manifestieren (vgl. auch Kelly 1969).
2 Frühe Formen des Musikeinsatzes im Französischunterricht
2.1 Die Reformation und der Musikeinsatz im Französischunterricht
Bereits bei Martin Luthers Bildungskonzeption spielt der Musikeinsatz im Unterricht eine zentrale Rolle: Das Singen der Schulchöre diente dem Lob Gottes, und dazu sollten alle Gläubigen angehalten werden, in ihrer Muttersprache mitzusingen. Luthers Bedeutung für das Kirchenlied mündet in die Rolle der Reformation als Singbewegung.1 Er dichtete 36 Kirchenlieder, bei mindestens 20 dieser Lieder stammen die Melodien sicher von ihm selbst. Viele Kirchenlieder von Luther greifen nach dem Prinzip der Kontrafaktur2 vorreformatorische deutsche Lieder, aber auch lateinische Gesänge der katholischen Kirche, wie Hymnen sowie Volks- und Gesellschaftslieder, auf. Hierbei wird das didaktische Konzept ‚Vom Eigenen zum Fremden‘3 angewendet. Da viele (vormals katholische) Choräle und Volkslieder bekannt waren und zum Allgemeingut gehörten, konnte Luther diese erfolgreich verbreiten und für den protestantischen Kirchenchoral nutzen. Ein bekanntes Beispiel ist das Kirchenlied Ein feste Burg ist unser Gott, dessen Text von Martin Luther zwischen 1527 und 1529 geschrieben wurde und bis heute zum Reformationstag in den evangelischen Gemeinden gesungen wird.4 Die Rezeption und musikalische Fortentwicklung des Lutherschen Reformationschorals ist für den zeitgenössischen Französischunterricht sehr interessant. Das Kirchenlied, das fester Bestandteil des evangelischen Gottesdienstes war, ist vermutlich auch zu Tischgebeten in den protestantischen Familien gesungen worden und wurde auch ins Französische übersetzt. Ein Beispiel dafür ist die Interlinearversion des Lutherchorals in einer zweisprachigen Ausgabe von Mömpelgard/Montbéliard 1618 mit dem Titel Gesangbüchlein/Teutsch und Frantzösisch nebeneinander gesetzt (Luther/Foillet 1618, 174 f.). Die Interlinearversion des Mömpelgarder Gesangsbüchleins ist sofern aufschlussreich, da es ein Zeugnis für die Zweisprachigkeit der Enklave ist.
Eine interessante parallele Entwicklung stellt die Evolution der Sprach- und Kulturassimilation der Hugenotten in Preußen dar. Seit 1560 nannte man die Evangelischen reformierten Bekenntnisses huguenots.5 Mit dem Revokationsedikt von Fontainebleau 1685 durch Ludwig XIV. wurde das Edikt von Nantes aufgehoben und das reformierte Bekenntnis verboten. Dies löste einen Exodus der Glaubensflüchtlinge aus. Dabei kam die Aufnahme der Hugenotten in Preußen der „fürstlichen Einwanderungs-, Wirtschafts- und Peuplierungspolitik entgegen, die darauf gerichtet war, die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges zu überwinden und das kulturelle und wirtschaftliche West-Ost-Gefälle in Europa auszugleichen“ (Kuhfuß 2014, 302). Kuhfuß (ebd.) schreibt, dass sich 1672 die ersten Hugenotten in Berlin niederließen; 1688 erhielten sie Versammlungsfreiheit in den Kirchen der Stadt und ab 1700 verfügten sie über eine eigene Kirche. Die Hugenottenprivilegien umfassten wirtschaftliche und kulturelle Vorrechte (ebd., 304). Das Französische wurde besonders gepflegt und zur offiziellen Sprache in den Domänen Kirche, Familie sowie Schule.
Noch vor dem Aufbau eines Elementarschulwesens erhielten die Hugenotten mit dem Collège royal françois 1689 ein erstes eigenes Gymnasium, wobei der Unterricht auf Französisch stattfand (vgl. Roosen 2008, 190). Die weltoffene, frankophile Politik Friedrichs II. favorisierte französische reformierte Glaubensflüchtlinge als Lehrer und Erzieher (vgl. Kuhfuß 2014, 308).6 Der Psalm galt für die Reformierten als gesungenes Gebet und der Hugenottenpsalter als wichtiger Bestandteil hugenottischer Frömmigkeit. Die Psalmen wurden seit dem 16. Jahrhundert auch im Unterricht gesungen. Noch im Jahr 1783 hatte das Berliner Konsistorium im Bereich des Liedgutes und Psalmengesangs eine Neuauflage der vom hugenottischen Pastor Hauchecorne7 herausgegebenen Psalmensammlung beschlossen (vgl. Böhm 2010, 223).
2.2 Grundlegende Reformideen der Dessauer Philanthropen und die Auswirkung auf den Musikeinsatz im Unterricht
Hauchecorne spielt nicht nur eine wichtige Rolle als Theologe, sondern auch als Pädagoge und Erzieher. Er kann als einer der „umtriebigsten Pädagogen der französischen Kolonie“ bezeichnet werden (Böhm 2011, 304). Unter seinen Schülern soll auch Heinrich von Kleist gewesen sein (vgl. Hauchecorne 1820, 5 ff.). Seine Lehrbücher zeigen bereits realienkundliche Inhalte (vgl. dazu Kuhfuß 2014, 443), die später in Kerschensteiners Arbeitsschule und der Waldorfpädagogik Anwendung finden.
Außerdem wird Hauchecornes Nähe zu den Philanthropen deutlich. Die Bewegung wurde von Johann Bernard Basedow initiiert, den Hauchecorne in Dessau persönlich kennen lernte. Basedow hatte dort 1774 das berühmte Philanthropin gegründet, eine „Werkstätte der Menschenfreundschaft“ (Reinfried 1992, 56). Es handelt sich um eine Versuchsschule mit Internat, deren Entwicklung von der an pädagogischen Reformen interessierten Öffentlichkeit verfolgt wurde. Nach Basedows Vorbild errichtete der Schulreformer Friedrich Eberhard von Rochow auf seinem Gut Reckhan eine Musterschule.
Ein bisher noch wenig berücksichtigter Aspekt ist Rochows Wertschätzung des Singens als Teil der Elementarbildung. Auch die Mädchenbildung wurde gefördert. 1776, also zwei Jahre nach Eröffnung des Basedowschen Philantropins und von Hauchecornes Pensionatsschule erscheint von Rochows Kinderfreund (vgl. Rochow 1776). Schon im Titel wird die Rousseausche Konzeption des Autors deutlich. Hauchecorne überträgt das pädagogische Werk zusammen mit dem hugenottischen Pfarrer Samuel Henri Catel ins Französische. Es erscheint 1778 in Berlin in der französischen Kolonie bei Starcke unter dem Titel L’Ami des enfans à l’usage des écoles in zwei Bänden. Hauchecorne verweist darauf, dass Rochows Lehrbuch sowohl im Muttersprach- als auch Fremdsprachenunterricht angewendet werden kann. Deshalb empfiehlt er auch kontrastive intertextuelle und interkulturelle Vergleiche, bei denen sich die Schüler individuell korrigieren können. Der zweite Band enthält nachgestellte Unterrichtssequenzen mit Bezügen zu entsprechenden Bibelstellen. In einige Parabeln wurden Kirchenlieder eingebettet, bei denen komplexe soziale und moralisch-ethische Zusammenhänge kindgemäß nahegebracht werden sollen.
2.3 Musikalische Elemente in Salons, Konversationszirkeln und Damenorden
Das Französische wurde in Deutschland in der Mitte des 17. Jahrhunderts zur „mit großem Abstand wichtigsten neueren Fremdsprache – eine Position, die es zweieinhalb Jahrhunderte lang halten sollte“ (Reinfried 2016, 620). Die französische Sprache nahm eine wichtige Stellung als langue véhiculaire des europäischen Adels ein und fungierte am kursächsischen Hof in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts als lingua franca der Aristokratie.
Koldau (2005, 297 f.) und Kuhfuß (2014, 90) berichten über frankophile Damenkränzchen am anhaltinischen Hof von Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen. Am Hof wurde die Bildung in verschiedenen europäischen Sprachen durch französische Konversation und die Lektüre französischsprachiger Literatur gepflegt, wozu ‚Damenorden‘ gegründet wurden. Als Gegenentwurf zur männlich dominierten Fruchtbringenden Gesellschaft erfolgte am 21.10.1617 die Gegengründung der frankophilen Noble Académie des Loyales (Dünnhaupt 1983, 384 ff.) durch Fürstin Anna von Anhalt-Bernburg, die Schwägerin von Fürst Ludwig I. Es handelt sich um eine geheimgehaltene Gesellschaft, die exklusiv Frauen und Angehörigen von Adelsfamilien vorbehalten war. „Die adligen Damen sangen in gemeinsamer Runde auch gerne französische Lieder“, stellt Kuhfuß (2014, 90) fest.
2.4 Musikeinsatz in Französischlehrwerken und Grammatiken für weibliche Lernende
Die Kultur der exklusiv weiblichen Sprachzirkel erlebte einen Höhepunkt mit Französischlehrwerken für weibliche Lernende. Mädchen und Frauen lernten im 16. Jahrhundert meist Französisch und Italienisch. Sie beherrschten kein Latein, während die jungen Männer in Latein als erster Fremdsprache unterrichtet wurden (Kuhfuß 2014, 188). Das Zitat verweist auf zwei ausgebildete Hauptrichtungen des Fremdsprachenunterrichts, die von Marcus Reinfried (2016, 621) folgendermaßen beschrieben werden:
Eine hauptsächlich vom traditionellen Lateinunterricht inspirierte deduktive Richtung (vgl. Streuber 1914: 20 ff.). Sie begann mit dem Auswendiglernen von (in Deutschland während des 17. Jhs. auch noch in vielen Grammatiken neuerer Sprachen lateinisch formulierten) Grammatikregeln und den dazu gehörigen zielsprachlichen Beispielsätzen. Zur Textlektüre kam es bei diesem Unterrichtsverfahren erst in einem fortgeschrittenen Stadium.
Eine eher imitative Richtung, die keine zuvor erworbenen Lateinkenntnisse voraussetzte und entweder mit verschriftlichten Dialogen oder einfacheren zielsprachlichen Texten begann. [...] Diese Richtung setzte Grammatik im Anfangsunterricht nur sehr reduziert ein.
In dieser imitativen, auf die Sprachpraxis hin orientierten Perspektive wurde eine Vielzahl von Lehrwerken speziell für Lateinunkundige konzipiert. Mit den Grammaires des Dames entstand damit ein neuartiges Genre von Lehrmaterialien (vgl. Beck-Busse 2014, 249). Der Stoff wird darin auf ,angenehme Weise‘, also ,unakademisch‘ vermittelt und eignet sich für das Selbststudium. Die Eigenschaften der utilitaristischen Verwendung des Lernstoffs und der Fokussierung auf die praktische, konkrete Anwendung und Realisierbarkeit des Lernziels für das nicht gelehrte, also lateinunkundige Publikum zeigen die Linie zur späteren Entwicklung der Realienbildung und der vor allem auf praktische Sprachfertigkeiten ausgerichteten Realschule auf. Die Grammaires des Dames sind also funktionale Gebrauchsgrammatiken (vgl. Polzin-Haumann 2001, 131 ff.).1 Die lernunterstützende Rolle der Musik im Grammatikunterricht wird illustriert auf der Frontispizseite2 von La Grammaire en vaudevilles, ou lettres à Caroline (Simmonin 1806, Abb. 1). Die hier beschriebene Szene bezieht sich auf Barthélémys Motto: „Il est agréable d’apprendre sa langue en chantant.“ (Barthélémy 1788, Préface, xi). Es werden drei junge Damen dargestellt, die anhand von Gesang die Grammatik wiederholen: in der Mitte des Bildes spielt eine junge Dame die Laute, rechts lehnt sich eine junge Dame mit verschränkten Armen an die Lautenspielerin und hört ihr andächtig zu, während die links gegenüber sitzende junge Dame die Hände wie eine Dirigentin im Takt der Melodie wiegt. Als Subtext steht unter der Abbildung: „Elles répètent leur grammaire en s’accompagnant de la guitare“ (ebd., Frontispiz). Diese Szene illustriert zwei interessante Aspekte zum Liedeinsatz: einerseits handelt es sich erstmalig um eine inhärente didaktische Funktion der Musik, andererseits wird mit dem Wiederholen und Nachahmen im Sinne der imitativen Richtung die zunehmende Bedeutung der Artikulation und Aussprache deutlich.
3 Der Musikeinsatz im Französischunterricht im Rahmen der neusprachlichen Reformbewegung
3.1 Viëtors Trompetenstoß und das Vordringen von Sprech- und Gesangstechniken im Rahmen der neusprachlichen Reformbewegung
Der Einsatz von musischen Elementen im Französischunterricht wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts zugunsten der Grammatik-Übersetzungs-Methode weitgehend zurückgedrängt, wobei die zentrale Bedeutung der Grammatik durch die formale Bildungstheorie gerechtfertigt wurde (vgl. Reinfried 1992, 91 f.). Parallel dazu etablierte sich im Gegensatz zum holistischen Einsprachigkeitsprinzip bei den Philanthropen (vgl. Reinfried 1990) und den Grammaires des Dames1 eine konsequente Zweisprachigkeit. Das zeigte sich im zeitgenössischen Französischunterricht darin, dass hauptsächlich übersetzt wurde. Marcus Reinfried fasst dieses Spannungsfeld folgendermaßen zusammen: Das methodische Spektrum zwischen der kognitiven Durchdringung der Zielsprache und der ganzheitlichen Sprachpräsentation konstituierte sich nun in einer neuen Weise: Die synthetische Grammatik-Übersetzungs-Methode, die es bereits in vorangegangenen Jahrhunderten gegeben hatte, bildete nach wie vor (in verbesserter Form) den einen Eckpfeiler des Spektrums. Die sogenannte ,analytische Methode‘, eine streng wörtliche Übersetzungsmethode, bildete nun den neuen Eckpfeiler; sie steht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland für den ganzheitlichen Pol beim schulischen Fremdsprachenlernen (vgl. Reinfried 2007, 263).
 Abb. 1:
Abb. 1:
Antoine-Jean-Baptiste Simmonin (1806): La Grammaire en vaudevilles, ou lettres à Caroline sur la grammaire française. Paris: Barba An XIV, Frontispiz.
Viëtors 1882 unter dem Pseudonym Quo usque tandem2 erschienene Streitschrift Der Sprachunterricht muß umkehren (Viëtor 1886) stellt einen Paradigmenwechsel dar, der als „début de la Querelle des Anciens et des Modernes en didactique des langues“ (Reinfried 1997, 184) für den modernen Fremdsprachenunterricht in die Geschichte eingegangen ist. Viëtors Pamphlet ist von Breymann als „Trompetenstoß der Reform“3 bezeichnet worden. Die Schrift „setzte Signale, wie sie in der Fremdsprachendidaktik seither wohl nie wieder von einer Publikation im Umfang eines Zeitschriftenaufsatzes gesetzt worden sind“ (Schröder 1984, 6); „30 Jahre vor Saussures Cours de linguistique générale rückt Quo usque tandem damit das Sprechen ins Zentrum des Interesses“ (ebd., 27). Moritz Trautmann konstatierte bereits 1878 in einem Aufsatz: „[...] die aussprache des englischen und französischen, welche bis jetzt in der grossen mehrzahl unserer schulen gehört wird, ist wahrhaft grauenvoll“ (Trautmann 1878, 598).
Trautmann nahm die Parallele von Sprache und Musik auf und erklärt die Lautphysiologie der Vokale anhand von Noten:
Die vokale sind eigentümlich gefärbte töne unserer Stimme. Die eigentümliche färbung wird dadurch erzeugt, dass wir bei hervorbringung der verschiedenen vokale unserer mund- und rachenhöhle verschiedene anordnungen geben. [...] Die verschiedenen mundstellungen dienen dazu, die mundhöhle auf verschiedene resonanzen abzustimmen. [...] Die resonanzen der mundhöhle haben den zweck, sich mit den tönen der stimme zu verbinden und auf diese weise vokale zu erzeugen. (ebd., 587 f.)
Der Phonetiker, Dialektologe und Vater der experimentalen Phonetik Jean-Pierre Rousselot kreiert ebenfalls eine Analogie zwischen Sprache und Musik, zwischen maître de langue und maître de piano (vgl. Aubin 2008, 105): „Le maître lui [à l’élève, A. R.] met le doigt sur la touche qui correspond à la note demandée. Pourquoi le maître de langue ne ferait-il pas de même?“ (Galazzi 1993, 74).
Zur Veranschaulichung der Lautbildung und zur Einübung der Laute entwickelten die Französischdidaktiker zahlreiche Erklärungsmodelle. So läßt der Didaktiker Max Walter, um
den Unterschied stimmhaften und stimmlosen Lauten durch besondere Merkzeichen hervorzuheben, [...] die Schüler einen Finger an den Kehlkopf legen und sie dann die verschiedenen Laute wiederholen. Hierbei fanden sie selbst heraus, dass sie bei den ersten Lauten ein Erzittern des Kehlkopfs gemerkt hätten, bei letzteren nicht. (Walter 1887, 10)
Max Walter (1931, 7 f.) erweitert diesen kontrastiven Vergleich, indem er die Schüler in einer Simulation selbst erkennen läßt, dass man stimmlose Laute nicht singen kann. Walter zitiert u. a. das Beispiel des stimmhaften alveolaren Frikativs [z] am Beispiel des Geräuschs einer großen Schmeißfliege und beschreibt die sich anschließende Artikulationsgymnastik im Französischunterricht. Der Reformer Herrmann Klinghardt setzt bei der Artikulationsgymnastik kleine Taschenspiegel ein, die er in seiner Klasse verteilt und so eine sofortige, bessere Kontrolle der Artikulation seiner Schüler ermöglicht.
3.2 Systematische Lauteinführung und -einübung mit Hilfe von Liedern
In der zeitgenössischen fachdidaktischen Literatur gab es eine Vielzahl methodischer Ansätze zu Ausspracheübungen, wobei besonders auf das musikalische Gehör verwiesen wird. Die Beispiele des Durakkords von Viëtor und Trautmann haben gezeigt, dass die Phonetiker der Musikalität der Sprache eine besondere Bedeutung zuschreiben und die neusprachliche Reformbewegung meiner Auffassung nach auch als „musikalische Reform“ bezeichnet werden kann:
Beim Klassenunterricht kann man – die beste Befähigung des Lehrers vorausgesetzt – nur mit denjenigen Schülern etwas Vortreffliches in der Aussprache leisten, welche ein feinfühlendes musikalisch empfängliches und empfindliches Ohr haben. Dieses Laut-recipierende Organ ist überhaupt viel wichtiger als die Laut-producierenden Organe und doch ist von dem Ohre und dessen Schulung bei den Phonetikern kaum die Rede. (Seitz 1889, 222 f.)
Marcus Reinfried unterscheidet hierbei „deux approches: une approche atomiste et une approche globaliste“ (Reinfried 1997, 190 f.), die „dans la pratique, pouvaient se succéder à l’intérieur d’une seule unité d’enseignement“ (ebd., 190). Reinfried definiert beide Ansätze wie folgt: „L’approche atomiste se basait sur la communication de sons isolés ou de mots qui servaient de modèles articulatoires. [...]. L’approche globaliste par contre partait d’un texte entier“ (ebd., 190 f.).
Typisch für den Beginn der neusprachlichen Reformbewegung war vor allem im Anfangsunterricht des Französischen die approche atomiste mit der Ausspracheschulung und Übung isolierter Laute. Im Rahmen des Phonetischen Vorkurses wurden in vielen Lehrwerken der neusprachlichen Reformbewegung die Sprechwerkzeuge in einem Schaubild abgedruckt (vgl. Engelke/Meyer 1929, 1).1 Karl Quiehl und Max Walter2 entwickeln dabei das Lautschema im Lehrer-Schüler-Gespräch an der Wandtafel und weisen „an der Lauttafel auf das Zeichen des Lautes“ (Quiehl 1887, 36) hin. Nach dem Vor- und Nachsprechen der Laute nutzen Engelke/Meyer zur Festigung und zum Einschleifen der vier Nasalvokale [œ̃], [ɔ̃], [ɛ̃], [ã] (Engelke/Meyer 1929, 2 f.)3 den C-Dur-Akkord ‚c-e-g-c‘ und kommentieren „On apprend mieux les voyelles nasales en chantant“ (ebd., 2 f.).4 Hierbei werden die vier Nasalvokale als isolierte Laute einzeln gesungen und schließlich im Refrain des bekannten Kanons Frère Jacques den Noten zugeordnet. Anhand von Karl Quiehls Veröffentlichungen lässt sich die Entwicklung der approche atomiste anhand des prototypischen Uhlandschen Volkslieds „Ich hatt’ einen Kameraden“ exemplarisch nachvollziehen. Fünf Jahre nach Viëtors „Trompetenstoß“ skizziert Quiehl auf dem Zweiten Allgemeinen Deutschen Neuphilologentag 1887 in Frankfurt am Main (vgl. Quiehl 1887, 33 ff.) erstmals nach einer Zusammenfassung der Vorzüge des Liedeinsatzes im französischen Anfangsunterricht den Einsatz der französischen Kontrafakturversion „J’avais un camarade“ zur Lautschulung und Festigung:
Als erstes zusammenhängendes Stück wähle ich ein Gedicht; ein solches prägt sich vermöge der gebundenen Form und des Reims besonders gut ein. Da die genaue Wiedergabe der Einzellaute zunächst die Hauptsache ist,5 so wird ein Lied singend geübt. Beim Gesange werden die Laute länger gehalten, was besonders den Nasalvokalen zu gute kommt. (Quiehl 1887, 37)