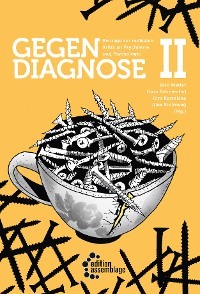Kitabı oku: «Gegendiagnose II», sayfa 2
Von Deutungskämpfen und dem Entstehen der ›Helfenden-Profession‹
Im 17. Jahrhundert wurde der ›Wahnsinn‹ noch als eine von Gott gegebene Krankheit zur Bestrafung für Fehlverhalten gesehen (vgl. Foucault 1973: S. 22). Zu diesem Zeitpunkt wurde dem Gedanken einer ›Heilung‹ der Person noch kaum eine Bedeutung zugesprochen. Stattdessen war es das vorrangige Ziel eine Isolation der Personen von der Gesellschaft zu erreichen (vgl. ebd.: S. 25 ff.). Im Laufe der Zeit machte die gesellschaftliche Bedeutung des ›Wahnsinn‹ verschiedene Veränderungen durch, welche stets von einer gewissen Doppeldeutigkeit geprägt waren (vgl. ebd.: S. 31).
Auf der einen Seite existierte durch die Assoziation von Freiheit und einem kritischen Bewusstsein eine fast schon romantische Vorstellung von ›Wahnsinn‹ (vgl. ebd.: S. 31, S. 48). Demgegenüber stand die Interpretation von ›Wahnsinn‹ als Symbol für gesellschaftliches Chaos und Weltschmerz (vgl. ebd.: S. 40 ff.). Die Deutungshoheit der Kirche wirkte dahingehend auf diesen Diskurs ein, dass ein eher abstraktes Verständnis von ›Wahnsinn‹ als gesellschaftlicher Zustand oder gesellschaftliche Bedrohung abgelöst wurde. Stattdessen setzte sich das kirchliche Erklärungsmodell durch, in welchem das ›wahnsinnige Verhalten‹ auf einzelne Menschen projiziert wurde, welche vom Satan gelenkt oder von Gott bestraft worden wären (vgl. ebd.: S. 48).
Die Sichtweise, dass sich die Ursachen von Verhaltensweisen in dem Menschen selbst verorten lassen würden, wurde durch das Aufkommen der Industrialisierung und der Psychopathologie als medizinisch-biologische Disziplin im 18. und 19. Jahrhundert deutlich verstärkt. Ein nicht zu unterschätzender Einflussfaktor dafür, lässt sich in dem neu entstandenen Arbeitsethos während der Industrialisierung sehen. Bestandteil von diesem war eine Verbindung von Arbeit mit ethischen Werten, wodurch Armut nicht mehr als ein Mangel an Waren oder bezahlter Arbeit gesehen wurde. Stattdessen wurde er durch ein Nachlassen von Disziplin erklärt (vgl. ebd.: S. 92). Dabei entstand eine Trennung in die sogenannten ›würdigen Armen‹, die aufgrund einer Beeinträchtigung nicht arbeiten konnten, und die sogenannten ›unwürdigen Armen‹, von denen angenommen wurde, dass sie nicht arbeiten wollten (vgl. Dörner 2001: S. 20). Galten die Gründe für die nicht geleistete Arbeit als nicht nachvollziehbar, wurden die Menschen zu den unwürdigen Armen gezählt und hatten mit einer Verbannung in die Arbeitshäuser zwecks Umerziehung durch Zwangsarbeit zu rechnen.
Die Industrialisierung zeigte jedoch noch weitere Effekte: Wurde in der vormodernen Gesellschaft die Pflege- und Fürsorgearbeit ebenso wie die (Re-) Produktionsarbeit meistens innerhalb der Haus- und Hofgemeinschaften erledigt, entstand durch die Einrichtung von Produktionshäusern wie Fabriken, Werkstätten und Büros eine räumliche Trennung von Arbeitsbereichen (vgl. ebd.: S. 22). Durch diese Aufspaltung kam es sowohl zu einer Verstärkung der Geschlechterungleichheit, da meistens Frauen in den häuslichen, unbezahlten Bereich der Reproduktion verbannt wurden, als auch dazu, dass zum ersten Mal eine breite Diskussion in Europa entstand, was mit denen geschehen soll, die für den Markt als zu ›leistungsschwach‹ oder zu ›störend‹ galten (vgl. ebd.: S. 23). Diese Diskussion beeinflusste die Entstehung von ›Sozialen Institutionen‹, in denen sich nun ›Professionelle‹ als Lohnarbeiter_Innen um die »Erziehung, Therapie, Verpflegung, Versorgung [und] Verwaltung« (ebd.: S. 24.) von Betroffenen kümmern sollten. So entwickelte sich mehr und mehr die Überzeugung, dass nur ›Professionelle‹ in der Lage wären, Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen (vgl. ebd.: S. 27)6.
Beeinflusst durch die Aufklärung und den immensen technischen Fortschritt dieser Zeit, erreichte die Naturwissenschaft und mit ihr die Psychopathologie als ›objektive‹ und ›rationale‹ Wissenschaft einen gottähnlichen Status (vgl. Harms 2011: S. 89).
Dabei beinhalteten psychopathologische Denkmodelle das Bild eines durch seine Biologie und die Genetik festgelegten Menschen (vgl.: ebd.). Es wurde somit davon ausgegangen, dass die Psychopathologie in einer direkten Beziehung zu einem natürlichen Menschen stehen würde und an diesen den Maßstab für ›Normalität‹ anlegen könnte (vgl. Foucault: S. 126). Diese Form der Pathologisierung von Verhalten führte dazu, dass als wahnsinnig klassifizierte Personen zu den sog. ›würdigen Armen‹ gezählt wurden (vgl. ebd.: S. 128), was zum einen dazu führte, dass sie gesellschaftlich als ›hilfebedürftig‹ eingestuft wurden, zum anderen jedoch den Effekt hatte, dass ihnen ihre Selbstbestimmung und -verantwortung verweigert wurde. Da schon zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich weiße7, gesunde, heterosexuelle, akademische Männer den Wissenschaftsbetrieb bestimmten und dadurch festlegten, was ›Natürlichkeit‹ bedeutete, wurde der Maßstab der ›psychischen Normalität‹ auf deren Sichtweise und Lesarten festgelegt. Dieses Erbe zieht sich bis heute durch (vgl. Haraway 1988: S. 581 ff.). Sollte nun eine Person sich also für Verhaltensweisen entscheiden, die zu weit von dem ›normalen‹ Raster eines weißen, gesunden, heterosexuellen, akademischen Mannes abweichen, müsse dies somit an dessen ›kranker‹ Natur liegen.
Vernichtung im Namen der ›Volksreinheit‹ – Der deutsche Sonderweg
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts spitze sich die Diskussion um die sogenannte ›soziale Frage‹ zu. Die Vorstellung eines biologisch determinierten Menschen in Kombination mit einem moralisch aufgeladenen Arbeitsethos und dem Konkurrenz- und Verwertungsgedanken des Kapitalismus führten dazu, dass über alle politischen Spektren und Länder hinweg die Frage diskutiert wurde, ob ›nicht wirtschaftlich Verwertbare‹ eher zwangssterilisiert oder vernichtet gehörten (vgl. Klee 2009: S. 25 ff.). Dabei ist es erwähnenswert, dass, trotz des weltweit stattfindenden Diskurses, die Deutschen als einzige sich dazu entschieden, im Namen der Wirtschaftlichkeit und Reinheit des ›Volkskörpers‹ die systematische Vernichtung all jener durchzuführen, die ihrem Traum eines ›arischen‹ und effizienten Volkes entgegen standen: Im Sommer 1939 verfasste Adolf Hitler ein formloses Ermächtigungsschreiben und die Deutschen setzten, geleitet von der herrschenden Ideologie, die Euthanasie in ihrer Vernichtungsmaschinerie um (vgl. Dießelhorst 1989: S. 120 f.). Zwar endete mit dem Sieg der Alliierten auch der sozialdarwinistische Vernichtungsfeldzug der Deutschen, jedoch kamen die für die ›Euthanasie‹ verantwortlichen Ärzt_Innen, Psycholog_Innen und Richter_Innen größtenteils straflos davon und konnten – teils nach kurzen ›Arbeitspausen‹ – wieder ihrer Arbeit nachgehen (vgl. Drecktrah 2008: S. 282; Hechler 2015: 143 ff.). Dies zeigte sich unter anderem auch in der Kontinuität der naturalisierenden Ideologie, welche es erlaubte, die ›Behandlung‹ von ›psychischen Krankheiten‹ weiterhin in dem Aufgabenbereich der Medizin und Psychiatrie zu verorten (vgl. Szasz 1972: S. 57).
Die ›alte‹ Psychiatriekritik in den 1960er & -70er Jahren
Während in den USA und Großbritannien schon in den Anfängen der 1950er Jahre die menschenverachtenden Verhältnisse in den Psychiatrien aufgedeckt wurden (vgl. u.a. Goffman: 1972), dauerte es in der BRD erheblich länger, bis sich mit den Verhältnissen in den Anstalten auseinandergesetzt wurde (vgl. Häfner 2003: S. 122). Dies war nicht zuletzt ein Resultat aus der »Verdrängung oder Verleugnung der Massentötung« (ebd.: S. 123) Psychiatrisierter während der NS-Zeit. Wie beschrieben, verblieb die Mehrzahl der an den sogenannten ›Krankenmorden‹ beteiligten Deutschen in ihren Ämtern (vgl. ebd.: S. 123). Daher verwundert es kaum, dass auch in den Jahren nach dem Krieg Einweisungen noch offen als eine »probate Lösung, [um] die Störung des Verwaltungsgeschäfts zu beheben« (Coché 2017: S. 81) genutzt wurde. Internationale Kritik an den Zuständen in Psychiatrien fand erst im Zuge der ›alten‹ psychiatriekritischen Bewegung Gehör in der Öffentlichkeit. Dabei schaffte es jedoch vor allem der menschenverachtende Zustand und Umgang mit den ›Patient_Innen‹ in das öffentliche Bewusstsein. Besonders die Kritik, dass Psychiatrien – genau wie andere totale Institutionen – hauptsächlich den Zweck verfolgten, »den Charakter von Menschen zu verändern« (vgl. Goffman 1972: S. 23) und sie damit auf einer Stufe mit Gefängnissen, Konzentrationslagern und Klöstern zu sehen seien, erlangte Aufmerksamkeit. Im Zuge einer Reihe von Studien, die erstmals die Sichtweise der Betroffenen und nicht der Psychiater_Innen in den Fokus rückten (vgl. ebd.: S. 8), wurde deutlich, was das geltende psychiatrische Paradigma mit den Betroffenen machte. Menschen, welche in allen Lebensbereichen systematisch durch dieselbe Instanz verwaltet, beobachtet, versorgt, erzogen und behandelt werden, laufen Gefahr eine »Diskulturation« (ebd.: S. 24) zu erleben. Dies bedeutet, dass ein »Verlern-Prozeß« (ebd.) von Verhaltensmustern einsetzt, der bis hin zu einem Identitätsverlust reichen kann (vgl. ebd.: S. 54). Eine totale Institution nutzt diese Dynamik »als strategischen Hebel zur Menschenführung« (ebd.: S. 25). Im Falle der Psychiatrie wäre das Ziel der Menschenführung somit die Anpassung der Betroffenen an das Verständnis der Psychiater_Innen von ›Normalität‹. Wobei die zu dieser angestrebten Normalisierung genutzten Techniken Menschen teils endgültig das selbstständige Zusammenleben in einer bürgerlichen Gesellschaft verlernen ließen.
Andere Kritiken griffen noch tiefer das psychologisch-psychiatrische Verständnis an und negierten grundsätzlich den Glauben an die Existenz von ›psychischen Krankheiten‹. Dabei lehnten sie eine individualisierende Sichtweise auf Verhalten ab und setzten es stattdessen in einen Zusammenhang mit familiären Strukturen und gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen (vgl. u.a. Cooper 1976: S. 90 ff.; Rittmeyer 1988: S. 29; Szasz 1972: S. 21). So kämen zum Beispiel Widersprüche, welche sich innerhalb eines familiären Systems finden, in dem Verhalten einzelner Personen zum Ausdruck (vgl. Cooper 1972: S. 36 ff.). Zum Schutz des Systems Familie*8 sei es nun notwendig, dass die betroffene Person sich entweder den Widersprüchen innerhalb der Familie* unterwirft, oder das System verlässt (vgl. ebd.: S. 33 f.). Teilweise komme es so dazu, dass die Betroffenen ihre zugeschriebene Rolle als die_der ›psychisch Kranke_n‹ annehmen und ihr System in ›akzeptabler‹ Form verlassen, mit der Hoffnung nach vollendeter ›Heilung‹ wiederkehren zu dürfen (vgl. ebd.: S. 46 f.). Durch die Abhängigkeit einer Person zu ihren direkten Bezugspersonen – dies ist gerade bei Kindern, welche in besonderer Abhängigkeit zu ihrer Familie* stehen, der Fall – könne es aufgrund widersprüchlicher Erwartungen an die Person zu einer Entfremdung der eigenen Person von sich selbst kommen. Dies könne dazu führen, dass der Mensch sich als fremdgesteuert wahrnimmt (vgl. ebd.: S. 50). Dabei sei es wichtig zu betrachten, wann welche Erklärungsmodelle oder Weltanschauungen als ›psychotisch‹ mystifiziert werden und warum z. B. antisemitische, rassistische und sexistische Überzeugungen als vielleicht verachtenswerte, jedoch trotzdem ›gesunde‹ Überzeugungen zu sehen seien (vgl. Cooper 1976: S. 53).
Nicht nachvollziehbares menschliches Verhalten ließe sich nach diesem Erklärungsansatz somit eher als eine »Sonderform von Kommunikation« (Szasz 1972: S. 26) sehen und es dürfe nicht darum gehen, mechanisch nach Ursachen zu forschen, sondern zu betrachten, wie diese Sprache »gelernt wurde und was sie bedeuten soll« (ebd.: Herv. i.O.). Durch ein solches Verständnis wird hervorgehoben, dass das Verhalten von Menschen letztendlich ein Produkt der sozialen Umgebung ist (vgl. ebd.: S. 28). Würde diese Sichtweise ignoriert, führe es schnell zu einer Stigmatisierung von Menschen als ›psychisch Kranke‹, was meist mit einer Absprache der (Selbst-)Verantwortung und Abnahme dieser einhergehe (vgl. ebd.).
Während die meisten Psychiatriekritiker aus einer rein ›männlichen‹ Perspektive heraus auf Verhalten schauen, zeigt Phillis Chesler von einer feministischen Analyse ausgehend auf, wie stark der Komplex Psychiatrie von einer patriarchalen Logik durchzogen ist und somit Frauen*9 in einer spezifischen Weise bedroht sind (vgl. Chesler 1977: S. 65 ff.). Nicht nur die Person des männlichen Psychiaters stelle hierbei eine spezifische Gefährdung dar, sondern ebenfalls die klinische Ideologie, die selbst einer patriarchalen Deutungshoheit unterliegt (vgl. ebd.). ›Professionelle von Beruf‹ würden von Beginn an darin geschult, jegliche Verhaltensweisen zu pathologisieren (vgl. ebd.). Diese durchgängig stattfindende Pathologisierung erfolge jedoch bei Frauen* und Männern nach unterschiedlichen Maßstäben (vgl. ebd.: S. 67). Studien zeigten, dass die Vorstellung der Psychiatrie von den Eigenschaften eines gesunden erwachsenen Mannes und denen eines gesunden Erwachsenen im generellen quasi identisch waren, und somit die allgemeine Vorstellung von gesund mit der spezifisch männlichen Vorstellung von gesund gleichgesetzt wird (vgl. ebd.). Eine andere Studie zeigte, dass die mit der männlichen Gesundheit einhergehenden Eigenschaften jene sind, welche als gesellschaftlich erwünscht gelten (vgl. ebd.: S. 68). Die Vorstellung über die Gesundheit einer Frau* unterschied sich jedoch signifikant von denen der beiden übrigen Kategorien und basierten auf Eigenschaften wie Unterordnung, Abhängigkeit, Beeinflussbarkeit, »weniger dem Konkurrenzkampf zugeneigt, leichter erregbar bei kleineren Krisen, […] emotionaler [und] eitler […]« (ebd.: S. 68). Daraus lässt sich folgern, »daß sich eine Frau, um als gesund zu gelten, an die Verhaltensnormen für ihr Geschlecht ›anpassen‹ und diese akzeptieren muß, obwohl diese Verhaltensweisen im allgemeinen als weniger gesellschaftlich erwünscht angesehen werden« (ebd.: S. 68). Hielten Frauen jedoch an ›männlichen‹ (oder geschlechtsunspezifischen) Verhaltensweisen fest, würden sie Gefahr laufen in psychiatrische Heilanstalten gebracht zu werden, »bis sie zu ihrer ›Weiblichkeit‹ bekehrt sind« (ebd.: S. 69). Es wird somit deutlich, dass die Normen, die an die ›psychische Gesundheit‹ der Frau* angelegt werden, jene devoten und angepassten Eigenschaften sind, welche die patriarchale Gesellschaft von der Frau erwartet (vgl. ebd.: S. 72).
Im Zuge der beschriebenen Theorien geriet auch die Stigmatisierung durch Diagnosen in das Zentrum der Kritik. Eine Diagnose im Bereich sogenannter ›psychischer Krankheiten‹ stelle letztendlich den Versuch dar, für Außenstehende nicht nachvollziehbares Verhalten durch mechanische Ursache-Wirkungszusammenhänge greifbar und somit ›heilbar‹ zu machen (vgl. ebd.: S. 51). Neben der oben beschriebenen Kritik, dass sich Verhalten aus den komplexen Biographien von Menschen ergäbe und sich somit nicht verallgemeinern ließe, könne eine einmal gestellte Diagnose, zum einen auch dazu führen, dass die Betroffenen sich unbewusst nachträglich die diagnostizierten Verhaltensweisen aneignen. Zum anderen könne auch auf Basis einer gestellten Diagnose Verhalten erst in eine Person hineingelegt werden, beziehungsweise zur ›Findung‹ einer Diagnose erst entdeckt werden. Ferner ließe sich die Diagnostik auch aus einer sehr pragmatischen Sicht heraus kritisieren:
Thomas Szasz beschrieb, dass der erste Schritt einer Diagnose erstmals der Einteilung in zwei verschiedene Klassen bedürfe: Klasse-A (›gesund‹) und nicht-Klasse-A (nicht-gesund) (vgl. ebd). Schon in diesem Schritt ergäben sich mögliche Fehlerquellen, die eine Diagnostik in diesem Bereich unmöglich mache:
1.Die klassifizierende Person verfügt nicht über das nötige Wissen um eine ›richtige‹ Klassifikation durchzuführen (vgl. ebd.).
2.Symptome eines Verhaltens sehen von außen betrachtet aus, wie eine bestimmte Klassifikation, sind aber eigentlich etwas anderes (vgl. ebd.: S. 52).
3.Symptome werden bewusst vorgetäuscht, um eine bestimmte Klassifikation zu erhalten (vgl. ebd.).
Dabei dürfe nicht vergessen werden, dass es bei dieser Form der Klassifikation, um eine Bewertung und Beurteilung von Verhalten durch außenstehende Personen geht. Eine Bewertung ist niemals ›objektiv‹, sondern findet auf Basis von Moral- und Wertvorstellungen statt (vgl. ebd.: S. 56). Klassifikationsmo-delle und Diagnosen entstünden somit immer unter spezifischen historischen und herrschaftsvollen Situationen und wären somit nicht als ein »natürliches‹ Ereignis« (ebd.) misszuverstehen. Somit ergibt sich insgesamt die Frage, warum von der Norm abweichendes Verhalten, überhaupt klassifiziert werden müsse (vgl. ebd.: S. 57) und zum anderen, warum sogenannte ›Professionelle‹ die Definitionsmacht über die Diagnose haben sollten.
Stattdessen wäre es notwendig, Betroffenen mit ihrer subjektiven Sichtweise und ihren eigenen biographischen Erfahrungen und Deutungen die Definitionsmacht über ihren Seins-Zustand zuzugestehen (vgl. Laing 1994: S. 27). Anders als in medizinisch-psychiatrischen Modellen ist es in einem solchen Verständnis von psychosozialen Krisen nicht das Ziel ›wissenschaftlicher‹ oder ›objektiver‹ (ebd.: S. 37) zu sein, sondern sich einem Verständnis über den subjektiven Sinn und Zweck des Verhaltens anzunähern (vgl. ebd.). Aufgabe von Unterstützter_Innen ist es somit nicht, Betroffenen zu erklären, was sie zu tun hätten oder wie sie Dinge zu sehen hätten, sondern den Ausdruck des spezifischen »In-der-Welt-Seins« (ebd.: S. 39) nachzuvollziehen und je nach Wunsch Reflexions- oder Alltagsunterstützung zu bieten.
Exkurs: Kritik an der Naturalisierung menschlichen Verhaltens
Der vorher beschriebene gottähnliche Status der (Natur-)Wissenschaften (vgl. Lewontin et al. 1988: S. 40) zeigte sich auch darin, wie medizinisch-naturalistische Denkmodelle den Diskurs der Unterstützung dominierten und sich dies bis heute noch hält. Der Bezug auf eine angenommene Natur des Menschen wird genutzt, um gesellschaftliche Verhältnisse und individuelles Verhalten zu erklären. In diesem naturalistischen Erklärungsmodell wurde davon ausgegangen, dass sich »so unterschiedliche Phänomene wie die sexuelle Orientierung, psychische Probleme, Erfolg im Leben […] und die Gewalt auf den Straßen« (Rose 2000: S. 295) durch die einzelnen Gene der Individuen erklären ließen. Kritisch lässt sich einwenden, dass eine solche deterministische Betrachtung des Menschen grundlegende Aspekte außen vor lässt. Erstens lässt sich das menschliche Sein nicht alleine durch die biologische Materie begreifen. Der Mensch ist potenziell in der Lage auf seine eigenen Handlungen von außen zu schauen und diese an – in seiner individuellen Biographie erlernten – Werten und Normen zu messen (vgl. Mead 1968: S. 179). Durch diese Form der Selbstreflexion, kann ein Mensch das eigene Verhalten hinterfragen und verändern, zumindest innerhalb eines gesellschaftlich beeinflussten (aber nicht determinierten) und potentiell veränderbaren Möglichkeitsraumes (vgl. Leiprecht 2011: S. 39 f.). Der zweite grundlegende Denkfehler in der medizinisch-naturalistischen Theorie liegt in der Annahme, die menschliche Natur sei unveränderbar (vgl. Rose 2000: S. 9). Dabei sind sowohl die einzelnen Zellen, Körperstrukturen und Moleküle des menschlichen Körpers vergänglich, wodurch der Körper selbst einer sich ständig verändernden Dynamik unterliegt (vgl. ebd.: S. 55), als lebendige Systeme auch »definitionsgemäß offene Systeme« (vgl. ebd.: S. 112) sind und sich zum Überleben den umweltbedingten Schwankungen anpassen müssen (vgl. ebd.: S. 176).
Das naturalistische Erklärungsmodell für das Verhalten von Menschen trägt einen gewissen Doppelcharakter in sich, welcher sich einerseits darin zeigt, dass Betroffene leicht als ›Opfer der eigenen Gene‹ gesehen werden (Rose 2000: S. 21). Damit einher geht sowohl eine Befreiung aus der Verantwortung für das eigene Handeln, als auch das Absprechen des Selbstbestimmungsrechtes über den eigenen Körper, das eigene Verhalten, das eigene Denken und Sein im Generellen. In einer zweiten Erscheinungsform zeigt er sich andererseits darin, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse als Natur gegeben beschrieben und der Mensch als ›Opfer der Umstände‹ betrachtet wird (vgl. Lewontin, Rose & Kamin 1988: S. 40). Dies impliziert die Vorstellung, dass die betroffene Person sich in ihrem Verhalten den Verhältnissen und den damit einhergehenden Erwartungen anzupassen habe. In beiden Fällen wird die Wechselwirkung von gesellschaftlichen Strukturen und Verhältnissen mit den Handlungen und Denkmustern der betroffenen Person ignoriert und das spezifische Verhalten durch eine biochemische Dysfunktion erklärt (vgl. Rose 2000: S. 310).