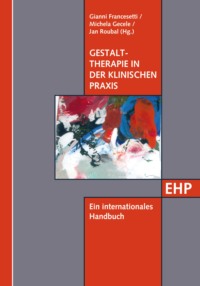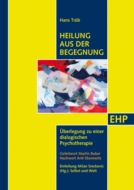Kitabı oku: «Gestalttherapie in der klinischen Praxis», sayfa 15
1.1 Die Situation und die Gestalttherapie
Heutzutage bringen GestalttherapeutInnen »die Situation« in die Gestalttherapie, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Staemmler 2006a; Robine 2011; Staemmler 2011; Wollants 2012). Die Zeit für diese Idee ist gekommen. Meiner Ansicht nach betont die Situation die konkrete existenzielle Dimension der Gestalttherapie.
Wie Jean-Marie Robine ausführt, taucht der Begriff der »Situation« in Perls / Hefferlines und Goodmans Klassiker zur Gestalttherapie viel öfter auf als der Begriff »Feld«. Die Kontaktgrenze kommt im phänomenalen Ganzen der »Situation« vor, so wie der Grund oder Figur/Grund und das Auftauchen des Selbst (Robine 2011). Die Situation ist »eine Portion in der Zeit« als Erfahrungsganzes (vgl. Staemmler 2011), und die Kontaktsequenz im Mittelpunkt unserer Methode ist ein zeitlicher Prozess. Die »Situation« verortet das In-Kontakt-Treten ausdrücklich als zeitlichen Prozess innerhalb des breiter gefassten Begriffs des Feldes.
Vom phänomenologischen und existenziellen Standpunkt aus betrachtet ist die Situation dort,
[…] wo sich die menschliche Existenz primär findet. […] Wem oder was auch immer begegnet wird, wird in einer Situation begegnet. Was auch immer getan wird, es wird aus einer Situation heraus und in Anbetracht weiterer Situationen getan. Die menschliche Existenz ist ihre eigene Situation. (Rombach 1987, 138).
Die Situation hat also die Qualität menschlicher Existenzialität; sie ist Kennzeichen der menschlichen Existenz. Die Situation ist ein erfahrungsbezogener und existenzieller Teil des Feldes. Die situative Ethik ist demnach die Ethik der gestalttherapeutischen Situation – ein erfahrungsbezogenes und existenzielles Phänomen. Diese Situation entsteht aus dem Kontakt und ist gleichzeitig Grundlage für das In-Kontakt-Treten. Sie ist Teil der vorgegebenen Struktur der Lebenswelt, die immer für uns da ist – eine Struktur die für uns präsent ist, verfügbar, wenn wir Gestalttherapie praktizieren. »Ich werde von der Situation gemacht und nehme auch an der Erschaffung der Situation teil. Schon vor jeglichem Entstehen einer Gestalt«, schreibt Robine, »bildet sich bereits eine Situation, die der Grund für die kommenden Gestalten sein wird« (Robine 2011, 110). Für Robine ist es das »Es der Situation« (ebd., 103). Für mich ist es auch die Situation als Lebenswelt.
1.2 Situative Ethik und Ethik des Inhalts
Die situative Ethik ist keine »Ethik des Inhalts«. Die Ethik des Inhalts umfasst moralische, persönliche oder gesellschaftliche Werte, die uns erlauben, dieses oder jenes, »richtig« oder »falsch« zu wählen. Die situative Ethik ist vielmehr unsere unvermeidliche ethische Ausrichtung auf eine Ethik des Inhalts. Sie ist ein Aspekt der vorgegebenen Struktur der Lebenswelt, die erst ermöglicht, dass wir uns einer Ethik des Inhalts bewusst werden. Wir sind ethische Wesen, die sich mit einer Ethik des Inhalts auseinandersetzen, weil die ethische Sensibilität in der Struktur unserer Situation als situative Ethik eingebettet ist.
2. Intrinsische, extrinsische und grundlegende Ethik
Jede medizinische, psychotherapeutische oder pädagogische Theorie basiert auf einer Konzeption der Selbstregulation und der entsprechenden Wertehierarchie. Die Konzeption ist die Realisierung dessen, was der Wissenschaftler tatsächlich als den Hauptfaktor im Leben und in der Gesellschaft betrachtet. (Perls / Hefferline / Goodman 2006, Bd. 1, 88)
Ein klinisches Beispiel.
Eine Sitzung beginnt.
Die Tür der psychotherapeutischen Praxis öffnet sich.
Ein Mensch tritt ein. Die TherapeutIn und der/die Eintretende geben sich die Hand und beide setzen sich.
»Was bringt Sie zu mir?« fragt die TherapeutIn.
Der Mensch sagt: »Ich bin depressiv, traurig, besorgt …«
Dann weint er/sie.
Die PsychotherapeutIn wird sich als Nächstes nach den persönlichen Umständen erkundigen – ohne solche Informationen lässt sich keine Psychotherapie fortsetzen. Was, wenn es im Leben dieses Menschen einen Notfall gibt? Was dann? Worauf wird sich die »Arbeit« konzentrieren – auf das soziale Feld, das Leben zu Hause, Beziehung(en), die Familie, Drogenmissbrauch und so weiter? Auf das »umweltbezogene Feld«? Auf das »beziehungsorientierte Feld«? Auf das »spirituelle Feld«? Auf globale oder politische Fragen? Oder auf die Kontaktgrenze dieser PsychotherapeutIn und dieses Menschen, an der das Leiden dieses Menschen direkt erlebt werden kann? Wie können PsychotherapeutInnen phänomenologisch praktizieren, wenn persönliche Ansichten oder Angelegenheiten in der »Außenwelt« Gestalt annehmen?
Alle PsychotherapeutInnen haben ihre eigenen Überzeugungen: persönliche, klinische, ethische, kulturelle und so weiter. TherapeutInnen können ihre Persönlichkeit nicht an der Praxistür zurücklassen. Es ist weder ratsam noch möglich. Was tun wir also mit persönlichen Überzeugungen? Strenggläubige römisch-katholische PsychotherapeutInnen hören ihren Patientinnen dabei zu, wenn sie eine Abtreibung planen. Sozial-konservative PsychotherapeutInnen hören, wie Paare die Möglichkeit mehrerer Sexualpartner diskutieren. Manchmal passen die persönlichen Überzeugungen von TherapeutIn und PatientIn zusammen – und manchmal ganz und gar nicht. Unsere persönlichen Überzeugungen leiten unser persönliches Leben. Dabei handelt es sich um eine Ethik des Inhalts.
Natürlich sind manche der persönlichen Überzeugungen einer TherapeutIn notwendig, um Psychotherapie zu praktizieren. Dazu gehört das Wissen der TherapeutIn, das sie in der klinischen Ausbildung erworben hat, sowie persönliche klinische Erfahrung. TherapeutInnen bleiben Menschen in ihrer klinischen Rolle und praktizieren in ihrem persönlichen Stil, der durch die Erfahrungen in ihrem Leben geformt wird (L. Perls 1992). Wie können PsychotherapeutInnen unter diesen Umständen mit potenziellen Konflikten zwischen persönlichen und klinischen Überzeugungen umgehen, wenn die Frage »Was bringt Sie zu mir?« gestellt und beantwortet wird?
Die Unterscheidung zwischen extrinsischer und intrinsischer Ethik und der grundlegenden Ethik der Psychotherapie kann bei der Antwort auf diese Frage helfen. Wenn die PsychotherapeutIn zulässt, dass ihre persönlichen ethischen Überzeugungen in einer Sitzung Gestalt annehmen, dringt eine extrinsische Ethik in die Psychotherapie ein. Perls, Hefferline und Goodman (2006) stellen fest, dass es zur Gestalttherapie gehört,
[…] die interne Struktur der gegenwärtigen Erfahrung zu analysieren … das Erreichen einer starken Gestalt selbst [ist] die Heilung …, denn die Kontaktfigur ist nicht ein Anzeichen dafür, sondern selbst die kreative Integration der Erfahrung. (ebd. Bd. 1, 28, Hervorhebungen im Original)
Und diese Gestalt, die an der Kontaktgrenze entsteht, muss daher frei von irrelevanten persönlichen Anliegen der PsychotherapeutIn sein. Es ist die PatientIn, die die Patientin ist. Oder genauer gesagt: Die Kontaktgrenze von TherapeutIn und PatientIn ist der Ort in der Psychotherapie, an dem die Erfahrungen der PatientIn Figur wird, vor der aktiven Hintergrundpräsenz der TherapeutIn, die von situativer Ethik geleitet wird.
Ein hypothetisches klinisches Beispiel.
Eine Frau lässt sich in den Sessel fallen und blickt zu Boden.
»Ich hatte eine Fehlgeburt.« Sie ist atemlos, aufgewühlt.
Die Therapeutin beugt sich vor und sieht sie an.
»Mary, können Sie mich ansehen? Ich hatte vor ein paar Jahren auch eine. Sie fühlen sich heute sicher schlecht. Das geht vorbei. All das heißt nur, dass Sie sobald wie möglich wieder versuchen müssen, schwanger zu werden.«
Die persönlichen Überzeugungen der Therapeutin stellen eine extrinsische Ethik des Inhalts dar und formen ihre Arbeitsweise. Zumindest ist eine Gelegenheit verloren gegangen, die entstehende Struktur des Verlustgefühls der Patientin zu erkunden. Dies ist ein extremes Beispiel. Unmöglich? Vielleicht nicht.
Natürlich ist alles, was wir den PatientInnen anbieten können, wenn auch anscheinend extrinsisch zu den vorliegenden Themen, eine Grundlage für unsere Arbeit als GestalttherapeutInnen. Es gibt kein abstraktes »Hier und Jetzt« (Staemmler 2011). Das ist phänomenologisch unmöglich (Zahavi 2003). Die Ethik des Inhalts einer PatientIn ist Teil der »Struktur der aktuellen Situation«, auf die wir immer unsere Aufmerksamkeit richten. Wir sind immer daran interessiert, was eine Erfahrung für einen Menschen bedeutet.
Ich komme zu Mary und einem anderen klinischen Ansatz zurück.
»Ich hatte eine Fehlgeburt«. Sie ist atemlos, aufgewühlt.
»Mary, wenn ich Ihre Worte höre, merke ich, wie ich mit einem Gefühl des Verlusts in diesen Sessel sinke. Und wie ich so dasitze, frage ich mich, wie viel davon zu Ihnen gehört. Würden Sie mir mehr darüber erzählen, was Sie gerade erleben?«
»Ich fühle mich schwer, John, und gleichzeitig habe ich das Gefühl zu schweben. Seltsam.«
»Würden Sie die Füße auf den Boden stellen und beobachten, was passiert?«
Mary tut es, atmet und ist still.
Und wieder einmal fangen Therapeut und Patientin an, auf das zu achten, was an der Kontaktgrenze gemeinsam entsteht. Sie werden von einem gemeinsamen unausgesprochenen und verkörperten Gefühl getragen, einem »Sehen«, einem »Wissen«, dass es eine menschliche Beziehung gibt, welche die sich entwickelnde Kontaktsequenz erhält. Mary kann jetzt still sein, »gehalten« von der grundlegenden Unterstützung der therapeutischen Beziehung, unausgesprochen, doch erfahrbar. Vielleicht ergibt sich ein neues Erleben von Marys Fehlgeburt oder Mary gelangt zu einem neuen Verständnis, und bekannte Figur/Grund-Formationen nehmen in dem fortlaufenden Prozess neue und überraschende Formen an. Die Architektur der Unterstützung für diesen Prozess ist die situative Ethik der Lebenswelt.
Die situative Ethik begründet und erhält die Voraussetzungen für die Psychotherapie und bietet die Orientierung für die grundlegende Ethik der Psychotherapie, die eine Ethik des Inhalts ist. Die grundlegende Ethik ist ein ethischer Zustand, der Psychotherapie erst möglich macht. So umfasst die grundlegende Ethik z. B. das klinische Know-how der TherapeutIn, Erfahrung, Wissen und auch die entsprechenden beruflichen ethischen Kodizes. Sie umfasst Sorge um das Wohlergehen der PatientInnen, potenzielles Leid durch oder für andere Personen, die Eignung der PatientIn für die Therapie und die Eignung der TherapeutIn für diese bestimmte PatientIn. Als wesentliche Bestandteile der beruflichen Kompetenz einer PsychotherapeutIn sind diese Belange grundlegend und der Beziehung selbst intrinsisch: notwendige Voraussetzungen für die Therapie und Richtlinien für die laufende Arbeit. Sie sind »innerhalb« der Therapie selbst und werden nicht durch die extrinsischen, »äußerlichen«, irrelevanten Interessen der PsychotherapeutIn hereingebracht. Dies mag simpler klingen, als es ist. Doch für GestalttherapeutInnen kann es aufgrund unserer Geschichte besonders schwierig sein.
2.1 Gestalttherapie – eine Weltsicht mit den besten Absichten: GestalttherapeutInnen verwechseln leicht die extrinsische und die intrinsische Ethik
Jeder wird uns ohne weiteres darin zustimmen, dass es höchst wichtig ist zu wissen, ob wir nicht von der Moral zum Narren gehalten werden. (Lévinas 2002)
Gestalttherapie (Perls / Hefferline / Goodman 2006) ist das Buch, das Tausende GestalttherapeutInnen auf den Weg gebracht hat – PsychotherapeutInnen, AktivistInnen und SozialreformerInnen, allesamt fest entschlossen – eine gerechtere Welt zu schaffen. Alle waren von einer Ethik der besten Absichten durchdrungen. Am Ende der Einleitung zum theoretischen Abschnitt von Gestalttherapie finden sich die folgenden Sätze, die die psychotherapeutische Theorie der Gestalttherapie und eine sozial-reformistische Philosophie inspirierten: »Denn unsere gegenwärtige Situation muss, in welchem Lebensbereich auch immer, als ein Feld schöpferischer Möglichkeiten gesehen werden – oder sie ist völlig unerträglich.[…] Aber dieses Maß an Glück ist zu bescheiden, es ist erbärmlich gering.[…] Tatsache ist, dass wir im Großen und Ganzen in einem chronischen Notstand leben und der größte Teil unserer Kräfte der Liebe, des Verstandes, des Ärgers und der Empörung unterdrückt oder abgetötet wird.« (PHG 2006, Bd. 1, 54) Die Achtsamen, Sensiblen und Kühnen unter uns »verbrauchen ihre Kräfte und leiden, denn es ist unmöglich, besonders glücklich zu sein, wenn nicht alle glücklicher sind.« (ebd.)
Gleichzeitig fordert uns Gestalttherapie dazu auf, PsychotherapeutInnen zu sein, die sich mit den gegebenen »Kontaktunterbrechungen« und »Verlusten der Ich-Funktion« eines bestimmten Menschen befassen. Wir müssen auch auf den Kontext der PatientIn achten – dass wir in einer Gesellschaft leben, die »[…] gegen das Leben und den Wandel (und die Liebe) ist« (ebd., 185). Wir kümmern uns um den Prozess des In-Kontakt-Tretens dieses bestimmten Menschen in dieser bestimmten Sitzung. Gestalttherapie fordert uns auch dazu auf, SozialaktivistInnen zu sein. Eine Gestalt ist schließlich das Ganze seiner Teile; kein Mensch ist eine Insel, die fernab der Welt nur für sich existiert. Die Lebenswelt ist tatsächlich eine Welt, wie ich bereits ausgeführt habe, wenngleich eine phänomenale Welt. Die Gestalttherapie war mit dieser klinisch-sozialen Weltsicht selbstverständlich nicht allein, sondern teilte ihr Engagement für den sozialen Aktivismus z. B. mit der radikalen Psychoanalyse (Lichtenberg 1969).
Unsere PatientInnen sind also nicht nur leidende Individuen, sie sind Teil des größeren sozialen Felds, dessen Institutionen gegen die guten und animalischen Impulse dieser Individuen als Organismen stehen (PHG; 2006, Bd. 1, 82) Diese Impulse besitzen die »Weisheit des Organismus« – eine »Weisheit«, die eine »Ethik des Augenblicks«, jedoch »nicht unfehlbar« ist (ebd.). Die Gestalttherapie wollte diese »Weisheit« nicht nur in einer Psychotherapie befreien, die den von der Gesellschaft am Individuum angerichteten Schaden heilt, sondern auch durch politische Aktion, um soziale Veränderungen zu bewirken (Perls F. 1992; Stoehr 1994; Perls / Stevens 1969; Aylward 2006; Bocian 2010). Hier zeigt sich die Neigung der Gestalttherapie, intrinsische und extrinsische Ethik zu verwechseln. Kann die Gestalttherapie in einer psychotherapeutischen Sitzung gleichzeitig eine klinische Praxis und ein Instrument sozialer Veränderung sein?
Wenn GestalttherapeutInnen über Gestalttherapie schreiben, schreiben sie manchmal über die klinische Praxis. Manchmal schreiben sie über soziale, politische oder religiösspirituelle Themen, in denen die klinische Praxis zusammengefasst zu sein scheint (Levin 2010). »Wir sind ebenso eine politische wie eine therapeutische Kunst« (Aylward 2006 [Übers. a. J.]), schreibt ein zeitgenössischer Gestalttherapeut. Es ist unklar, ob er meint, dass diese zur selben Zeit praktiziert werden.
Und ein anderer Gestalttherapeut geht noch weiter und schreibt:
Die Gestalttherapie bietet mehr als nur ein Heilmittel. Sie beschäftigt sich mit der Heilung … Ein Heiler unserer Zeit muss sich um die Umwelt und die Gemeinschaft kümmern, indem er sich mit einer Reihe von sozio-ökonomischen Themen wie der Globalisierung befasst, wie auch mit der transpersonalen und spirituellen Innerlichkeit der Seelen der Menschen. (Levin 2010, 147 [Kursivierung: D. Bloom; Übers. A. J.])
Wie unterscheidet sich diese Beschreibung von der Berufung eines Priesters?
Welche persönlichen Überzeugungen auch immer aus den humanistischen, spirituell-sozio-politischen Idealen der Gestalttherapie entstehen, so handelt es sich immer um eine extrinsische Ethik des Inhalts, die für die Welt als Ganzes heilsam sein mag. Vom Standpunkt der klinischen Psychotherapiepraxis aus gesehen sind diese Überzeugungen jedoch extrinsisch – und können sich potenziell intrusiv auf sie auswirken. Die persönliche ethische Agenda, die von der PsychotherapeutIn in die Therapiesitzung getragen wird, kann zu der Norm werden, an der eine auftauchende Figur gemessen wird. Perls, Hefferline und Goodman (2006) schreiben, dass »der Patient … sich selbst so gut wie möglich in Übereinstimmung mit der Konzeption des Therapeuten erschaffen [will]« und sagen weiter: »[ist] es offensichtlich wünschenswert, eine Therapie zu entwickeln, die so wenig normativ wie möglich ist und statt dessen versucht, so viel wie möglich aus der Struktur der aktuellen Situation im Hier und Jetzt zu machen« (PHG 2006, Bd.1, 91 f.). Doch die PatientIn und die TherapeutIn sind Teil des größeren sozialen Felds. Lässt sich die Therapie davon trennen? Gibt es einen Mittelweg?
In der Gestalttherapie wird die Psychopathologie als Störung an der Kontaktgrenze verstanden (Spagnuolo Lobb 2007d; Francesetti / Gecele 2009). Diese Störungen werden von PatientIn und TherapeutIn als ästhetische (gefühlte) Aspekte des In-Kontakt-Tretens unmittelbar erlebt (Bloom 2003). Unsere eigene phänomenologische Methode verlangt, dass wir extrinsische irrelevante Annahmen beiseitelegen (ausklammern), damit wir unser Augenmerk auf das richten können, was in der Sitzung entsteht (Bloom 2009; Crocker 2009; Philippson 2009; Yontef 2009).
Natürlich werden das klinische Know-how und die klinische Weisheit und die klinischen Standards der PsychotherapeutIn nicht ausgeklammert. Sie bleiben verfügbarer Hintergrund, da sie Teil der grundlegenden Ethik der Psychotherapie sind. Wie könnte es die Therapie ohne sie geben? Auch das Wissen um die Außenwelt besteht weiterhin als Hintergrund. Eine Sitzung kann schließlich nicht hermetisch abgeschlossen sein. Der »Ausklammerer« ist »nicht ausklammerbar« (Stolorow / Jacobs 2006).
Begünstigt das Ausklammern der extrinsischen Ethik des Inhalts eine unverantwortliche ethische Anarchie, die angeblich charakteristisch für das Paradigma des Individualismus ist (Wheeler 2000a)? KritikerInnen der Gestalttherapie, die innerhalb dieses Paradigmas praktizieren, werfen GestalttherapeutInnen vor, PatientInnen darin zu bestärken, sich jeglicher Autorität zu widersetzen und in ihrem Verhalten einer kühnen Autonomie zu frönen, ohne die Auswirkungen auf andere in Betracht zu ziehen (Yontef 2002). Es stimmt, dass Fritz Perls die Anti-Establishment-Gegenkultur anfeuerte (Perls F. 1992), aber es ist absurd zu behaupten, dass er für das extreme Ethos dieser Gegenkultur verantwortlich gewesen sei.
Wir treten in die Phase der Quacksalber und Betrüger ein, die glauben, dass du geheilt bist, wenn du irgendeinen Durchbruch schaffst – und die jegliche Erfordernisse des Wachstums außer Acht lassen … Ich muss sagen, dass ich über das, was gegenwärtig vor sich geht, sehr besorgt bin. (Perls 2008, 10)
Die ethischen Werte der Mach-dein-Ding-Autonomie wurden von manchen TherapeutInnen verfolgt, die sich unter dem Banner der kreativen Freiheit allzu sorglos ihren PatientInnen gegenüber verhielten. Manche GestalttherapeutInnen glaubten, dass dieses Verhalten durch Fritz Perls’ Gestalt Prayer, sein Gestaltgebet (Perls F. 1992), legitimiert würde. Diese Exzesse beschränkten sich natürlich nicht nur auf GestalttherapeutInnen. Innerhalb des frühen individualistischen Paradigmas wurde der Gestalttherapie oft vorgeworfen, PatientInnen zu beschämen. Konfrontativ arbeitende TherapeutInnen überredeten PatientInnen dazu, ihre »Widerstände zu durchbrechen« (Yontef 2002). Manche TherapeutInnen von damals haben den Ruf, sich außerhalb dessen verhalten zu haben, was heute für viele als ethische Leitlinien gilt. Die Gestalttherapie hat anscheinend unter diesem Paradigma einen schlechten Ruf bekommen. Aber muss die Gestalttherapie Buße für vermeintliche Verfehlungen in der Vergangenheit tun?
Im Zusammenhang mit einem möglichen »Ethikkodex der Gestalttherapie« reflektieren Phil Joyce und Charlotte Sills, dass »die Gestalttherapie in den 1950ern entwickelt worden ist und sich für eine anarchistische Haltung einsetzte, die moralische Kodizes als überholte fixierte Gestalten betrachtete, die herausgefordert werden mussten. Die Ethik und der Verhaltenskodex wurden individuell festgelegt oder verhandelt«.
Und weiter: »Es gab nur wenig Interesse am Potenzial für therapeutischen Schaden oder an Diskussionen von moralischen oder gemeinschaftlichen Werten. Wir glauben, dass dies zu vielen Beispielen missbrauchender therapeutischer Beziehungen geführt hat und auch weiterhin ein wichtiges Problem für einen gestalttherapeutischen Ethik- und Verhaltenskodex darstellt« (Joyce / Sills 2006 [Kursivierung D. Bloom]).
Doch waren diese GestalttherapeutInnen nicht den »Gemeinschaftswerten und der Moralität« verpflichtet, die zu dieser Zeit und an diesem Ort herrschten? Kann man wirklich Fritz Perls’ lautere Absichten im klinischen Rahmen in Frage stellen, ungeachtet seiner Selbstdarstellung in nicht-klinischen Zusammenhängen? Die GestalttherapeutInnen der ersten Generation hatten ethische Leitlinien. Sie waren um das Wohlergehen ihrer PatientInnen bemüht. Das traf damals natürlich nicht immer auf alle von ihnen zu – und das tut es auch heute nicht. Es gab, gibt und wird in allen Berufen immer ethische Probleme geben. Alle Berufe brauchen ethische Kodizes, so wie alle Gesellschaften Gesetze brauchen. Und sicher sind GestalttherapeutInnen nicht die einzigen »Missetäter« in dieser Berufsgruppe, die sich Verstöße gegen die ethischen Leitlinien haben zuschulden kommen lassen.
Außerdem ist es ein Kernaspekt der klinischen Theorie/Praxis der Gestalttherapie, fixierte moralische Kodizes infrage zu stellen, wenn unbewusste Introjekte bewusst werden und Gestalt annehmen. Manche moralischen Kodizes sind tatsächlich überholt und tauchen in Sitzungen als Einschränkungen des In-Kontakt-Tretens an der Kontaktgrenze auf. Dies ist allen GestalttherapeutInnen bekannt. Die Normen der zeitgenössischen Praxis fordern uns nicht länger auf, unsere PatientInnen zu provozieren, sondern konkret mit ihnen an der Kontaktgrenze zu sein und sensibel dem gegenüber zu sein, was auftaucht.
Robert Lee hat einen wichtigen Beitrag zur gestalttherapeutischen Ethik geleistet. In seinem Essay Ethics: A Gestalt of Values / The Values of Gestalt. A Next Step (Lee 2004a), schreibt er über unsere »impliziten Beziehungsbestrebungen«. Diese Bestrebungen und viel von seiner dialogischen intersubjektiven Theorie (ebd., 26) scheinen der hier beschriebenen situativen Ethik ähnlich zu sein. Die situative Ethik jedoch bezieht sich auf die grundlegendere Architektur der vorgegebenen Lebenswelt, aus der implizite Beziehungsbestrebungen erst entstehen können. Er beschreibt eine Beziehungsethik, bei der ethische Implikationen und Entscheidungen aus einem »mitfühlenden Grund« entstehen, der Verbindungen und Beziehungen wertschätzt. Die situative Ethik jedoch ist unsere ethische Perspektive, aus der wir den Wert von Verbindungen und Beziehungen sehen und erfahren können. Die situative Ethik kann die Grundlage für Mitgefühl bilden. Lees Beziehungsethik wird zu einer Ethik des Inhalts, wenn er sie über die für die Gestalttherapie typische Psychotherapie der Kontaktgrenze hinaus in die Sozialkritik des »breiteren größeren Feldes« trägt.
»Individuelle Gesundheit ist abhängig von der Gesundheit des größeren Felds.« (ebd., 27) Demnach »legt die Gestalttherapie nicht nur großen Wert auf die Unterstützung des Individuums, sondern auch auf die des Umwelt-Feldes« (ebd., 25). Er fährt fort: »Wir müssen ganze Lösungen finden, die sowohl das Individuum als auch die Umwelt unterstützen.« (ebd., 26) Als Anleitung für sozial-politische Reformer ist eine solche Forderung legitim. Doch wie weit ist das Feld unserer unmittelbaren klinischen Sorge für diese leidende PatientIn in diesem Moment in diesem Praxisraum?
Die Aufmerksamkeit für das soziale Feld eines Menschen ist einer der Einflüsse auf unsere Arbeit, da das Selbst seinen größeren Hintergrund umfasst – das soziale Feld, das phänomenale Feld oder das Organismus/Umwelt-Feld. Wird diese Aufmerksamkeit jedoch auf einen vagen Wert der »Feld-Verantwortung« oder auf eine persönliche Meinung über die »Gesundheit« des größeren Feldes ausgeweitet, geraten wir in eine unsichere Ethik des Inhalts, was Implikationen für unsere erfahrungsbezogene Methode hat. Meinungen über das Umwelt-Feld stellen eine ehrenwerte Ethik des Inhalts für soziale oder politische Reformen dar. Ihre spezifische klinische Relevanz für die grundlegende Ethik, die die Psychotherapie trägt, ist allerdings fraglich. Verschiedene politische Parteien haben unterschiedliche politische Agenden und jede hat ihre eigene Ethik des Inhalts. Es ist arrogant davon auszugehen, dass eine bestimmte Untergruppe wohlmeinender PsychotherapeutInnen die einzige Wahrheit besitzt.
Gemeinschaftswerte, sittliches Empfinden, Meinungen über das »Feld«, die Umwelt, Beziehungsverantwortung, sogar die Spiritualität verändern sich im Laufe der Zeit. Doch die Struktur der aktuellen Situation und unsere Arbeit an der Kontaktgrenze bleiben konstant. Sie sind der Leitstern unserer Praxis, während die Natur des Leidens unserer PatientInnen und unser klinisches Wissen sich nach und nach verändern.
Unser dezentriertes Subjekt der postmodernen Welt kämpft darum, einen ethischen Weg zu finden. Postmoderne Ethik ist sicher keine leichte Angelegenheit. In seinem Buch Postmodern Ethics schreibt Zygmunt Bauman: »Wenn ich nicht nach meiner Interpretation des Wohlergehens des/der Anderen handle, mache ich mich nicht einer sündhaften Gleichgültigkeit schuldig? Und wenn ich es tue, wie viel von ihrer/seiner Autonomie nehme ich weg? … Es gibt nur eine dünne Linie zwischen Fürsorge und Unterdrückung …« (Bauman 1993, 91 f.)
Die messerscharfe Klinge von Baumans dünner Linie kann nicht ignoriert werden. Wir dürfen nie vergessen, dass es einmal die wohlmeinende Praxisnorm war, Homosexuelle zu heilen und aggressive Frauen in passive Hausfrauen zu verwandeln. Heute sind wir weiser. Doch was wird man in hundert Jahren über unsere Weisheit sagen?