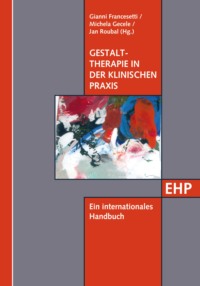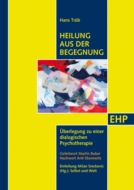Kitabı oku: «Gestalttherapie in der klinischen Praxis», sayfa 17
1. Der politische Kontext: Der Wunsch, dass die Gestalttherapie in der starken Konkurrenz des psychotherapeutischen Berufs besteht
Als GestalttherapeutInnen erscheinen wir oft naiv in unserer Vorstellung, ungeachtet des sozialen und politischen Kontextes, in dem wir arbeiten, weiterhin frei praktizieren zu können. Doch ein kalter Wind weht durch Europa, ein kalter Wind, der evidenzbasierte Praxis, gesetzliche Regelungen, berufliche Vorschriften und manualisierte Behandlungen zu uns bringt. Diese Entwicklungen beeinflussen die klinische Praxis bereits. Können wir weiterhin so frei und liberal praktizieren wie in den letzten 50 Jahren? Während ich schreibe, wurde in einem weiteren Land, nämlich in Frankreich, der Titel Psychotherapeutln auf PsychologInnen und ÄrztInnen beschränkt.1 Dies ist trotz der ehrgeizigen und prinzipientreuen Vision der Europäischen Vereinigung für Psychotherapie geschehen, die sich seit ihrer Gründung 1991 für die Einrichtung einer unabhängigen Berufsrichtung der Psychotherapie einsetzt (EAP, Straßburger Deklaration zur Psychotherapie). Eva Gold und Stephen Zahm sind weise, wenn sie GestalttherapeutInnen mahnen, sich »kreativ an den aktuellen Zeitgeist anzupassen« [Übers. a. J.], wenn die Gestalttherapie überleben und wachsen soll (Gold / Zahm, in Brownell 2008).
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels behandle und kritisiere ich die »Forschungspolitik«, um das notwendige Verständnis für die Themen, um die es geht, zu vermitteln und GestalttherapeutInnen dafür zu rüsten, den »neuen« Status quo so infrage zu stellen, wie unsere Gründer es mit dem »alten« Status quo vor 60 Jahren getan haben.
PsychotherapeutInnen werden zunehmend dazu angehalten, Forschung zu betreiben. Wir werden gedrängt, die Effektivität unserer Arbeit unter Beweis zu stellen und evidenzbasierte Praxis heranzuziehen, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern (Rowland / Goss 2000). Aber welche Evidenz kann den Wert der Arbeit, die wir leisten, am besten zeigen? Auf welche Evidenz sollen sich KlientInnen und die Geldgeber, die das Gesundheitssystem finanzieren, am besten verlassen?
Es hängt viel davon ab, wie »Evidenz« definiert wird. Nach der herrschenden Sicht der Bewegung, die sich für eine evidenzbasierte Praxis einsetzt, sollte Evidenz »wissenschaftlich« sein und mit Messwerten und Quantifizierungen aufwarten. Ich bin schon so mancher GestalttherapeutIn begegnet, die sich sorgte, dass es qualitativen Methoden an wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit fehlen könnte, und die den Glauben an die Effektivität einer Forschung mit Menschen anstatt über Menschen verloren hatte. Aber wie relevant sind die quantitativen Ansätze, wenn es um Psychotherapie geht? Wie kann quantifiziert werden, ob eine PsychotherapeutIn die Ambivalenz der menschlichen Erfahrung versteht? Ist es möglich, die komplexe, sich immer entwickelnde, vielschichtige Natur therapeutischer Beziehungen und der Arbeit, die wir leisten, zu messen?
Es ist zwar eminent wichtig, die Praxis durch Evidenz zu unterstützen, doch es ist auch notwendig, sowohl herrschende Meinungen darüber, was die »beste« Evidenz ausmacht, als auch die Überbetonung der quantitativen Evidenz infrage zu stellen, bei der die Verwendung randomisierter kontrollierter Studien als der »Goldene Standard« hochgehalten wird.
2. Diskussion der Natur der Evidenz
Großbritannien, genauer gesagt das National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), empfiehlt z. B. in seinem Leitfaden für die Behandlung von Depressionen die Anwendung von geleiteten, auf der kognitiven Verhaltenstherapie basierenden Selbsthilfeprogrammen für PatientInnen mit leichter Depression. Für Patienten mit schwerer Depression rät es zu einer Kombination von kognitiver Verhaltenstherapie und Antidepressiva (NICE 2004/7).2
Das NICE stützte sich bei seiner Arbeit auf eine Hierarchie, die Evidenz nach ihrem vermeintlichen Wert klassifiziert und bewertet. An der Spitze der Hierarchie steht die Evidenz der Stufe A, die aus kontrollierten Experimenten und hier vor allem aus randomisierten kontrollierten Versuchen (randomized controlled trials, RCTs) gewonnen wird.3 Evidenz der Stufe B stammt aus sinnvoll konzipierten quantitativen Studien wie Untersuchungen und nicht-randomisierten Experimenten.4 Die Evidenz der Stufe C schließlich umfasst Expertenmeinungen, die auf Fallbeispielen und klinischen Beispielen basieren.
Diese Evidenzhierarchie weist beträchtliche Lücken auf. Die Meinungen der KlientInnen und BetreuerInnen fehlen ebenso wie die Ansichten der PsychotherapeutInnen selbst. Es gibt keinen Bezug zu »praxisbasierter Evidenz«. Qualitative Forschung – wohl die Evidenz, die in beziehungsorientierten Psychotherapien hauptsächlich verwendet wird – wird überhaupt nicht berücksichtigt. Themen, die mit dem Therapie-»Prozess« zu tun haben, werden zugunsten der »Resultate« gemieden. All dies deutet auf die Politisierung der Forschung hin. So wurden z. B. aufgrund der Empfehlungen des NICE zusätzliche staatliche Mittel zur Verfügung gestellt, um den Mangel an kognitiven VerhaltenstherapeutInnen zu beheben; für andere Formen der Psychotherapie wurden keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt.
3. Im Fokus: RCTs
Wenn Sie die Wirksamkeit eines Medikaments testen wollten, würden Sie sich am ehesten für RCT-basierte Forschungen entscheiden. Schließlich kann man auf diese Weise die Wirkung eines Medikaments, das klare physische Effekte hat, unmittelbar messen und bewerten und die Ergebnisse mit Fällen vergleichen, in denen das Medikament nicht verabreicht worden ist. Die Frage ist, ob die Gestalttherapie mit ihren Schichten emotionaler und beziehungsbezogener Komplexität mit einer medikamentösen Behandlung gleichgesetzt werden kann.
Während RCTs bei der Messung von Veränderungen der physischen Gesundheit und des Verhaltens effektiv sind, sind sie weniger geeignet, Veränderungen in der Gefühlswelt und im subjektiven Wohlbefinden zu messen. Außerdem bilden RCTs nicht das wahre Leben ab, da sie geschaffen wurden, um die jeweilige Effizienz unter streng kontrollierten Bedingungen bei sorgfältig selektierten PatientInnen/KlientInnen zu messen. Langzeitbehandlungen werden in RCT-Studien nur selten untersucht, trotz der Tatsache, dass die Forschung auf erfolgreichere Ergebnisse bei Therapien hindeutet, die sich über längere Zeit erstrecken.
Kritiker des blinden Vertrauens in RCTs haben eine Reihe an potenziellen Schwachstellen in der Art aufgezeigt, wie experimentelle Forschung als einziges Mittel zur Prüfung von Therapieeffizienz verwendet wird. Wie sie aufzeigen, geht man bei der Verwendung von experimentellen Designs (einschließlich der RCTs) davon aus, dass die Probleme der Menschen klar abgegrenzt und verglichen werden können, und dass Techniken isoliert und in der erforderlichen »Dosis« angewandt werden können.
Mottram (2000) erklärt, dass die Bedingungen, die in RCTs zur Psychotherapie geschaffen werden, eine »erhebliche Abweichung von der gewöhnlichen psychotherapeutischen klinischen Praxis [Übers. a. J.]« darstellen (ebd., 1). Die Versuche befassen sich oft mit Erkrankungen, die in ihrer Reinform in der Praxis kaum – wenn überhaupt – existieren. RCTs neigen auch dazu, sich auf einzelne Probleme zu konzentrieren und die Tatsache zu ignorieren, dass die meisten KlientInnen mehr als ein klar definiertes »Hauptproblem« haben, für das sie sich in Psychotherapie begeben. Wie Westen, Novotny und Thompson-Brenner (2004) darlegen, stützt sich die RCT-Forschung zum Großteil auf das DSM Diagnosesystem – ungeachtet der Tatsache, dass nur ein kleiner Prozentsatz jener, die eine Therapie machen, dies tut, weil er eine bestimmte DSM-Diagnose hat. In den meisten Fällen brauchen die PatientInnen/KlientInnen Hilfe im alltäglichen Leben. Die Menschen bestimmten Gruppen von Erkrankungen zuzuordnen löscht die Besonderheit von individuellen Persönlichkeiten und verdeckt die feinen Anpassungen, die TherapeutInnen als Reaktion auf Unterschiede in der Persönlichkeit vornehmen. Ramsay (zitiert in Bovasso /Williams / Haroutune 1999) meint, dass wir mehr Forschung brauchen, die sich mit »freilaufenden Menschen« befasst – jene Menschen, die Therapeuten tatsächlich in ihren Praxen behandeln. »RCTs stellen KlientInnen typischerweise als passive EmpfängerInnen von standardisierten Behandlungen dar und nicht als aktive Partner und SelbstheilerInnen – Annahmen, die unseren Werten als beziehungsorientierten TherapeutInnen widersprechen« (Elliot 2001, 316 [Übers. a. J.]).
Eine der potenziell fehlerhaften Entwicklungen, die sich aus der Bewegung für eine evidenzbasierte Praxis ergibt, ist die Forderung, die Effektivität verschiedener psychotherapeutischer Behandlungen zu vergleichen. In der Welt der Psychotherapie hat sich der Ansatz, Evidenz zu finden, um eine Therapieform über die andere zu stellen, als wenig hilfreich erwiesen und führte sogar zu Spaltungen.
Überzeugende und umfangreiche Forschung, die sich über mehrere Jahre erstreckte, hat gezeigt, dass die Beziehungsdimensionen, die sich durch alle Therapieformen ziehen, wichtiger sind als bestimmte Techniken.
Im Jahr 1975 schlossen Luborsky, Singer und Luborsky eine Metaanalyse von mehr als hundert Forschungsprojekten ab, die zwischen 1949 und 1974 durchgeführt wurden. Sie fanden heraus, dass die Art der Therapie, die einer KlientIn zuteil wurde, keinen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Die Befindlichkeit von KlientInnen, die irgendeine der unterschiedlichen Therapien erhalten hatten, mit denen sich die Analyse befasste, schien sich als Resultat ihrer Erfahrung zu verbessern. Daraus schlossen Luborsky, Singer und Luborsky, dass »wir hier zu einem ›Dodo-Bird-Verdict‹ kommen können. Im Allgemeinen kann man sagen, jeder hat gewonnen und alle müssen einen Preis bekommen« (ebd., 1003, Übers. A. J.). Eine anschließende Metaanalyse von Smith und Glass (1977) bestätigte das »Dodo-Bird-Verdict«-Ergebnis. Wampold et al. (1997) überprüften zwischen 1970 und 1995 ausgeführte Studien und fanden nur geringe oder gar keine Unterschiede in der Effektivität der verschiedenen Therapieformen. Die Abteilung für Psychotherapie der Amerikanischen Vereinigung für Psychologie (American Psychological Association, APA) veröffentlichte die überarbeitete Version eines Buches mit dem Titel Psychotherapy Relationships That Work und stellte fest, dass allgemeine Prozesse, die über die theoretische Orientierung hinausgehen (wie z. B. die Bildung das therapeutischen Bündnisses), den größten Einfluss auf erfolgreiche Ergebnisse hatten (Norcross 2002).
Eine ganze Reihe an Forschungen hob die Tatsache besonders hervor, dass eine therapeutische Beziehung von hoher Qualität der beste Indikator für erfolgreiche Ergebnisse ist. Dieses Ergebnis trifft auf verschiedene Therapien und unterschiedliche Probleme der KlientInnen zu (Margison et al. 2000; Gershefski et al. 1996; Everall / Paulson, 2002; Bryan et al. 2004; Hubble / Duncan / Miller 1999). In seiner Zusammenfassung von Forschungsergebnissen zur Beziehung zwischen Therapie und Veränderungen bei PatientInnen/KlientInnen, fand Lambert (1992) heraus, dass nur 15 Prozent der therapeutischen Veränderung auf Faktoren zurückzuführen waren, die spezifisch für bestimmte Therapien sind.
Zu einer Zeit, in der die Zunahme von qualitativen Methodologien die therapeutische Beziehung und den Beitrag der KlientInnen zu dieser Beziehung stärker betont, stellt sich die Frage, warum es in der psychotherapeutischen Forschung immer noch Effektivitätsstudien gibt, die die verschiedenen Therapieformen miteinander vergleichen. Die Antwort könnte in der allgegenwärtigen Kultur des Marktes mit ihrem Schwerpunkt auf Nachvollziehbarkeit, Konkurrenz und Auswahl liegen (Evans / Gilbert 2005).
4. Ein Hoch auf den »praxisbasierten Ansatz« zur Evidenz
In den letzten Jahren sind Stimmen laut geworden, die für eine praxisbasierte Evidenz anstelle einer evidenzbasierten Praxis eintreten. Dieser Ansatz fördert Forschungen in kleinerem Maßstab in natürlichen, alltäglichen klinischen Settings und stellt die Therapieerfahrungen der KlientInnen/PatientInnen in den Mittelpunkt (Macran et al. 1999; Foskett 2001; Mellor-Clark / Barkham 2003). In der praxisbasierten Forschung sind die TherapeutInnen oft die hauptsächlichen ForscherInnen, und die Forschung ist in das Therapieprogramm integriert. Bei dieser Forschung können TherapeutInnen detaillierte Beschreibungen verschiedener Aspekte ihrer klinischen Fälle präsentieren, die oft Beschreibungen des Kontextes und der PatientInnen/KlientInnen und einen Bericht über die durchgeführte Arbeit enthält. Das Ganze wird durch Evidenz ihrer Effektivität gestützt, die mithilfe standardisierter Methoden, Beobachtungen der Therapeutin selbst und Berichte von KlientInnen gemessen wird.
Ryan und Morgan (2004) führen an, dass praxisbasierte Evidenz nicht nur den KlientInnen/PatientInnen und den TherapeutInnen eine Stimme verleiht, sondern auch deren Wissen aus erster Hand anerkennt, z. B. das Wissen darum, was funktioniert und was sich verändern muss. Es gibt zwar kein Modell für praxisbasierte Forschung, doch wir würden sagen, dass TherapeutInnen gut aufgestellt sind, um Interesse und Relevanz zu erforschen. Die folgenden zwei Beispiele zeigen eine Auswahl aus diesem großen Bereich der praxisbasierten Evidenz.
4.1 Forschungsbeispiel 1 (Strickland-Clark / Campbell / Dallos 2000)
Fünf Kinder/Jugendliche wurden unmittelbar im Anschluss an ihre familientherapeutischen Sitzungen befragt. Man stellte ihnen Fragen zu hilfreichen und nicht hilfreichen Begebenheiten während der therapeutischen Sitzungen. Videoaufnahmen halfen den Kindern/Jugendlichen, diese wichtigen Momente zu bestimmen. Gehört zu werden, das wichtige Gefühl, einbezogen zu werden, der Umgang mit den Schwierigkeiten einer Therapie, wie die Therapie schmerzhafte Momente ins Gedächtnis ruft, die Schwierigkeit, zu sagen, was sie fühlen und denken und das Bedürfnis nach Unterstützung. Die Interviews und die genannten wichtigen Aspekte wurden mittels Grounded Theory und »umfassender Prozessanalyse« analysiert. Zu den Schlüsselthemen, die sich dabei ergaben, gehörte die Tatsache, dass sich die Kinder durch die Forschung gestärkt fühlten und ihre Freude darüber ausdrückten, dass sie gebeten wurden, daran teilzunehmen.
4.2 Forschungsbeispiel 2 (Gilbert 2006)
Diese Studie umfasste eine phänomenologische Untersuchung der Auswirkungen eines traumatischen Erlebnisses (der Tod eines Kindes) auf sechs MitarbeiterInnen einer Sozialeinrichtung. Der Forscher, ein Gestalttherapeut, war zuvor an Hilfsmaßnahmen für die MitarbeiterInnen beteiligt und wollte wissen, wie sie die angebotene Unterstützung, wahrnahmen und welche Bedeutung sie dem Tod beimaßen. Die Ergebnisse umfassten: die sechs StudienteilnehmerInnen erkennen das Ausmaß und die Einzigartigkeit des schlimmen Ereignisses an, sie formulieren Wut, Selbstzweifel und Ängste, sie entwickeln physische Symptome und eine Bewusstheit für persönliche Qualitäten und Stärken. Die TeilnehmerInnen schätzten die Unterstützung durch FreundInnen, Familie und (am meisten) von Kollegen. Neben Humor waren auch Strategien der Selbstunterstützung wichtig.
Weitere Beispiele sind unter anderem Qualls (1998) und auch Elliot / Loewenthal / Greenwood (2007).
5. Gestalttherapie und beziehungszentrierte Forschung
Wir haben eine ethische Verpflichtung, die Effektivität der Gestalttherapie aufzuzeigen, und ich bin der Meinung, dass dies am besten über eine Verbreiterung des Prozesses funktioniert, mit dem unsere Praxis evaluiert wird. Die epistemologischen Grundlagen der Gestalttherapie umfassen die Phänomenologie, die Feld-Theorie, den Holismus und den Dialog. Die gestalttherapeutischen Theorien und Werte orientieren sich innerhalb eines post-modernen Paradigmas, sodass die Gestalttherapie einfach nicht gut in das positivistische Paradigma passt, das einen Großteil der quantitativen Forschung untermauert (Evans 2007). Allzu oft gelingt es der quantitativen Forschung nicht, Kernthemen zu erfassen oder Aufschluss über Prozesse gelebter Erfahrung zu geben. Effektivitätsstudien müssen den reichhaltigen Fundus an Perspektiven von KlientInnen und TherapeutInnen anzapfen, indem sie Ansätze aus der qualitativen Forschung heranziehen.
Für uns als praktizierende GestalttherapeutInnen ist es wichtig zu erkennen, dass Aspekte unserer alltäglichen klinischen Arbeit als respektable »Forschungsaktivitäten« angesehen werden können, die für unseren Beruf und unsere KlientInnen etwas bewirken. Es gibt natürlich große Unterschiede zwischen Psychotherapie und Forschung. In der Forschung zielen wir darauf ab, Individuen und ihre soziale Welt zu verstehen, mit der Absicht, daraus Wissen zu erarbeiten. Unser Kontakt mit denen, die wir untersuchen, ist möglicherweise nur von kurzer Dauer und umfasst vielleicht nicht mehr als ein paar Stunden im Gespräch. In der Psychotherapie wollen wir einander über einen längeren Zeitraum verstehen und befähigen. Die Verbindung zwischen Gestalttherapie und Forschung wird durch die Elemente der gegenseitigen Entdeckung und das Gefühl hergestellt, sich in einem »Prozess« zu befinden, einem Prozess, der nach großem Engagement und Forschergeist verlangt.
Die meisten Bücher zur qualitativen Forschung beschreiben und evaluieren unterschiedliche Methoden. Zwar werden die »Unordnung« und Vielschichtigkeit der Bandbreite qualitativer Forschungsansätze angepriesen, doch sollte Forschung nicht ein für alle offenes Feld sein, in dem »alles möglich ist«. Während die große Anzahl an Forschungsmethoden, die uns zur Verfügung steht, von der Vielfalt und der Dynamik des Feldes zeugt, stellt sie auch eine Herausforderung für die Forschung dar. Wenn es darum geht, aus der Fülle der verfügbaren qualitativen Methoden eine auszuwählen, ist es wichtig, sehr genau über die Frage »Welche Methode(n) soll ich wählen, um das spezielle Forschungsprojekt zu unterstützen, um das es mir geht?« nachzudenken. Neulinge auf dem Gebiet der Forschung wissen möglicherweise nicht, wie sie anfangen sollen. Die Versuchung besteht darin, zu simplifizieren und »Methoden« wie Interviews oder eine qualitative thematische Analyse anzuwenden, statt mit einer »Methodologie« zu arbeiten, die Methoden, aber auch bestimmte philosophische und theoretische Perspektiven umfasst. Barber und Brownell bieten in ihrem Kapitel über qualitative Forschung einen prägnanten und hilfreichen Leitfaden zu qualitativen Methodologien und den dahinter stehenden Philosophien (Brownell 2008). Forschung ist eine Entdeckungsreise und die Methodologie hilft uns zu verstehen, welche Art von Reise wir machen, und stellt uns Landkarten und Reiseführer zur Verfügung. Wenn wir einfach nur Methoden ohne einen methodologischen Kontext anwenden, ist es ein bisschen so, als würden wir packen, bevor wir wissen, wo es hingehen soll! Aus Platzgründen kann ich dieses wichtige Thema nicht umfassender behandeln. Außer bei Barber und Brownell können Sie sich auch in Finlay und Evans (2009) informieren, wo die LeserIn durch das Labyrinth zu einer durchdachten Entscheidung für eine Methodologie geleitet wird.
6. Die Definition von Merkmalen beziehungszentrierter Forschung
Die meisten Beiträge zu unserem beziehungszentrierten Ansatz kommen aus der dialogischen Gestalttherapie, die sich an die existenzielle Phänomenologie, die Intersubjektivität und die beziehungsorientierte Psychoanalyse anlehnt, von ihnen unterstützt und auch infrage gestellt wird. Diese Elemente untermauern die vier charakteristischen Merkmale unseres beziehungszentrierten Forschungsansatzes. Die ersten beiden, Präsenz und Inklusion, werden für die meisten GestalttherapeutInnen unmittelbar auszumachen sein: Sie werden wiederum von Intersubjektivität und Reflexivität unterstützt.
Präsenz ist die Fähigkeit, offen und sowohl emotional als auch körperlich anwesend zu sein. Inklusion ist die Fähigkeit, sich selbst in das Erleben des/der Anderen zu versetzen und dadurch die Existenz und das Potenzial des/der Anderen zu bestätigen. GestalttherapeutInnen wird die Anwendung dieser Konzepte in der klinischen Praxis vertraut sein. Diese Konzepte können ebenso auf die Forschung angewandt werden.
Präsenz und Inklusion sind tatsächlich »Zwillingsprozesse«, die einander in der beziehungszentrierten Forschung bedingen. Die Herausforderung besteht darin, innerhalb der Forschung zu sein und Inklusion zu praktizieren und gleichzeitig auch außerhalb zu sein und eine geerdete Präsenz aufrecht zu erhalten, um sich nicht in dem/der Anderen zu verlieren (Yontef 2002). Die Fähigkeit, beides aufrecht zu erhalten wächst und entwickelt sich mit der Erfahrung.
Obwohl ForscherInnen und Forschungsobjekte voneinander getrennt sind, hebt das Konzept der Intersubjektivität ihre Verflechtungen hervor. Jede beziehungsorientierte Begegnung zwischen zwei Menschen umfasst potenziell vielfache ineinander greifende Subjektivitäten, bewusst und unbewusst. Vergangene und aktuelle Aspekte des Selbst eines Menschen können zutage treten und in der Gegenwart mit vergangenen und aktuellen Aspekten des/der Anderen interagieren. Aufgrund der Komplexität dieses intersubjektiven Raums muss eine beziehungsorientierte ForscherIn sich mit der Reflexivität befassen, einer Aufmerksamkeit, die sich ihrer selbst und der Forschungsdynamiken und -prozesse bewusst ist. Wir raten zu einer SupervisorIn, die die ForscherIn in ihrer kritischen Reflexion unterstützt und herausfordert.
Es gibt kein einfaches Buch mit Regeln und Techniken, um ein bestimmtes Forschungsprojekt durchzuführen oder ein bestimmtes Thema einer KlientIn zu erforschen. Diese vier Aspekte der beziehungsorientierten Forschung sind jedoch in geringerem oder größerem Ausmaß bei allen beziehungsorientierten Forschungsprojekten präsent, wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung.5 Die Präsenz der ForscherIn ist wesentlich, um die immens wichtige Forschungsbeziehung aufzubauen und verlangt nach körperlichem und emotionalem Engagement, Rezeptivität und Transparenz.
In ihrer Version der Reflective Lifeworld Research entwickeln Dahlberg, Dahlberg und Nystrom (2008) die Idee der Rezeptivität. Sie fordern die ForscherIn auf, eine »offene, entdeckende Art zu sein« anzunehmen und eine »Fähigkeit, sich überraschen zu lassen und dem Unvorhersagbaren und Unerwarteten mit Sensibilität zu begegnen« zu entwickeln (ebd., 98 [Übers. a. J.]). Wertz (2005) wendet diese Ideen auf den Prozess der Einklammerung (Epoche) in der phänomenologischen Forschung an, wobei er postuliert, dass die ForscherIn versuchen muss, sich ganz auf die Situation der TeilnehmerIn einzulassen und »die beschriebene Situation auf langsame, meditative Weise auszukosten und sich all den Details zu widmen, ja, sie sogar hervorzuheben« (ebd., 172, [Übers. a. J.]).
Es ist unser »intersubjektiver Erfahrungs-Horizont, der uns Zugang zu den Erfahrungen anderer ermöglicht« (ebd., 168). In diesem intersubjektiven Zusammenhang (Kontext) gibt es ein »wechselseitiges Eingelassensein und Verflochtensein« von Anderen in uns und von uns in sie (Merleau-Ponty 1968, 182). Diese Verflechtung geschieht auf sichtbare und auf versteckte Weise, da eigene Aspekte mit Teilen des/der Anderen interagieren und mit ihnen verschmelzen. Ein Weg, diese komplizierten Verknüpfungen zu verstehen, im Zuge deren wir aufeinander auf vielen Ebenen reagieren, ist, sich die vielfachen, interagierenden Subjektivitäten, die präsent sind, bewusst zu machen. DeYoung beschreibt diese Beziehungs-Verknüpfungen als »dicht bevölkerte« Begegnungen (DeYoung 2003 [Übers. a. J.]).
Jeder und jede von uns bringt seine/ihre einmalige Art, in der Welt zu sein,6 in die Forschungsbegegnung ein. Sie entstammt der persönlichen Geschichte, die Alter, Geschlecht, Ethnie und Persönlichkeit umfasst (Evans / Gilbert 2005). Dieses In-der Welt-Sein formt die Wahrnehmung von Ereignissen und beeinflusst die beziehungsorientierte Begegnung (Stolorow / Atwood 1992). Die kritische Reflexion darüber, wie die ForscherIn und die Forschungsbeziehung sowohl den Forschungsprozess als auch die Ergebnisse beeinflussen können (Finlay / Gough 2003), ist das wesentliche Thema. Wenn die Subjektivität und die Intersubjektivität der ForscherIn durch Reflexivität in den Vordergrund geholt werden, fangen sie an zu trennen, was eher zur ForscherIn gehört als zum Forschungsgegenstand.
Als GestalttherapeutIn werden Sie bei der Lektüre dieses Kapitels den Wert und die Bedeutung der Reflexivität natürlich zu würdigen wissen. Und Sie werden sich auch bewusst sein, wie wertvoll Supervision bei dem Versuch sein kann, einige der komplizierten subjektiven und intersubjektiven Themen zu entwirren, die die Therapie erheblich beeinflussen könnten. Dasselbe trifft auf den Forschungsprozess zu. Wir sind der Ansicht, dass beziehungszentrierte Forschung idealerweise sowohl durch akademische Supervision als auch durch eine Supervision des Forschungsprozesses begleitet wird (Evans 2007).