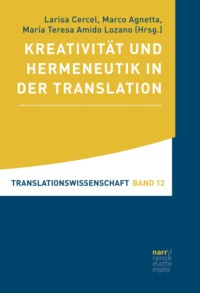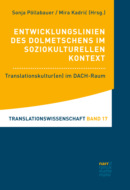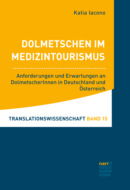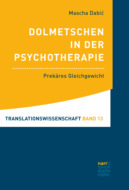Kitabı oku: «Kreativität und Hermeneutik in der Translation», sayfa 5
5 Zusammenfassung und weiterführende Gedanken
5.1 Eine kontinuierliche Tradition des Literaturübersetzens von Cicero über Bruni, Herder und Schlegel bis in die Gegenwart besteht in der rhetorischen Tradition, den literarischen Text als synthetische Einheit aus elocutio und darin suggerierter actio/pronuntiatio zu lesen. Dieser psychophysische Textbegriff (Kohlmayer 1997), der in Novalis’ „schriftlicher Stimme“ (Novalis 1976: 64) am prägnantesten formuliert wurde, ist in der jungen Übersetzungswissenschaft des 20. Jahrhunderts durch den Zerebralismus der vorherrschenden Theorien (Strukturalismus, Funktionalismus, Kognitivismus) verlorengegangen, gehört aber nach wie vor zum impliziten Wissen der Schriftsteller und guten Literaturübersetzer (vgl. Kohlmayer 2002). Eine realitätsnahe Theorie des Literaturübersetzens sollte für die Arbeitsweise der guten Literaturübersetzer empfänglich und relevant sein und kann vermutlich nur aus der Zusammenarbeit von Forschenden und Literatur-Übersetzenden entstehen (Buschmann 2015: 181f.).
5.2 Die in der jungen Übersetzungswissenschaft derzeit propagierte und registrierte Kreativität hat mit der mimetischen Kreativität des Literaturübersetzens wenig gemeinsam, da jene nur als punktuelles Textproblem identifiziert wird, während beim Literaturübersetzen die kreative Aufgabe in der ästhetischen Neugestaltung der gesamten elocutio samt actio/pronuntiatio besteht. Die translatorische Mimesis ist ein permanenter Zwang zur Kreativität; sie ist die Kunst der „geistigen Mimik“ (Novalis 1976: 115), und zwar eine gelehrte Kunst, da sehr viel sprachliches, ästhetisches und kulturelles Wissen dazu gehört (vgl. Kohlmayer/Pöckl 2004a).
5.3 Die „Angemessenheit“ oder „Akzeptabilität“ des kreativen Einfalls, die bei punktuellen Untersuchungen von Kreativität neben der „Neuheit“ als zweitwichtigstes Merkmal der Kreativität gilt (Kußmaul 2007: 17; Bayer-Hohenwarter 2012: 12),1 richtet sich bei der Übersetzung eines literarischen Textes nach der mimetischen Nähe zum Original. Wenn eine Übersetzerin eines literarischen Werkes sich auf ihre Verantwortung gegenüber irgendeiner Autorität außerhalb des Textes stützt (Religion, Ideologie, Politik, Publikum, Usus usw.), um ‚kritische‘ Passagen stillschweigend zu unterschlagen oder abzuschwächen, so führt diese Manipulation, wenn sie entdeckt wird, früher oder später unweigerlich zur Kritik durch die weltliterarische Öffentlichkeit, die unter dem Qualitätstitel ‚Übersetzung‘ immer die möglichst ehrliche Übermittlung der Originalstimme, nicht aber Bevormundung oder selbstständige Autorschaft erwartet.2 Die literarische Übersetzungskritik ist eine Aufgabe weniger der Übersetzungswissenschaft als der Literaturübersetzer selbst oder der mehrsprachigen Schriftsteller. Der gelehrten Kunst des Literaturübersetzens kann nur eine gelehrte Kunstkritik gerecht werden (vgl. Luhmann 1995: 462ff.).
5.4 Literaturübersetzer brauchen erhebliche sprachliche und literarische Kenntnisse. Dennoch lernt man das mimetische oder kreative Übersetzen, musische Begabung vorausgesetzt, (bisher) am sichersten durch das Vorbild guter Literaturübersetzer. Das macht die Selbstaussagen von Literaturübersetzern und das Studium ihrer Arbeitsweise so wertvoll. Die Ausbildung literarischer Übersetzer sollte gelehrten Könnern anvertraut werden, von denen natürlich auch die ‚normale‘ Übersetzerausbildung punktuell profitieren könnte, da Stil im Sinne der Rhetorik auch in nicht-literarischen Texten eine wichtige Rolle spielen kann.
5.5 Die Frage nach der Art, wie ein Text laut gelesen werden sollte („die schriftliche Stimme“), führt in den Kern der Frage, wie ein literarischer Text übersetzt werden sollte. Sprach- und kulturspezifische Hinweise auf die dem Text eingeschriebene Performanz ergeben sich einmal aus den Satzzeichen, die als rhetorische Markierungen zu verstehen sind, und aus den unterschiedlichen akustisch-semantischen Signalen, angefangen von den Grad- und Abtönungspartikeln bis zu den feinsten lexikalischen Nuancierungen (vgl. Kohlmayer 2004b). Es geht beim Lesen um Spuren-Lesen. Bei literarischen Texten gilt: Sag mir, wie du liest, und ich sage dir, wie du verstehst und übersetzt. Literatur ist der Versuch, mit allen Mitteln der Schriftlichkeit interessante menschliche Stimmen hörbar zu machen, auch über Jahrhunderte hinweg. Jedes literarische Buch ist ein „mündliches Buch“ (Novalis 1957: 340) und sollte in der Übersetzung ein Hör-Buch bleiben. Die individuelle akustische Form soll in der anderen Sprache „vivifiziert“ werden (Vgl. Fußnote 28).
5.6 Um die schriftliche Stimme aus einem Text herauszuhören, braucht der Leser laut Nietzsche, dem großen Meister und Theoretiker der Rhetorik, das „dritte Ohr“:
Welche Marter sind deutsch geschriebene Bücher für den, der das dritte Ohr hat! Wie unwillig steht er neben dem langsam sich drehenden Sumpfe von Klängen ohne Klang, von Rhythmen ohne Tanz, welcher bei Deutschen ein „Buch“ genannt wird! Und gar der Deutsche, der Bücher liest! Wie faul, wie widerwillig, wie schlecht liest er! Wie viele Deutsche wissen es und fordern es von sich zu wissen, daß Kunst in jedem guten Satze steckt – Kunst, die erraten sein will, sofern der Satz verstanden sein will! […] Man hat zuletzt eben „das Ohr nicht dafür“: und so werden die stärksten Gegensätze des Stils nicht gehört, und die feinste Künstlerschaft ist wie vor Tauben verschwendet. (Nietzsche 1958: 713; vgl. dazu Kohlmayer 1996: 75f.)
Vielleicht wird dieses innere Ohr für die Stimme im Text am effizientesten durch gut gelesene und bewusst gehörte Hörbücher geschult? Offensichtlich sind die universitären Hör-Säle bisher wenig auf lebendige Rhetorik eingestellt. Und die wachsende Digitalisierung scheint auch eher dem Zerebralismus zu huldigen, als die mündliche und schriftliche Stimme zu pflegen. Wenn die Übersetzungswissenschaft für das Literaturübersetzen fruchtbar werden will, muss sie noch viel von der Rhetorik lernen.
Bibliographie
Albrecht, Jörn (1998): Literarische Übersetzung. Geschichte – Theorie – Kulturelle Wirkung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Albrecht, Jörn (2005): Übersetzung und Linguistik. Tübingen: Gunter Narr.
Bayer-Hohenwarter, Gerrit (2012): Translatorische Kreativität. Definition, Messung, Entwicklung. Tübingen: Narr.
Breitling, Andris (2015): „Sprachliche Kreativität und Gastfreundschaft. Bedingungen der Möglichkeit des Übersetzens“. In: Buschmann (Hrsg.), 85–107.
Buschmann, Albrecht (Hrsg.) (2015): Gutes Übersetzen. Neue Perspektiven für Theorie und Praxis des Literaturübersetzens. Berlin / Boston: de Gruyter.
Buschmann, Albrecht (2015): „Von der Problemforschung zur Ermöglichungsforschung. Sieben Vorschläge für eine praxisorientierte Theorie des Übersetzens“. In: ders. (Hrsg.), 177–190.
Cercel, Larisa / Stanley, John (Hrsg.) (2012): Unterwegs zu einer hermeneutischen Übersetzungswissenschaft. Tübingen: Narr.
Cercel, Larisa / Şerban, Adriana (eds.) (2015): Friedrich Schleiermacher and the Question of Translation. Berlin / Boston: de Gruyter.
Eggers, Michael (2003): Texte, die alles sagen. Erzählende Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts und Theorien der Stimme. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Fix, Ulla / Gardt, Andreas / Knape, Joachim (Hrsg.) (2008) : Rhetorik und Stilistik. Rhetoric and Stylistics (= HSK 31.1). Berlin / New York: de Gruyter.
Floßdorf, Bernhard (1978): Kreativität. Bruchstücke einer Soziologie des Subjekts. Frankfurt am Main: Syndikat.
Gil, Alberto (2012): „Mimesis als rhetorisch-translatorische Größe.“ In: Cercel/Stanley (Hrsg.), 153–168.
Gover, Robert (1961/2005): One Hundred Dollar Misunderstanding. Titusville, NJ: Hopewell.
Gover, Robert (1965): Ein Hundertdollar Mißverständnis. Roman. Deutsch von Hans Wollschläger. Reinbek: Rowohlt.
Heibert, Frank (2015): „Wortspiele übersetzen. Wie die Theorie der Praxis helfen kann.“ In: Buschmann (Hrsg.), 217–240.
Herder, Johann Gottfried (1796): Briefe zu Beförderung der Humanität. Achte Sammlung. Riga: Johann Friedrich Hartknoch.
Hermans, Theo (1996): “The Translator’s Voice in Translated Narrative”. In: Target 8/1, 23–48.
Knape, Joachim (2000): Was ist Rhetorik? Stuttgart: Reclam UB.
Knape, Joachim (2008): „Rhetorik der Künste“. In: Fix/Gardt/Knape (Hrsg.), 894–927.
Kohlmayer, Rainer (1988): „Der Literaturübersetzer zwischen Original und Markt. Eine Kritik funktionalistischer Übersetzungstheorien.“ In: Lebende Sprachen 33, 145–156.
Kohlmayer, Rainer (1996): Oscar Wilde in Deutschland und Österreich. Untersuchungen zur Rezeption der Komödien und zur Theorie der Bühnenübersetzung. Tübingen: Niemeyer.
Kohlmayer, Rainer (1997): „Was dasteht und was nicht dasteht. Kritische Anmerkungen zum Textbegriff der Übersetzungstheorie“. In: Fleischmann, Eberhard / Kutz, Wladimir / Schmitt, Peter A. (Hrsg.): Translationsdidaktik. Tübingen: Gunter Narr, 60–66.
Kohlmayer, Rainer (2002): „Die implizite Theorie erfolgreicher Literaturübersetzer. Eine Auswertung von Interviews“. In: Rapp, Reinhard (Hrsg.): Sprachwissenschaft auf dem Weg ins dritte Jahrtausend. Teil II: Sprache, Computer, Gesellschaft. Frankfurt a. M. u. a.: Peter Lang, 331–339.
Kohlmayer, Rainer / Pöckl, Wolfgang (Hrsg.) (2004a): Literarisches und mediales Übersetzen. Aufsätze zu Theorie und Praxis einer gelehrten Kunst. Frankfurt a. M.: Peter Lang.
Kohlmayer, Rainer (2004b): „Literarisches Übersetzen: Die Stimme im Text“. In: DAAD (Hrsg.): Germanistentreffen Deutschland – Italien, Bari 2003. Tagungsbeiträge. Bonn: DAAD, 465–486.
Kohlmayer, Rainer (2010a): „Drama und Dramenübersetzung: Theatrale Infrastruktur und kulturelle Stereotype als Transferblockaden“. In: Mengel, Ewald / Schnauder, Ludwig / Weiss, Rudolf (Hrsg.): Weltbühne Wien / World-Stage Vienna. Vol. I: Approaches to Cultural Transfer. Trier: WVT, 143–172.
Kohlmayer, Rainer (2010b): „Dramenübersetzung als Stimmenimitation. Der Umgang der Übersetzer mit Mündlichkeitssignalen“. In: Sommerfeld, Beater / Kęsicka, Karolina (Hrsg.): Identitätskonstruktionen in fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten. Übersetzung und Rezeption. Frankfurt am Main: Peter Lang, 35–52.
Kohlmayer, Rainer (2011): „‘Üb’ersetzen!‘ Sprachspiele als Übersetzungsproblem“. In: Kamburg, Petra / Spicker, Friedemann / Wilbert, Jürgen (Hrsg.): Gedanken-Übertragung. Bochum: Universitätsverlag Brockmeyer, 27–38.
Kohlmayer, Rainer (2012): „Rhetorik und Theorie der Literaturübersetzung. Überlappungen und Differenzen“. In: Cercel/Stanley (Hrsg.), 131–152.
Kohlmayer, Rainer (2014): „Kleines ABC des Literaturübersetzens“. In: Die Schnake 39/40, 1–44.
Kohlmayer, Rainer (2015a): „Die Stimme im Text als tertium comparationis beim Literaturübersetzen“. In: Stolze, Radegundis / Stanley, John / Cercel, Larisa (Hrsg.): Translational Hermeneutics. The First Symposium. Bukarest: ZETA Books, 235–257.
Kohlmayer, Rainer (2015b): „‘Das Ohr vernimmts gleich und hasst den hinkenden Boten‘ (Herder). Kritische Anmerkungen zu Schleiermachers Übersetzungstheorie und ‑praxis“. In: Cercel, Larisa / Şerban, Adriana (Hrsg.): Friedrich Schleiermacher and the Question of Translation. Berlin / Boston: de Gruyter, 107–126.
Kohlmayer, Rainer (2016): „Charmante Emanzen. Entdeckungen bei der Übersetzung von Pierre Corneilles Jugendkomödien“. In: Sommerfeld, Beate u.a. (Hrsg.): Transgressionen im Spiegel der Übersetzung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Maria Krysztofiak-Kaszyńska. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 39–64.
Kopetzki, Annette (2015): „Praxis und Theorie des literarischen Übersetzens: Neue Perspektiven“. In: Buschmann (Hrsg.), 69–84.
Kußmaul, Paul (2000, 22007): Kreatives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.
Levý, Jiří (1969): Die literarische Übersetzung: Theorie einer Kunstgattung. Frankfurt am Main / Bonn: Athenäum.
Luhmann, Niklas (1995): Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Nietzsche, Friedrich (1958): Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. In: ders.: Werke in drei Bänden. Hrsg. von Karl Schlechts. München: Hanser. Zweiter Band, 563–759.
Nord, Christiane (2011): Funktionsgerechtigkeit und Loyalität. Die Übersetzung literarischer und religiöser Texte aus funktionaler Sicht. Berlin: Frank & Timme.
Novalis (1957): Fragmente I. Werke / Briefe / Dokumente. Bd. 2. Hrsg. von Ewald Wasmuth. Heidelberg: Lambert Schneider.
Novalis (1976): Dichter über ihre Dichtungen. Novalis. Bd. 15. Hrsg. von Hans-Joachim Mähl. Passau: Heimeran.
Pym, Anthony (2007): “Philosophy and Translation”. In: Kuhiwczak, Piotr / Littau, Karin (eds.): A Companion to Translation Studies. Clevedon etc.: Multilingual Matters, 24–44.
Rener, Frederick M. (1989): Interpretatio. Language and Translation from Cicero to Tytler. Amsterdam / Atlanta: Rodopi.
Ritter, Joachim / Gründer, Karlfried (Hrsg.) (1976): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Schanze, Helmut (2008): „Rhetorik und Stilistik der deutschsprachigen Länder von der Romantik bis zum Ende des 19. Jahrhunderts“. In: Fix/Gardt/Knape (Hrsg.), 131–146.
Schiewe, Jürgen (1998): Die Macht der Sprache. Eine Geschichte der Sprachkritik von der Antike bis zur Gegenwart. München: Beck.
Schlegel, August Wilhelm (1962): Sprache und Poetik. Kritische Schriften und Briefe I. Hrsg. von Edgar Lohner. Stuttgart: Kohlhammer.
Schlegel, Friedrich (1980): Werke in zwei Bänden. Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag.
Shakespeare, William (1995): Hamlet. Zweisprachige Ausgabe. Deutsch von Frank Günther. Mit einem Essay von Manfred Pfister. München: dtv klassik.
Siever, Holger (2015): „Schleiermacher über Methoden, Zweck und Divination“. In: Cercel/Şerban (eds.), 153–172.
Stolze, Radegundis (1992): Hermeneutisches Übersetzen. Linguistische Kategorien des Verstehens und Formulierens beim Übersetzen. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Stroiṅska, Dorota (2015): „Sinn und Sinnlichkeit. Warum literarisches Übersetzen eine Kunst ist“. In: Buschmann (Hrsg.), 137–152.
Vermeer, Hans J. (31992): Skopos und Translationsauftrag – Aufsätze. Frankfurt am Main: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation.
Wilde, Oscar (1983): Two Society Comedies. A Woman of No Importance. Ed. by Ian Small. An Ideal Husband. Ed. by Russell Jackson. London: New Mermaids.
Wilde, Oscar (1986): Ein idealer Ehemann. Neu übersetzt von Hans Wollschläger. Zürich: Haffmans Verlag.
Wright, Chantal (2016): Literary Translation. New York: Routledge.
Interpretation and Creativity in the Translation of Paul Celan
Jean Boase-Beier (Norwich)
Abstract: We might expect the translation of Holocaust poetry, since it arose from real historical events, to be concerned above all with accuracy, leaving little scope for creativity on the translator’s part. I argue that this is not so, however. For Holocaust poetry is not a document or an account, it is a poetic expression. Translators therefore need to read the text creatively, as poetry, being open to its poetic effects and also considering how they come about. While we can often find stylistic characteristics common to Holocaust poetry, and it makes sense to say that these originate from what we might want to call “Holocaust poetics”, poets have their own poetics. Paul Celan’s poetics arose in part from his multilingual background and his own personal experience of the Holocaust. Especially his later poetry expresses the state of mind of a speaker who is traumatised by events, and suffers feelings of guilt and inertia. The poem “Mit Äxten spielend” is one such poem. I show that, by examining its style, including particular uses of repetition and ambiguity, and of the etymological connections between words (in German and beyond) the translator can get a sense of the poetics driving the poem, and can imaginatively reconstruct the state of mind of its speaker. Translation that thus creatively engages with the original poem and the poetics behind it can hope to give the new readers not only a sense of the poetics of the original but also the possibility of creative engagement with the translated poem.
Keywords: Paul Celan, Holocaust poetry, translation, poetics, creative reading.
1 The Role of Interpretation and Creativity
When we consider translation, “interpretation” and “creativity” might intuitively seem almost to be opposites. Surely, when we interpret what a text says, we are trying to get as close as possible to what was meant? And when we write a new text based on our interpretation, accuracy, not creativity, is what is needed, we might think.
What I intend to argue in this contribution is that, in the translation of literary texts, and especially of poetry, it is never simply a question of accuracy, but rather that accuracy and creativity go hand-in-hand, both in the reading of the original text and in the writing of the translation. This is so because poetry, even more than other literary forms, works by engaging its readers and encouraging them to think, to reflect, to re-think and to change their view of the world. There have been many studies that emphasise this aspect of our reading (see e. g. Richards 1960: 43; Oatley 2011), and I have argued elsewhere (Boase-Beier 2015: 71–72; and see also Attridge 2004: 79–83) that these reading processes are themselves creative. It has also been noted by many translation scholars working on or within the hermeneutic approach (cf. Venuti 2012: 485) that is often traced back to Schleiermacher’s famous 1813 talk “Ueber die verschiedenen Methoden des Übersetzens” (On the different methods of translating) (see Schleiermacher 2012), that “the problem of translation is the problem of understanding” (Hermans 2007: 135), and that understanding involves individuals and their own context and background, especially in literary translation (see, for example, Stolze 1994: 181–212; 2011: 9; 2015). According to Siever, Schleiermacher, whose concern with creativity needs to be understood as part of the early Romantic tradition in German writing (Siever 2015: 154–156), was the first theorist to emphasise the creativity of literary translation.
But translating poetry does not only involve creative reading of the source text and creative re-writing to produce a target text. It also involves understanding and reconstructing the creative processes of the poet that have resulted in a work with which readers can fully engage. These poetic creative processes stem from what we might call the “poetics” of a particular writer, that is, the particular way of creating poetry peculiar to that writer, manifested in the style we see in the poems in question. The reader (whether a translator or not) has no direct access to a poet’s mind or the poetics that arises from that mind, but reading a text in order to translate it could be said to involve an imaginative reconstruction of these mental states and processes which has its basis in close, analytical reading (see Boase-Beier 2015: 14–15). Reading for translation involves paying particular attention to what has been referred to as mind-style (see Fowler 1977: 103), that is, the way the style of a text reflects the state of mind that informed it. Especially in the case of a poet like Celan, whose background was multilingual (see Boase-Beier 2015: 91f.), we would expect the translator to go beyond the non-translating reader, and also beyond the critic who is not considering translation, in that an inevitable part of the way a translator reads is to consider what might happen to linguistic, stylistic and poetic forms, such as metaphors, images, ambiguities and repetitions, when they cross a language boundary. In fact, as Siever (2015: 168) points out, Schleiermacher noted that part of the interpretation (and therefore also the translator’s interpretation) of a text involves exactly this consideration of the prospective new text, and its potential effects on the language it will become part of (see Schleiermacher 2012: 54). The translator’s reading is thus a particularly engaged type of reading (see Boase-Beier 2015: 87–101), and, it could be argued, a type of reading especially appropriate to Celan’s poetry, which, according to Derrida, embodies an awareness of German as a language “to struggle with” (Derrida 2005: 100). This awareness in part arose from Celan’s knowledge of the fatal consequences of striving for linguistic purity in Nazi Germany (see, for example, Klemperer 2015). Derrida argues that Celan’s poetics already contains a sort of translation from standard German to “a kind of new idiom” (Derrida 2005: 100). Though Derrida mistakenly assumes that German was not Celan’s native language, he was right to recognise the multilingual context of Celan’s poetics. In fact, Celan wrote in the immediate aftermath of the war in both Romanian and German (see Cassian 2015). For Celan’s translators, it is first and foremost necessary to understand the sources of his creative engagement with the German language: his poetics.
Translation also involves reflecting something of these creative processes and the poetics that gave rise to them in the translated poem, and this is only likely to be possible if translation itself is seen by the translator as a creative process. The end result, if one considers poetic translation in this way, is a translated poem which can do far more than accurately reflect the original. It has its own poetics, so it allows its new readers to engage creatively with it. That is, it allows readers to think, to reflect, to re-think, to change their views of the world, just as the original poem did. If I read a Celan poem translated by Michael Hamburger, for example, I can only engage with it fully if I know it is a poem written by Hamburger that translates a poem written by Celan. The reading process is different because not only is the work different but so is the reading context, and the background knowledge against which it is read, that is, the cognitive context of the reader. The reader needs to be aware of this difference. If translation is the type of writing that ensures the survival of the text, because a text, as Walter Benjamin said, has an inherent characteristic of “translatability” (Benjamin 2012: 76), then such survival is only possible if new readers can engage fully with the translated text, thus allowing the original text “to exceed its own limitations” (Brodzki 2007: 2).