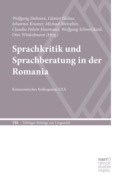Kitabı oku: «Seitenblicke auf die französische Sprachgeschichte», sayfa 12
Sprachwissenschaftsgeschichte
Die Sprachauffassung von Julien Offray de La Mettrie in seinem Traktat L’homme machine (1748)
Roger Schöntag
Cette contribution est consacrée aux aspects linguistiques de l’œuvre du médecin et philosophe Julien Offray de La Mettrie (1709–1751). Comme cet érudit du siècle des Lumières a été souvent réduit à ses positions provoquantes, c’est-à-dire à son athéisme, à son hédonisme et à son matérialisme, et ne fut par conséquence pris en compte que relativement tard dans l’histoire de la philosophie, il est assez mal connu pour ses idées linguistiques. La présente étude examine les différents domaines thématiques de sa réflexion linguistique qu’on trouve surtout dans son œuvre principale L’homme machine (1748), et les replace dans le contexte de la philosophie du langage de l’époque.
1 Zielsetzung
Der vorliegende Beitrag über den Arzt und Philosophen Julien Offray de La Mettrie (1709–1751), der in der Philosophiegeschichte erst relativ spät entsprechend gewürdigt wurde und in der sprachwissenschaftlichen Rezeption bisher nur punktuell Beachtung fand,1 soll einen ersten größeren Gesamtüberblick über die von ihm herausgearbeiteten Aspekte der Sprachreflexion liefern und diese vor dem Hintergrund seiner radikalen Aufklärungsphilosophie und den zeitgenössischen sprachphilosphischen Positionen verorten. Das zentrale Werk hierzu ist die Abhandlung L’homme machine (1748), doch werden auch andere Traktate aus seinem Œuvre, in denen sich einige Anklänge zu seinen Überlegungen zur Sprachursprungstheorie, der Verknüpfung von Sprache und Denken oder Sprache und Gesellschaft ausmachen lassen, Berücksichtigung finden.2
2 Biographischer Hintergrund
Julien Offray de La Mettrie (1709–1751) wird als Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie (Textilgewerbe) in St. Malo in der Bretagne geboren. Er besucht die Collèges von Coutances und Caen (Jesuitenschule), an denen er erste geisteswissenschaftliche Grundlagen lernt (Rhetorik, etc.). Um diese erste Studien abzuschließen, geht er nach Paris, wo er in den Humanités einen bachelier (bzw. maître-ès-arts) am Collège d’Harcourt macht (1726/1727). Anschließend an seine Ausbildung in nimmt er ein Studium der Philosophie/Theologie am Collège du Plessis auf,1 da er von seinen Eltern für die klerikale Laufbahn vorgesehen ist. Er bricht jedoch das Philosphiestudium bald ab und wechselt zur medizinischen Fakultät von Paris und beendet dieses Studium dann 1733 mit einem bachelier; den Doktortitel (thèse de médecine) erwirbt er jedoch in Rennes (cf. Vartanian 1960:1–2; Baruzzi 1968:175; Christensen 1996:245–246; Laska 2004:VIII).2
Da er die medizinische Ausbildung an Frankreichs Universitäten für ungenügend erachtet (cf. Mensching 2008:508), studiert er weiter, und zwar in den Niederlanden bei der europaweit anerkannten Koryphäe Herman Boerhaave (1668–1738) in Leiden (Leyden), der ihm zum wichtigsten Lehrer wird. La Mettrie schreibt in der Folgezeit einige medizinische Abhandlungen (z.B. Dissertation sur les maladies vénériennes, 1735) und übersetzt das Werk Boerhaavens aus dem Lateinischen ins Französische (Système de M. Herman Boerhaave, 1735). Von 1734 bis 1742 praktiziert er als Arzt in seiner Heimatstadt, auch in den dortigen Krankenhäusern (Hôpital Générale von Saint-Servan und Hôtel-Dieu von St. Malo; cf. Lemée 1954:21), wo er gegen die Cholera kämpft und selbst befallen wird (1741). Er heiratet und gründet eine Familie (mit Marie-Louise Droneau, 1739),3 doch Ende 1742 geht er zurück nach Paris und nimmt eine Stellung als médecin domestique beim Duc de Grammont (Colonel des Gardes Françaises) an und begleitet ihn als Sanitätsoffizier in die Schlachten des österreichischen Erbfolgekrieges (cf. Becker 1990:VIII; Christensen 1996:247–249; Laska 2004:X-XI).
La Mettrie kehrt nach dem Tod des Herzogs 1745 nach Paris (und St. Malo) zurück und arbeitet als Medizininspekteur von Armeespitälern; in seinen Schriften wendet er sich philosophischen Themen zu bzw. versucht seine medizinischen Kenntnisse in allgemeine philosophische Betrachtungen einzubringen. Sein erstes philosophisches Werk, die Histoire naturelle de l’âme (1745), welches er unter dem Eindruck eines fièvre chaude verfasste – so die wohl „anekdotische Rekonstruktion“ (Christensen 1996:250) –, wird beschlagnahmt und verbrannt, seine polemische Schrift Politique du médecin de Machiavel (1746) des Folgejahres, in der er die Missstände in der französischen Medizin anprangert, wird ebenfalls verbrannt und einer drohenden Verhaftung kann er nur durch seine Flucht nach Holland entgehen. Dort findet er vorübergehend Geldgeber und schreibt neben der satirischen Komödie La faculté vengée (1747) gegen die Pariser Ärzteschaft sein wichtigstes Werk, L’homme machine (1747, vorausdatiert auf 1748). Aufgrund der Radikalität der dort vertretenen Ansichten, die selbst den liberalen Holländern zu weit geht, wird sein Verleger, Elie Luzac (1721–1726), verhaftet, La Mettrie sieht sich genötigt sein Werk zu verleugnen und muss 1748 mit Hilfe Luzacs wiederum fliehen (cf. Becker 1990:VIII-IX; Christensen 1996:251–255).
Er nimmt die Einladung seines Landsmannes Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759) aus St. Malo, der Präsident (1746–1759) der Königlichen Akademie der Wissenschaften (Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres) in Berlin ist,4 an und begibt sich auf dessen Vermittlung hin an den Hof Friedrich II. von Preußen (geb. 1712; Kg. 1740–1786) nach Potsdam. Von 1748 bis zu seinem Tod 1751 bleibt er am Hofe Friedrichs, wird dessen Arzt, Gesellschafter und Vorleser sowie Mitglied der Akademie und verfasst weitere philosophische und polemische Schriften: u.a. L’homme plante (1748), Discours sur le bonheur (1748) als Einleitung einer Seneca-Übersetzung (Anti-Sénèque) getarnt, Les animaux plus que machines (1750), L’art de jouir ou l’école de la volupté (1751), Le petit homme à longue queue (1751), Œuvres philosophiques (1750, vorausdatiert auf 1751). Die Radikalität seiner Schriften, insbesondere des Anti-Sénèque, in Bezug aufReligion (Atheismus), Moral (sexuelle Freizügigkeit) und Politik (Herrscherkritik) bringen Friedrich dazu, 1749 die von ihm im Sinne der Aufklärung abgeschaffte Zensur wieder einzuführen (Edict wegen der wieder hergestellten Censur); er wirft 10 Exemplare des letztgenannten Werkes La Mettries eigenhändig ins Feuer (cf. Laska 2004:XIII), hält aber persönlich weiterhin an ihm fest.5 Im Jahre 1751 stirbt La Mettrie, wohl an einer verdorbenen Fleischpastete.6 Friedrich II. hält trotz der Differenzen, die er mit La Mettrie hatte, anläßlich seines Todes eine konziliante Lobrede (Eloge de La Mettrie, 1752), in der er ihn als honnête homme, âme pure, eloquenten und unterhaltsamen Zeitgenossen sowie als savant médecin würdigt, weniger jedoch als Philosophen (cf. Christensen 1996:255–268; Mensching 2008:509).7
3 Philosophische und geistesgeschichtliche Verortung
Um La Mettries philosophische Haltung zu verstehen, ist es zunächst vonnöten seine Stellung innerhalb der medizinischen Wissenschaften zu betrachten, die die Basis für seine späteren radikalen Ansichten darstellt.
Sein medizinischer Lehrer Herman Boerhaave, dem er nach eigenen Aussagen seinen eigentlichen Erkenntnisfortschritt in der Kunst der Medizin verdankte – d.h. implizit nicht dem medizinischen Studium in Frankreich – und dessen Werke er ins Französische übersetzte, stand der iatrophysikalischen Lehre nahe. Diese hängt mit der Entdeckung des Blutkreislaufes zusammen und versucht die physischen Vorgänge des menschlichen Körpers zu messen und physikalisch zu erklären, d.h. der lebendige Körper wird als eine Konstruktion wahrgenommen, welche auf mechanischen Abläufen beruht, eben als eine Maschine. Ähnlich wie auch die Iatrochemie, die die Funktionen des Körpers durch die in ihm ablaufenden chemischen Vorgänge zu erklären versucht, handelt es dabei um einen materialistischen Erklärungsansatz. Dabei ist ‚materialistisch‘ hier so zu verstehen, dass man sich ausschließlich auf diemessbaren Veränderungen des Körpers stützt; Ursachen und erste Prinzipien werden hingegen unberücksichtigt gelassen (cf. Christensen 1996:21).
Von Boerhaave übernimmt La Mettrie nicht nur die materialistische iatrophysikalische Grundhaltung, sondern auch seinen Eklektizismus und die Ablehnung eines alles erklärenden einheitlichen Systems. Hier stehen sowohl Boerhaave als auch später La Mettrie im Gegensatz zu René Descartes (1596–1650), der seine Philosophie auf grundlegenden Prinzipien aufbaut. La Mettrie folgte Boerhaave auch dahingehend, dass dieser die Medizin als eine fachübergreifende Disziplin betrachtete und neben der Klinischen Medizin auch Botanik und Chemie unterrichtete sowie die Praxis der Anwendung am Patienten selbst und dabei auch chirurgische und anatomische Kenntnisse erwartete. Gerade letzteres ist zu jener Zeit nicht selbstverständlich, da die Praktiker der Chirurgie und die Theoretiker der Medizin sich oft feindlich gegenüberstanden, da letztere die Deutungshoheit beanspruchten (cf. Christensen 1996:21–22).
La Mettrie geht aus diesem Studium in Leiden als jemand hervor, den man heutzutage als open-minded bezeichnen würde, was sich allein daran zeigt, dass er zum einen auf Französisch publiziert und sich damit vom elitären und hermetischen Latein seiner Kollegen bewusst absetzt und seine ersten medizinischen Arbeiten der allgemeinen Verbesserung des öffentlichen Gesundheitswesens und der medizinischen Aufklärung widmet (Le bien public); Adressaten waren dabei neben den medizinischen Kollegen auch Chirurgen und interessierte Laien: Lettres sur l’art de conserver la santé et de prolonger la vie (1734), Dissertation sur les maladies vénériennes (1735), Dissertation sur l’origine, la nature et la cure de ces maladies (1735) [Einl. zur Übersetzung v. Systéme de M. Hermann Boerhaave sur les maladies vénériennes], Traité du vertige (1737), Traité de la petite vérole (1740), Observations de médecine pratique (1743) (cf. Christensen 1996:22–24).
Zum anderen greift er auch in den in Frankreich tobenden Kampf zwischen Medizinern und Chirurgen ein (Höhepunkt 1724–1743), in dem es um die traditionelle Vormachtsstellung der Mediziner geht, die von den Chirurgen zunehmend in Frage gestellt wird. Er kritisiert dabei beide Seiten und plädiert im Gefolge von Boerhaave für ein Ineinandergreifen beider Wissensbestände.1 Dies kommt sowohl in seinen medizinischen Schriften zum Ausdruck, als auch konkret in Pamphleten (z.B. Saint Cosme vengée, 1744) und Satiren (z.B. La faculté vengée, 1747; Le chirurgien converti, 1748), in denen er die Hybris der Mediziner, die Eifersucht und Autonomieforderung der Chirurgen und die Zustände im Gesundheitswesen anprangert. Er plädiert vielmehr für eine stärkere Ausrichtung der Medizin an der Empirie, zugleich aber für die Stärkung der Grundlagenforschung; er kritisiert zudem die Trennung von Theorie und Praxis; d.h. Voraussetzung für einen guten Mediziner nach la Mettrie sind neben der eigenen Forschung und Beobachtung breite Kenntnisse in Anatomie, Botanik, Chemie, Physik, Mechanik und Chirurgie. Wichtig ist ihm dabei nicht so sehr die Suche nach den verborgenen Ursachen (causes cachées), sondern nach den mit Vernunft und Experiment fassbaren sekundären Ursachen (causes secondes) und die methodische Offenheit: „le meilleur système est de n’en point avoir“ (La Mettrie 1743:IV, o.pagin.) (cf. Christensen 1996:24–39).
Dieser medizingeschichtliche Hintergrund bildet die Grundlage des sich daraus entwickelnden philosophischen Gedankengebäudes La Mettries. Die wichtigsten Erkenntnisse fließen dabei in sein weiteres philosophisches Œuvre ein, und zwar vor allem die Systemoffenheit, die Betonung der Empirie und das materialistische Weltbild.
Bereits in seiner ersten rein philosophischen Schrift, der Histoire naturelle de l’âme (1745) – überarbeitet als Traité de l’âme in den Œuvres philosophiques (1751) – zeigen sich wesentliche Bestandteile seiner Denkrichtung. Dabei versteht er die im Titel des Werkes genannte Naturgeschichte als eine Naturbeschreibung, ganz im Sinne von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), der historia ebenfalls als observatio verstand. Grundlage der wissenschaftlichen Betrachtung ist bei La Mettrie demnach die Empirie, d.h. die auf Beobachtung begründete Erfahrung, so wie sie vor allem John Locke (1632–1704) in seinem Essay Concerning Human Understanding (1689) vertritt, der zwar auch ins Französische übersetzt wurde (1700 v. Pierre Coste), aber in erster Linie durch die Lettres philosophiques (1733) Voltaires2 (1694–1778) Verbreitung fand (cf. Becker 1990:IX; Christensen 1996:40–43; Klingen-Protti 2016:138).
La Mettries Kritik in seiner Histoire naturelle, in der er versucht ein naturwissenschaftliches Verfahren auf die Geisteswissenschaften zu übertragen, zielt auf den Rationalismus und die Metaphysik als Grundlage der Wissenschaften, wie sie bei Descartes formuliert ist. Er plädiert für einen philosophischen Neuanfang bei der die empirischen Naturwissenschaften, allen voran die Medizin, die Basis aller Wissenschaften bilden sollten. Dabei entwickelt La Mettrie einen an Locke orientierten Sensualismus, eine théorie de sensation, und zwar bereits ein Jahr vor Étienne Bonnot de Condillac (1714–1780) und seinem Essai sur l’origine des connoissances humaines (1746) und lange vor dessen Traité des sensations (1754).3
La Mettrie argumentiert folgendermaßen: Da nach Locke alle Ideen aus der Erfahrung stammen, müssen auch die Wissenschaften (und zwar alle) empirisch vorgehen, d.h., dass auch zur Erklärung philosophischer Fragen nur das der sinnlichen Wahrnehmung Zugängliche als Basis dienen dürfe, also nur Materielles. Die Materie ist demnach bei La Mettrie und seiner Kritik an spekulativen und metaphysischen Denksystemen ein zentrales Element. Das radikale an seiner Kritik ist, dass er damit die Behandlung der Seele aus der Theologie und Philosophie herausnimmt und der naturwissenschaftlichen Beschreibung zuführt,4 d.h. die Seele bzw. das, was sich an seelisch-geistigen Vorgängen im Menschen äußert, ist auch Materie und damit beschreibbar, woraus sich in letzter Konsequenz auch sein Atheismus ableitet. Außerdem erklärt dies sein Primat der Medizin, weil für ihn nur die empirische Beschreibung des Funktionierens des Menschen letztlich zu weiteren philosophischen Schlüssen berechtigt.5 Er argumentiert damit gegen Descartes (cf. Discours de la méthode, 1637; Meditationes de prima philosophia, 1641) und seine Unterscheidung einer res cogitans und einer res extensa, d.h. Materie ist für Descartes rein in Ausdehnung zu messen, da sie empfindungs- und bewegungslos ist (cf. Baruzzi 1968:24–29; Wellman 1992:169–170; Christensen 1996:47–55).
Für La Mettrie ist aus der Materie heraus sowohl Bewegung (puissance motrice) als auch Empfindung möglich (faculté de sentir), was in einen sensualistischen Materialismus mündet. Bezüglich der Seelenvermögen unterscheidet er dabei die âme végétative (Pflanzen, Tiere, Menschen), die âme sensitive (Tiere, Menschen) und die âme raisonnable (Menschen). Dabei ist ersteres Vermögen für Ernährung, Fortpflanzung und Wachstum zuständig, zweites für die durch Gehirn und Nervenbahnen gesteuerten Empfindungen und Wahrnehmungen und drittes schließlich für das Denk- und Urteilsvermögen.6 Er schafft damit ein Kontinuum der Lebewesen (Pflanzen, Tiere, Menschen).7 Der Begriff der ‚Maschine‘ bzw. des Menschen als Maschine wie ihn La Mettrie dann in L‘homme machine (1747/1748) entwickelt, rekurriert auf eben diese Vorstellung von der Materie (cf. Mensching 2008:509–510; Klingen-Protti 2016:139–140).
Für ihn ist folgerichtig der Mensch nichts weiter als organisierte Materie, eben komplexer organisierte als bei Pflanzen oder Tieren, aber nichtsdestoweniger reine Materie. Dies bedeutet auch eine Materialisierung der Seele und mündet in eine antimetaphysische Metaphysik.8 Er lehnt damit den Dualismus von Leib und Seele ab (cf. Descartes)9 sowie die grundsätzliche Willensfreiheit des Menschen, da die jeweiligen durch die organisierte Materie geschaffenen unterschiedlichen Dispositionen des Einzelnen ihn eher determinieren als ihn frei agieren lassen (cf. Becker 1990:XIII; Hausmann 2003:392).
Bereits die Materialisierung der Seele, die (fast) Gleichsetzung von Mensch und Tier (er betont das Kontinuum zwischen beiden) und die Einschränkung der Willensfreiheit des Menschen machen ihn für Kirche und Gesellschaft untragbar, was die Verbrennung seiner Schriften und die ihm drohenden Inhaftierungen erklärt. Dass er schließlich aus der sensualistischen und materialistischen Position heraus im Discours sur le bonheur (1750) und der L’art de jouir (1751) die Kunst des Genießens predigt,10 was nicht nur, aber auch die volupté beinhaltet, macht ihn endgültig zur persona non grata. Um überhaupt publizieren zu können, versteckt er in den meisten seiner Schriften seine radikalen Ansichten hinter Ironie und Polemik;11 er erarbeitet zudem kein in sich geschlossenes System (cf. supra: die Ablehnung von Systemen). All dies, d.h. Atheismus, radikaler Materialismus, sexuelle Freizügigkeit, Ablehnung gesellschaftlicher Institutionen und Hedonismus, ein schwer dechiffrierbares Werk sowie seine fehlende Verbindung zu philosophischen Zirkeln (wie z.B. den Enzyklopädisten),12 erklärt seine nur sporadische und selektive Rezeption, zum Teil bis ins 20. Jahrhundert.13
4 Sprachwissenschaftliche Aspekte
4.1 Sprachursprungstheorie
Ausgehend von der nicht möglichen Beweisbarkeit, wer der erste Mensch war der einst zu sprechen begann bzw. wie sich die menschliche Sprache entwickelte und was ihr Ursprung war, zieht La Mettrie verschiedene Parallelen zu anderen, empirisch beobachtbaren und damit beweisbaren Phänomenen im Zusammenhang mit Sprache, nämlich der Sprache im Tierreich, dem kindlichen Erstsprachenerwerb sowie sprachlichen Defiziten beim Menschen (Wolfskinder, Taubstumme). Damit folgt er ganz den Argumentationsschemata seiner Zeit,1 ist aber entsprechend seinem philosophischen Gedankengebäude in manchen Schlussfolgerungen weitaus radikaler. Das grundsätzliche Nichtwissen-Können (cf. Descartes 1960:52–53, § 33; 1992:31–41, § 17–24) formuliert er dabei folgendermaßen:
Mais qui a parlé le premier? Qui a été le premier Précepteur du Genre humain? Qui a inventé les moiens de mettre à profit la docilité de notre organisation? Je n’en sai rien; le nom de ces heureux et premiers Génies a été perdu dans la nuit de tems. (La Mettrie, HM 1990:54)
Da La Mettrie in seiner materialistischen Philosophie Tier und Mensch als aus der gleichen Materie aufbauend annimmt und zwischen beiden ein Kontinuum sieht, liegt es für ihn auch nahe, bei dem Menschen nah verwandten Tieren wie dem Affen grundsätzlich ein Vermögen zur Erlernung der Sprache zu postulieren. Die Sprechorgane (organes de la parole) seien beim Affen zwar nicht ganz ausreichend, doch glaubt er, dass es durch einen evtl. kleinen operativen Eingriff (ähnlich wie man es an der Eustachischen Röhre bei den Tauben macht) und durch anhaltende Lehrbemühungen möglich wäre, Affen das Sprechen beizubringen; schon allein deshalb, weil diese im inneren und äußerem Bau dem Menschen so sehr ähneln würden (cf. Haßler/Neis 2009:182–183).2
Seine diesbezügliche Schlussfolgerung ist modern, radikal und blasphemisch, denn für ihn ist der Mensch letztlich nichts anderes als ein Tier einer bestimmten Gattung, was für ihn durchaus positiv konnotiert ist (cf. Christensen 1996:187); dabei sei der Übergang zwischen Affen und Menschen als fließend anzunehmen.
Des Animaux à l’Homme, la transition n’est pas violente; les vrais Philosophes en conviendront. (La Mettrie, HM 1990:52)
Für die Frage nach dem Ursprung der Sprache bedeutet das letztendlich, ohne dass er dies expliziert, ebenfalls ein Kontinuum bzw. eine Entwicklung von der Sprache der Tiere zu der des Menschen. Das von seinen Zeitgenossen, wie z.B. Condillac oder Herder, formulierte klare Abgrenzungsmerkmal derÜberlegenheit des Menschen gegenüber dem Tier, nämlich die Sprache, wird damit eindeutig relativiert (cf. Haßler/Neis 2009:183).3
Letztlich sei es auf das größere Gehirnvolumen des Menschen zurückzuführen, dass seine Sprache elaborierter sei als die der Tiere, wie er in seinem Traité de l’âme (1751) darlegt.4 Dadurch hätte der Mensch mehr Ideen, diversifiziertere Vorstellungen, was sich wiederum auf die Sprache auswirken würde. Wenn man nun die Frage mit der Erlernbarkeit der menschliche Sprache durch die Affen und die reine Nachahmung der Laute bei Papageien außer Acht läßt, dann besteht der wesentliche Merkmalsunterschied zwischen tierischer und menschlicher Sprache darin, dass erstere aus Gestik besteht, während die der Menschen sich durch Worte konstituiert, was nicht immer von Vorteil sein müsse, da dies mitunter auch in Schwatzhaftigkeit münden könne (cf. Christensen 1996:88; Haßler/Neis 2009:182).
Quelle différence y a-t-il donc entre notre faculté de discourir, & celle des bêtes? La leur sé fait entendre quoique muette, ce sont d’excellents pantomines; la notre est verbeuse, nous sommes souvent de vrais babillards. […] Ces signes sont perpétuels, intelligibles à tout animal du même genre, & même d’une espece différente, puisqu’ils le sont aux hommes mêmes. (La Mettrie, TA 1774:120, §III)
Entsprechend der beim Menschen gegenüber den Tieren ausgefeilteren Gehirntätigkeit stellt sich La Mettrie die Erschaffung der Sprache eng verbunden mit der zunehmenden komplexen geistigen Entwicklung des Menschen vor: Durch Gefühl und Instinkt hätten die Menschen Geist erworben, durch den Geist Kenntnisse. Dadurch hätten sich wiederum neue Ideen und die Fähigkeit ergeben, verschiedene Wahrnehmungen besser zu unterscheiden. Um die Welt diversifizierter aufnehmen zu können, braucht es wiederum Zeichen und mit Hilfe der zum exakteren Denken entstandenen Zeichen, konnten die Menschen dann auch kommunizieren.
Voilà comme je conçois que les Hommes ont emploié leur sentiment, ou leur instinct, pour avoir de l’esprit, et enfin leur esprit, pour avoir des connoissances. Voilá par quels moiens, autant que je peux les saisir, on s’est rempli le cerveau des idées, pour la reception desquelles la Nature l’avoit formé. (La Mettrie, HM 1990:54)
[…] dès que qu’une fois les yeux bien formés pour l’Optique, ont reçu la peinture des objets, le cerveau ne peut pas ne pas voir leurs images et leurs différences; de même, lorsque les Signes de ces différences ont été marqés, ou gravés dans le cerveau, l’Ame en a nécessairement examiné les rapports; examen qui lui étoit impossible, sans la découverte des Signes, ou l’invention des Langues. (La Mettrie, HM 1990:56)
Hier scheint eine wechselseitige Abhängigkeit vorzuliegen, denn durch die Sprache, bzw. die Wörter und Zeichen schärfte sich laut La Mettrie wiederum der Geist des Menschen.5
Les Mots, Les Langues, Les Loix, Les sciences, les Beaux Arts sont venus; et par eux enfin le Diamant brut de notre esprit a été poli. (La Mettrie, HM 1990:52)
Bezüglich des kindlichen Spracherwerbs stellt La Mettrie wiederum das Kind in gewisser Weise auf eine Stufe mit dem Tier, indem er postuliert, dass die Erlernung der Laute ähnlich wie bei einem Papageien zunächst nur auf Imitation beruhen.
Quelle différence y a-t il entre l’enfant & le perroquet qu’on instruit? ne redisent-ils pas également les sons dont on frappe leurs oreilles, & cela avec tout aussi peu d’intelligence l’un que l’autre. (La Mettrie, TA 1774:121, §III)
Dabei beschreibt er ganz mechanisch bzw. medizinisch den Zusammenhang zwischen den äußeren Sinnen (dem Gehör) und den inneren Sinne (Willen zur Artikulation) und die dadurch ausgelösten Muskelkontraktion (Sprechen) (cf. Haßler/Neis 2009:183).
Dass die Frage nach dem Sprachursprung für ihn mit dem kindlichen Spracherwerb zusammenhängt, zeigt sich implizit daran, dass er bestimmte Parallelen zieht: So kann das Kind zwar z.B. Strohhalme oder Holzstäbchen in seiner Hand erkennen, aber noch nicht zählen oder diese nach ihrer Art unterscheiden, und zwar aufgrund des Mangels der noch nicht entwickelten Sprache bzw. der für diese Unterscheidung notwendigen Zeichen in der Vorstellung (cf. La Mettrie, HM 1990:56). Das Kind befinde sich geradezu auf einer noch niedrigeren Stufe als die Tiere, da es zu Beginn seines Lebens die Fähigkeiten des menschlichen Geistes noch nicht ausgebildet habe und gleichzeitig aber weniger Instinkt als das Tier besitze und damit klar im Nachteil sei (cf. La Mettrie, HM 1990:70).
Ebenfalls auf eine Stufe mit den Tieren stellt La Mettrie sogenannte Wolfskinder und Taubstumme,6 die man nur unter günstigen Umständen die Sprache lehren könne, wobei er wiederum dies zur Möglichkeit der Erlernung der Sprache bei einem Affen parallelisiert (cf. Haßler/Neis 2009:365–357).
Das Besondere an La Mettries Sprachursprungtheorie ist sicherlich die Nivellierung des Unterschieds von Mensch und Tier und das wenig spekulative, sondern eher empirisch Ausgerichtete seiner Forschung sowie die Negierung eines göttlichen Ursprungs der Sprache – zweifellos auch in der Epoche der Aufklärung hochgradig brisante Postulate.