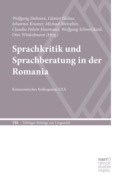Kitabı oku: «Seitenblicke auf die französische Sprachgeschichte», sayfa 14
Die Grammaire française von Jean Jacques Meynier aus Erlangen
Eine hugenottische Französischgrammatik des 18. Jahrhunderts
Corina Petersilka
La Grammaire Francaise, Reduite A Ses Vrais Principes, Ouvrage Raisonné est l’œuvre de Jean Jacques Meynier (1710–1783) qui fut le premier lecteur de français à l’université d’Erlangen où il resta en poste pendant plus de 40 ans. Ce descendant d’immigrés huguenots qui se disait « Français » publia à Erlangen en 1767 les deux tomes de cet ouvrage comportant une partie théorique et une partie pratique avec vocabulaire, thèmes, dialogues et lettres. Le premier tome s’inscrit dans la tradition de la grammaire latine en insistant scrupuleusement sur les pièges grammaticaux et lexicaux dans lesquels tombent communément les Allemands. À maintes reprises, Meynier relève aussi les erreurs qu’il observe dans l’expression orale de ses concitoyens huguenots « demi-français » (Meynier parle de « Teutsch-Franzosen »). Mais le volume théorique reflète également une réflexion linguistique approfondie qui se nourrit de la prise en compte de grammaires françaises comme celle de Port-Royal, De la Touche, Buffier, Restaut et Des Pepliers. De surcroît, la Grammaire francaise témoigne des méthodes d’enseignement qui régnaient à l’époque dans le Nord de la Bavière, nous informant en filigrane du processus d’intégration linguistique des réfugiés huguenots à Erlangen.
1 Leben und Werk Jean Jacques Meyniers
Jean Jacques Meynier wurde am 26.8.1710 in Offenbach als Sohn eines Strumpffabrikanten geboren (Höfer 1865:Sp. 291). Jean Jacquesʼ Großeltern waren aus Frankreich geflüchtet.1 Über seine schulische oder universitäre Ausbildung ist nichts bekannt. Der Hugenotte scheint sich autodidaktisch Kenntnisse in der französischen Sprache und Literatur sowie im Lateinischen und Griechischen verschafft zu haben. Zunächst unterrichtete der Verfasser der grammaire française in Offenbach als Privatlehrer Französisch (Schröder 1992 III:203). Im Kirchenbuch von Neu-Isenburg wird Jean-Jacob bzw. Jean Jacques Meynier anlässlich seiner ersten Hochzeit (1732 mit Susanne Grôs) schon als „Lecteur, Chantre et Maître d’École de l’Église Françoise Réformée“ in Offenbach bezeichnet (cf. Abbildung 1).

Abb. 1: Eintrag im Kirchenbuch der Ev.-Ref. Gemeinde in Neu-Isenburg anlässlich der Hochzeit Jean Jacques Meyniers mit Susanne Grôs, 1732.
Im Jahre 1738 wurde Meynier Kantor bei der französisch-reformierten Gemeinde in Christian Erlang2 und bekleidete dieses Amt bis 1745 (Fikenscher 1806 III:253). 1742 erhielt er den Posten des Lektors der französischen und italienischen Sprache an der Friedrichs-Akademie zu Bayreuth,3 die 1743 zur Universität erhoben wurde und nach Erlangen zog. Die Erlanger Neustadt beheimatete zu dieser Zeit etwa tausend Hugenotten samt ihren Nachfahren und circa doppelt so viel deutschstämmige Einwohner (cf. Hudde 1993:547; Lausberg 2007:142; Bischoff 1982:68). Meynier wirkte als Französischlektor an der Erlanger Universität und möglicherweise zumindest zeitweise auch am 1745 gegründeten Erlanger Gymnasium Fridericianum bis zu seinem Tod im Jahre 1783 (cf. Schröder 1992 III:203).4
Die meisten Schriften Meyniers sind Materialien für den Französischunterricht (Aufstellungen der Titel bei Fikenscher 1806 III:253–256; Schröder 1992 III:204–205; Höfer 1865 XXXV:Sp. 291–292). Von diesen ist die bedeutenste Frucht, die aus seiner umfangreichen Unterrichtspraxis und der Auseinandersetzung mit anderen Grammatiken (cf. Kap. 2.1) hervorgegangen ist, die hier zu behandelnde Grammaire française, reduite à ses vrais principes, ouvrage raisonné, Erlang und Nürnberg 1767. Diese Grammatik erzielte immerhin fünf Auflagen: 1767, 1776, 1783, 1781 und eine 1798 vom Sohn besorgte Ausgabe (cf. Stengel 1976:98). Teile dieser Grammatik bzw. des Vokabular-, Brief- und Gesprächsteils im zweiten Band veröffentlichte der Autor später nochmals getrennt und leicht überarbeitet unter anderen Titeln.5 Meynier verfasste auch Oden, Literarisches und Übersetzungen philosophischer und theologischer Schriften.6 Trotz herber Angriffe durch die Zensur des Markgrafen unternahm es der Hugenotte zwischen 1744 und 1771 immer wieder mit Buchhändlern aus Erlangen und Nürnberg verschiedene französische Zeitungen herauszugeben. Leider sind keine Exemplare der „Erlangische[n] Französische[n] Politische[n] Zeitung“, der „Nouvelles choisies“, des „Mélange curieux“, der „Evènements mémorables du Monde littéraire“, des „Echo de Nouvelles“ oder des „Raconteur“ erhalten (cf. Schmidt-Herrling 1930:98–101; Schröder 1992 III:205; Seifert 1972:14; Bischoff 1982:80). Dass diese „Gazetten“ erschienen sind, steht jedoch außer Zweifel, denn sie sorgten für ernste Konflikte zwischen der Universität und dem Bayreuther Markgrafen Friedrich III. (1711–1763), die in den Universitätsakten dokumentiert sind.7 Zunächst musste sich Meynier gegen den Kommerzienrat Brunner aus Bayreuth wehren, der auf sein Zeitungsprivileg pochte. Schließlich forderte der Markgraf Friedrich selbst die Universitätsleitung am 24.5.1756 auf, dass Meynier „die Zeitung liegen lassen“ solle. Zumindest sollte sie darauf achten, dass sich der Lector linguae gallicae der Zensur eines gewissen Cabrol unterwerfe. Dem Markgrafen, einerseits Schwager Friedrichs II. von Preußen, andererseits Reichsfürst, der während des Siebenjährigen Krieges eine neutrale Haltung zwischen den kriegsführenden Mächten einnehmen wollte, missfiel die offen friderizianische, preußenfreundliche Gesinnung Meyniers (Schmidt-Herrling 1930:99). Die Universität, die sich in ihrer akademischen Freiheit angegriffen sah, verteidigte den Lektor gegen den Markgrafen und wollte keinen auswärtigen, unstudierten Zensor akzeptieren.
Es lässt sich kein Hinweis auf eine Reise Meyniers nach Frankreich oder einen längeren Aufenthalt dort finden. Er starb am 9.10.1783 in Erlangen.
Der Hugenotte war viermal verheiratet. Die erste, dritte und vierte Frau schenkten ihm insgesamt sieben Töchter und sechs Söhne, wobei sechs der Kinder bereits im Kleinkindalter verstarben.8
Am meisten Spuren hinterließ der Sohn Jean Henri, später Johann Heinrich Meynier (1764–1825). Johann Heinrich trat als Französischlektor an der Erlanger Universität von 1788 bis 1825 in die Fußstapfen des Vaters. Französisch unterrichtete der Sohn auch zwischen 1791 und 1802 am Erlanger Gymnasium, wo er ebenso wie an der Universität zudem Zeichenunterricht gab (Bischoff 1982:80). Johann Heinrich Meyniers Interessen waren künstlerischer und breiter gefächert als die des Vaters. Zwar veröffentlichte auch Johann Heinrich zahlreiche Unterrichtsmaterialien fürs Französische, am bedeutendsten das Bildwörterbuch Neuer Orbis Pictus in deutscher und französischer Sprache : ein Hülfsmittel, Kindern viele nüzliche Kenntnisse beizubringen, die Lust zu Erlernung der französischen Sprache in ihnen zu erwecken, und die Fertigkeit im Sprechen zu befördern; mit vielen illuminirten Kupfern (Nürnberg 1812, 1818, 1822, 1834), sowie bei Johann Jakob Palm in Erlangen 1800 ein französisch-deutsches und 1802 ein deutsch-französisches Handwörterbuch für die Schulen und den Bürgerstand (cf. Hausmann 1989:42–45). Der Schwerpunkt seines äußerst umfangreichen schriftstellerischen Schaffens lag jedoch im Bereich der Pädagogik und Geschichte. Über 120, meist schön bebilderte Publikationen, die der naturkundlichen, historischen, geographischen und charakterlichen Bildung von Kindern und Jugendlichen dienen sollten, können Johann Heinrich Meynier zugeschrieben werden, wobei etwa die Hälfte unter einem Dutzend verschiedener Pseudonyme erschienen ist (cf. Strobach 1977:A90-A94; Bischoff 1982:80; Hausmann 1989:41–45; Schröder 1992 III:206–212; Stadtbibliothek Paderborn 1978:14–21; Hamberger/Meusel 1797:219–220).
Zwei der Töchter Jean Jacques Meyniers, nämlich Jeanette (geb. 1758) und Louise Meynier (1766–1856), arbeiteten als Erzieherinnen (cf. Stammbaum StAE III.107.M.1). Louise Meynier, verheiratete Mühler verfasste auf Deutsch zahlreiche pädagogische Kinderschauspiele und Erzählungen (cf. Bennewitz 2007:432–434).
2 Die Grammaire française von Jean Jacques Meynier
2.1 Aufbau und Bezug auf andere Grammatiken
Bereits der Titel La Grammaire Française, reduite a ses vrais principes, ouvrage raisonné lässt durch das Postulat raisonné erkennen, dass sich Meynier in die Tradition der rationalistischen Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal der Autoren Claude Lancelot und Antoine Arnauld stellte. Der erste Kanzler der Universität Erlangen, der Hugenotte Daniel de Superville, hatte die Grammatik von Port-Royal in der Ausgabe Brüssel 1676 der Universität geschenkt, worauf der Jurist Roßmann den Lektor Meynier auf das Werk und auf das Dictionnaire von Bayle aufmerksam machte (Meynier 1746:avertissement). Der Lektor besorgte 1746 eine Neuauflage der Grammatik von Port-Royal, die er mit zahlreichen Anmerkungen versah,1 in denen er die lateinischen und griechischen Beispielsätze ins Französische übersetzte, auf die konstrastive Komponente Französisch-Deutsch abzielte oder seine Unterrichtserfahrung einfließen ließ.2 (Leider verkaufte sich diese Port-Royal-Grammatik nicht Meyniers Vorstellungen entsprechend, so dass er bei der Universitätsleitung um Erlaubnis bat, eine Bücher- und Silberlotterie veranstalten zu dürfen, bei der anscheinend jeder, der Silberzeug erloste, auch eine Grammatik kaufen musste.3)
Der ausführliche, zeitgemäß schwülstige Titel der Grammaire française (cf. Abb. 2) liefert bereits einen Überblick über ihre Gliederung. Im Folgenden soll nach einer kurzen Vorstellung der praktischen Inhalte des zweiten Bandes hauptsächlich der erste Band, also die eigentliche Grammatik, behandelt werden.

Abb. 2: Titelblatt der Grammaire française von Jean-Jacques Meynier. http://idb.ub.uni-tuebingen.de/diglit/42A14572
Der Vorstellung Meyniers nach soll der Lerner die im ersten theoretischen Teil erworbenen Kenntnisse über den Aufbau der Sprache im zweiten praktischen Teil anwenden und einüben. Festigen soll sich die im ersten Teil erworbene Regelkenntnis vor allem durch das Hin- und Herübersetzen der Texte im zweiten Teil. Meynier pocht auf die Wichtigkeit der Erlernung und Anwendung von Grammatikregeln (cf. I préface, 4 recto) und setzt sich somit von der älteren Parliermethode, also der ungesteuerten Immersion ins Französische mit einer französischen Gouvernante oder einem Hauslehrer, ab (cf. zur Parliermethode: Kuhfuß 2014:508). Mit seiner Grammaire française veröffentlichte Meynier schon 16 Jahre vor Johann Valentin Meidinger, dessen Praktische Französische Grammatik 1783 zum ersten Mal erschien, ein Lehrbuch, das der Grammatik-Übersetzungs-Methode zuzurechnen ist. Die Grammatik-Übersetzungs-Methode, auch synthetische, gemischte und später „traditionell“ genannte Methode, war die bis weit ins 19. Jahrhundert vorherrschende Vermittlungsmethode (Kuhfuß 2014:509–516). Mit seinem ausführlichen, kontrastiv französisch-deutschen Regelteil und seinem auf Nützlichkeit und Anwendung ausgerichteten praktischen Teil mit Musterdialogen und vor allem Übersetzungen zur Regeleinübung lieferte Meynier ein frühes Beispiel für die Umsetzung dieser gemischten Vorgehensweise. Der Hugenotte befand sich also methodisch-didaktisch auf der Höhe seiner Zeit (cf. Hausmann 1989:40).
Im Titel wirbt Meynier damit, dass in seinem Werk „alles nach dem Grundriß der Grammaire des Herrn des Pepliers“ verfasst sei. Diese Aussage trifft zu, es gibt aber viele Unterschiede in der Anordnung und Ausführlichkeit der Kapitel sowie bei den Beispielsätzen. Meyniers Grammaire française ist insgesamt etwas umfangreicher als die Des Pepliers und enthält im Unterschied zu Des Pepliers zahlreiche thèmes.4 Bei Meynier wird mehr erklärt, bei Des Pepliers finden sich längere Beispiellisten. Ein systematischer Vergleich von Meyniers mit Des Pepliers Grammatik kann hier jedoch nicht geleistet werden.5 Im Folgenden werden nur einige Schlaglichter auf die unterschiedlichen Schwerpunkte in diesen Grammatiken geworfen. Des Pepliers Grammaire royale françoise, Berlin 1689, erreichte bis 1811 über hundert Auflagen und wurde ins Dänische, Russische, Schwedische und Niederländische übersetzt. Es handelte sich um eine der berühmtesten und meist verkauften Fremdsprachengrammatiken des 18. Jahrhunderts (Kuhfuß 2014:351).6 Des Pepliers stand z.B. auch auf dem Lehrplan des 1745 gegründeten Erlanger Gymnasiums (Gymnasium Fridericianum 1950:40).
2.1.1 Struktur des praktischen Teils
Meyniers zweiter Band enthält thematisch geordneten französisch-deutschen Wortschatz zu sämtlichen Lebensbereichen (Religion, Verbrechen, Tugenden, Handwerke, Fechten, Spiele, Pflanzen, Länder, Wasserwege etc., II, 1–192) jeweils begleitet von deutschen Texten, die das fragliche Vokabular enthalten und die ins Französische übersetzt werden sollen. Diese thèmes sind bei Des Pepliers nicht vorhanden.1 Meistenteils handelt es sich bei dieser Wortkunde um nominallastige Wortlisten. Meynier fügt jedoch auch immer wieder Anmerkungen zu „Redensarten“, aus heutiger Sicht zu Fragen der korrekten Kollokation ein, welche die Ausbeute seiner langjährigen Unterrichtserfahrung sind.2 Ein weiterer Bestandteil des zweiten Bandes sind 50 Musterdialoge auf Französisch (II, 193–243).3 Die recht biederen Gespräche, z.B. über das Wetter, die Gesundheit, das Essen oder Anstandsregeln, liefern Mustersätze für die Alltagskommunikation, Phrasen zur Anwendung in Gesellschaft, bei einem Arztbesuch, beim Ausritt, auf Reisen, beim Schneider, im Theater, etc. Manche Dialoge weisen ein gewisses fränkisches Lokalkolorit auf.4 Aufschlussreich ist in unserem Zusammenhang vor allem der 50. Dialog Le maître et le disciple, in dem der Schüler fragt, wie er die Grammaire française benutzen soll. Hier stellt Meynier nochmals ausführlich seine auf Regelkenntnis und Hin- und Herübersetzung basierende Methode dar. Darauf folgen 101 Saillies heureuses (II, 243–263). Es handelt sich um geistreiche historische Zitate und Episoden. Nicht fehlen darf in einem Lehrbuch der Zeit eine Abhandlung übers Briefeschreiben. In seinen Remarques sur les lettres (frz., II, 264–268) gibt Meynier auch kontrastiv-pragmatische Hinweise, z.B. übers Glückwunschschreiben.5 Gefolgt werden diese theoretischen Äußerungen von 81 französischen Beispielbriefen (II, 269–298), jeweils Schreiben mit Antwortschreiben, die Gängiges (Liebesbrief mit positivem und negativem Antwortbrief), aber auch aus heutiger Sicht Kurioses enthalten wie z.B. die notification de la mort d’un fils libertin (II, 271). Geschäftsbriefe (frz., II, 285–298), begleitet von Erklärungen zu Wechselbriefen Des lettres de change (frz., II, 298–302), nehmen wenig Raum ein. Es findet sich zudem ein Titularteil (frz., II, 302–310) Courtes Instructions Sur La manière d‘écrire & d’adresser les lettres. Auf diese Hinweise zu Anreden und Schlussformeln in Briefen folgt Von den Überschriften der Briefe (dt., II, 310–313), wo abgehandelt wird, wie die Adresse auf dem Briefumschlag zu verfassen ist. Der zweite Band schließt mit einigen Seiten (dt., II, 313–318) zu Namen der Bedienungen, Würden, Charakters und Professionen.
2.1.2 Struktur der eigentlichen Grammatik
Kommen wir nun zum Aufbau der eigentlichen Grammatik im ersten Band. Auf ein französisch formuliertes préface, auf dessen programmatische Aussagen noch zurückzukommen sein wird, und ein deutsch verfasstes Register folgt der Theorieteil der Grammatik auf Deutsch, was sich dadurch erklärt, dass sich diese Lernergrammatik an deutsche Schüler, Studenten und Lehrer richtete. Meynier entschuldigt sich am Ende des préface für sein schlechtes Deutsch: „Si mon stile allemand n’est pas partout dans sa pureté; on n’a qu’a se rapeler, que je suis Français“ (I, 5 verso).1 Diese Aussage erstaunt einigermaßen von einem in Deutschland geborenen Hugenotten der dritten Generation und war vielleicht als Verkaufsargument gedacht.
Meyniers Werk zeigt die klassische Anordnung in der Tradition der lateinischen Grammatik (cf. Chevalier 1994:12): auf Ausführungen zu Orthographie, Aussprache und Prosodie folgen Kapitel zur Etymologie (das ist Morphologie-Syntax) und schließlich zur Syntax.
Im ersten Abschnitt (I, 1–56) behandelt Meynier die Orthographie und Aussprache von Vokalen,2 Konsonanten, die Silbenlänge, die Liaison und die Orthograpie aus kontrastiv französisch-deutscher Perspektive. Dieses Kapitel ist weit ausführlicher als bei Des Pepliers – Meynier hatte ja bereits zuvor zur Aussprachelehre publiziert3 – und weist die für die Zeit typische terminologische Unschärfe zwischen Laut und Buchstabe auf. So schreibt Meynier zur Vokallänge:
Lang sind auch mehrentheils die End-Sylben, wenn sie einen oder einige hartlautende Consonantes haben, als: toujours, amour, trésor, constant, patient &. (Meynier 1767 I:37)
Er trennt also nicht immer klar zwischen Lauten, d.h. in seiner Sicht Buchstaben, die ausgesprochen werden wie das –r in amour, und Buchstaben, die schon zum Ausgang des Mittelalters verstummt sind wie –t in constant und patient. Meynier versucht, die Aussprache des geschriebenen Französischmithilfe der französischen und deutschen Grapheme sowie anhand von Vergleichen mit dem Deutschen4 bzw. mit deutschen Varietäten wie Fränkisch5 oder Niederdeutsch6 zu beschreiben. An zwei Stellen beruft er sich zur Entscheidung der Sprachrichtigkeit auf Pierre Restaut.7 Bisweilen behilft er sich mit der Aussage, man müsse diesen oder jenen Laut „aus dem Munde eines Franzosen pronunciren lernen“.8 Meyniers Ausführungen spiegeln die Aussprache des 18. Jahrhunderts wider,9 wobei er bei manchen Aussprachegewohnheiten einen Sprachstand früherer Jahrhunderte besessen zu haben scheint.10 Einige seiner Empfehlungen muten schließlich seltsam an.11 In vielerlei Hinsicht ähnelt seine Aussprache der, die sich bei seinem Zeitgenossen Friedrich II., König von Preussen, der von Hugenotten erzogen wurde, anhand seiner phonographischen Schreibweise rekonstruieren ließ.12
Im zweiten Abschnitt De l’Etimologie […] Von der Wortforschung“ (I, 57–171) beschreibt Meynier, weiterhin stets aus einer kontrastiv französisch-deutschen Warte, die einzelnen Wortarten. Wie Port-Royal und Des Pepliers unterscheidet er neun partes orationis: Articulus, Nomen, Pronomen, Verbum, Participium, Adverbium, Praeposition, Conjunction und Interjection (I, 57). Dieser Teil entspricht mit Umstellungen in der Reihenfolge und unterschiedlicher Ausführlichkeit dem Vorgehen bei Des Pepliers. Meynier behandelt z.B. die Genus- und Numerusmarkierung beim Nomen sehr detailliert und liefert unter Regeln vom Genere für einen Lateiner eine gereimte Liste von Wörtern, die im Französischen im Gegensatz zum Lateinischen feminin sind (I, 68–76). Zu Beginn dieses Wortartenkapitels verweist Meynier (I, 57) wie Des Pepliers (1767:20) auf den Père Buffier, der nur Nomen und Verbum unterschieden habe.13 Meynier bezieht sich außerdem auf Port-Royal, wenn er schreibt, dass auch er „nach der Vernunftlehre oder Logic“ eigentlich nur zwei Hauptteile, Nomination und Affirmation, unterscheide und empfiehlt zu diesem Thema seine Allgemeine Sprachkunst (I, 57).14
Meynier (wie Des Pepliers) hält an der Übertragung der lateinischen Kasusbezeichnungen aufs Französische fest. In der Grammatik von Port-Royal, die Meynier ja selbst mit einer Edition bedacht hatte und deshalb gut kannte, wurde das Konzept ‚Kasus‘ fürs Französische schon in Frage gestellt:
Il est vrai, que, de toutes les langues, il n’y a peut-être que la grèque & la latine, qui aient proprement des cas dans les noms. (Meynier 1746:35)15
Das Konzept complément entstand erst durch Du Marsais und Beauzée, vorbereitet von Buffier, Restaut und Girard, die versuchten, sich von der lateinischen Grammatiktradition zu lösen (Swiggers 1983:275; Chevalier 1968:650).
Mehr Raum als Des Pepliers räumt Meynier in diesem zweiten Abschnitt z.B. dem Gebrauch der Präpositionen ein (I, 142–145, 164–167), deren Erlernung er als „eins der Nothwendigsten Stücke in der Französischen Sprache“ (I, 166) bezeichnet.
Dieser Teil schließt mit einem Kapitel zur Wortforschung (I, 152–172), das sich bei Des Pepliers nicht findet und in dem Meynier kenntnisreiche Ausführungen zu historischer Lexikologie, zu Wortbildungsregeln, Semantik (Polysemie, Metaphorik) und Varietätenlinguistik avant la lettre liefert.
Der dritte und größte Abschnitt der Grammatik, de la sintaxe (I, 172–318), behandelt, „wie diese Materialien müssen zusammen gefüget und gebrauchet werden“ (I, 172). Immer wieder nennt Meynier aus einer spürbar jahrzehntelangen Unterrichtserfahrung heraus all die Fallen, in die freilich auch heutzutage noch die germanophonen Französischlerner tappen.16 Meyniers didaktischer Impetus ließ ihn ausführlicher als Des Pepliers vor allem auf folgende Fragen eingehen: Satzgliedstellung (I, 185–200), Verneinung (I, 182–184, 295–302), Particuln (kontrastiver Artikelgebrauch, I, 206–216, 229–231), unpersönlicher Ausdruck (I, 240, 290–294), die Ungewissen (Indefinitpronomen und Indefinitbegleiter; I, 246–250). Wichtig sind ihm die Kasus (Präpositionalgebrauch oder direkter Anschluss, u.a. I, 250–260). Tiefer gehend ist auch der Abschnitt über das participe présent, gérondif und adjectif verbal (I, 271–275). Weniger hing sein Grammatikerherz offensichtlich am Adverb, am accord des Participio Passivo oder Supino (also des participe passé) und an Tempus- und Modusfragen, was er kürzer abhandelt als Des Pepliers. Interessant ist jedoch seine Bemerkung, das passé surcomposé sei „im gemeinen Reden fast unentbehrlich“ (I, 281). Sein Beispielsatz zum Imparfait, „wann eine oft wiederholte Handlung soll exprimieret werden“, verrät vielleicht etwas über den Unialltag im 18. Jahrhundert:
Quand j’étois à Erlang, j’alois au manége, & j’y montois ordinairement 3. chevaux par jour; je faisois des armes, j’aprenois à dancer, je m’apliquois aux Etudes & c. (Meynier 1767 I:278)
Meyniers Syntaxkapitel schließt mit einem bei Des Pepliers nicht enthaltenen Abschnitt zur Phraseologie (I, 313–318), in dem es um Idiomatik, Barbarismi, Solecismi (Fehler des „Pöbel“), Gallecismi und „gaskognische Böcke“ geht. Dort führt er aus, dass er gerne ein phraseologisches Dictionaire verfassen würde, in dem man alle Gallecismi und Germanismi (frz.-dt. und dt.-frz.) nachschlagen könnte. Als Vorbild zitiert er das Buch des Jesuiten Pomey über die Particuln (I, 318).17 Immer wieder hadert Meynier mit der Grenze zwischen Grammatik und Lexikon bzw. „Phraseologie“ (I, 317) und ermahnt sich selbst, keine überlangen Beispiellisten aufzuführen für idiomatische Ausdrücke, die man besser aus dem Wörterbuch lernen solle (z.B. I, 303 zu Adverbien, I, 259, 260, 305 zu Präpositionen, I, 307 zur Konjunktion que). Für die Wortschatzarbeit empfiehlt er zu Fragen der Polysemie und der Adjektivstellung das Wörterbuch Richelets und rät „daß mann fleißig in einem guten Dictionnair oder gute Autores lese, wo mann dann mehr lernen wird als durch verdrießliche Regeln und Exceptiones“ (I, 178).18
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.