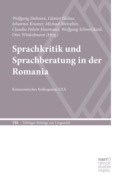Kitabı oku: «Seitenblicke auf die französische Sprachgeschichte», sayfa 13
4.2 Sprache und Denken: Kognition
Die Frage nach dem Zusammenhang von Sprache und Denken war zunächst an die Bedeutungshaftigkeit der Zeichen geknüpft, wie z.B. bei Platon, der in seinem Kratylos über die Richtigkeit der Benennung der Dinge räsoniert (physei-thesei), oder an eine Bezeichnungsnotwendigkeit wie sie Varro in De lingua latina darlegt.1 Im 17. Jh. wird hingegen eher die Frage des wechselseitigen Einflusses von Denkprozessen und Sprache thematisiert. Man diskutiert beispielsweise inwieweit Denken auch ohne Sprache möglich ist oder aber Sprache den Denkprozess fördern kann bzw. ihn erst möglich macht (cf. Haßler/Neis 2009:402–403).
So findet sich bei Locke – einem der wichtigsten Referenzphilosophen für La Mettrie – die Vorstellung wie wichtig Sprache zum Ausdruck der menschlichen Ideen ist und um Kenntnisse über Dinge zu erlangen (cf. Haßler/Neis 2009:438). Der zentrale Begriff bei Locke ist dabei die Idee (idea); diese wiederum hängt eng mit dem Geist und dem Denken zusammen, d.h. Kognition und Kommunikation greifen ineinander:
Besides articulate sounds therefore, it was further necessary that he should be able to use these sounds as signs of internal conceptions; and to make them stand as marks for the ideas within his own mind, whereby they might be made known to others, and the thoughts of men’s minds be conveyed from one to another. (Locke 1959 II:3; III, 1, 2)
Descartes hingegen spricht sich für eine Nicht-Abhängigkeit von Sprache und Denken aus. Gemäß seiner grundsätzlichen Vorstellung vom Dualismus von Körper und Seele, ist auch das Denkvermögen von der materiellen Erscheinung der Sprache losgekoppelt. Dies zeigt sich u.a. daran, dass Tiere zwar Sprache nachahmen könnten, aber nicht das Denken; auch Maschinen, also künstliche Automaten, die zwar Handlungen ausführen könnten, unter Umständen sogar Sprechhandlungen, es würde ihnen jedoch die Vernunft fehlen.2
[…] de façon que ce qu’ils font mieux que nous ne prouve pas qu’ils ont de l’esprit; car, à ce compte, ils en auraient plus qu’aucun de nous, et feraient mieux en toute chose; mais plutôt qu’ils n’en ont point, et que c’est la nature qui agit en eux, selon la disposition de leurs organes: ainsi qu’on voit qu’un horloge, qui n’est composé que de roues et de ressorts, peut compter les heures, et mesurer le temps, plus justement que nous avec toute notre prudence. (Descartes, Discours 1960:96; § 59)
Bei La Mettrie, der sich grundsätzlich eher auf Locke bezieht und sich klar von Descartes abgrenzt, spielt die ‚Vorstellung‘ bzw. ‚Vorstellungskraft‘ (imagination) eine zentrale Rolle,3 um die Denkprozesse im Zusammenhang mit der Sprache zu beschreiben.
Bereits im Traité de l’âme stellt La Mettrie unmissverständlich den Zusammenhang zwischen Sprache und Denken her und verweist zudem auf die Linearität von beiden.
Toutes nos pensées s’expriment par des mots, & l’esprit ne pense pas plus deux choses à la fois, que la langue ne prononce deux mots. (La Mettrie, TA 1774:148; XIII, §VI)
Im L’homme machine geht La Mettrie ausführlich auf die imagination ein und ihre Bedeutung für das Denken,4 den Erkenntnisgewinn und letztlich auch für die Wissenschaften.
La plus belle, la plus grande, ou la plus forte imagination, est donc la plus propre aux Sciences, comme aux Arts. (La Mettrie, HM 1990:66)
La Mettrie warnt dabei vor einem Missbrauch der Wörter (bzw. der Sprache), dahingehend, dass eine metaphernreiche Sprache Sachverhalte verunklart und etwas Metaphysisches suggeriert, obwohl das menschliche Denken endlich sei.5
[…] et encore une fois, c’est par un abus honteux qu’on croit dire des choses différentes, lorsqu’on ne dit que différens mots ou différens sons, auxquels on n’a attaché aucune idée, ou distinction réelle. (La Mettrie, HM 1990:66)
Die imagination ist dabei Voraussetzung für den Geist oder das Genie eines Menschen, also die Möglichkeit komplexe Zusammenhänge zu erkennen. Es ist bei La Mettrie einer der wichtigsten Begriffe, die sein ganzes Werk durchzieht und dessen Funktion nur schwer zu fassen ist, wie er selbst zugibt.6 Man kann die imagination aber als eine Art kreative Grunddisposition des Menschen charakterisieren, die eindeutig sensualistisch geprägt ist und damit bei La Mettrie auch mechanistisch-materialistisch, von der aber auch die Urteilskraft des Menschen abhängt, also die ratio (cf. Klingen-Protti 2016:145–149). Im L’homme machine versucht er dazu eine Definition:
Je me sers toujours du mot imaginer, parce que je crois que tout s’imagine, et que toutes les parties de l’Ame peuvent être justement réduites à la seule imagination, qui forme toutes; et qu’ainsi le jugement, le raisonnement, la mémoire ne sont que des parties de l’Ame nullement absolües, mais de véritables modifications de cette espèce de toile médullaire [Markgewebe], sur laquelle les objets peints dans l’œil, sont renvoiés, comme d’une Lanterne magique. (La Mettrie, HM 1990:58)
Die Einbildungskraft (imagination) speist sich hauptsächlich aus Empfindungen, dadurch werden mehr oder weniger unkontrolliert eine Vielzahl von Ideen hervorgebracht, die es zu bändigen gilt bzw. der Mensch muss lernen seine Urteilskraft einzusetzen, um diese Ideen exakter zu betrachten, um zu einem vernünftigen Denken zu gelangen und um die Welt adäquat erfassen zu können (cf. Christensen 1996:184–185; cf. auch: La Mettrie, HM 1990:62–64, 124).
Au contraire si dès l’enfance on acoutume l’imagination à se brider elle-même; à ne point se laisser emporter à sa propre impétuosité, qui ne fait que des brillans Entousiastes; à arrêter, contenir ses idées, à les retourner dans tous les sens, pour voir toutes les faces d’un objet: alors l’imagination prompte à juger, embrassera par le raisonnement, la plus grande Sphère d’objets […]. (La Mettrie, HM 1990:68)
In seiner Konzeption von den Wahrnehmungs- und Denkprozessen radikalisiert La Mettrie den Empirismus und wendet sich dabei gleichzeitig von seinen Vorbildern Boerhaave, Locke und Descartes ab, die allesamt sich nicht von metaphysischen Prämissen gelöst haben, während er selbst alle Voraussetzung in der organisierten Materie sieht und versucht jedwede Grunddisposition medizinisch und materialistisch zu erklären.7 Was seine Vorstellung von Sprache anbelangt bzw. den Zusammenhang von Sprache und Denken erscheint oberflächlich gesehen kein wesentlicher Unterschied zu beispielsweise Locke und seinen Ideen, die sich in der Sprache wiederspiegeln, doch bekommt die ganze Beziehung durch seinen radikaleren, oder besser, konsequenteren Grundansatz, eine andere Dimension, auch insofern als in seiner Konzeption Denken und Sprache enger zusammengedacht werden.
4.3 Sprache und Gesellschaft: Zeichentheorie
Auf den Zeichencharakter der Sprache kommt La Mettrie in dem schon erwähnten Zusammenhang mit der Problematik der Abgrenzung von Tier und Mensch zu sprechen. Bereits im Traité de l’âme werden dabei verschiedene Aspekte thematisiert. So stellt La Mettrie vor dem Hintergrund des alten physei-thesei-Streits (cf. Platon, Kratylos) die Arbitrarität des Zeichens heraus (thesei). Die Wörter der Sprache sind willkürliche Repräsentanten der dahinterstehenden Ideen, grundsätzlich also so wie auch heute noch das arbitraire du signe in der Konzeption von Saussure verstanden wird. Das ist zunächst nicht weiter revolutionär, da die Arbitrarität des Zeichens sich weitgehend durchgesetzt hatte und sich ähnliches z.B. auch bei Sanctius (1523–1601), Marin Mersenne (1588–1648), Antoine Arnauld (1612–1694) und Pierre Nicole (1625–1695),1 Géraud de Cordemoy (1626–1684) oder John Locke (1632–1704) und später u.a. bei Nicolas Beauzée (1717–1789) findet (cf. Haßler 1983:515–519; Haßler/Neis 2009:206–211).2
La Mettrie geht aber insofern darüber hinaus als er diese Willkürlichkeit nicht nur für die menschliche Sprache postuliert, sondern auch für die tierische.3 Die herrschende Meinung dieser Zeit ist jedoch, dass Tiere kein komplexes Zeichensystem haben, sondern nur ihre Empfindungen ausdrücken, wie es z.B. Johann Amos Comenius (1592–1670), Marin Mersenne oder Georges-Louis Leclerc Buffon (1707–1788) vertreten.4 La Mettrie greift hingegen auf ältere Positionen zu dieser Thematik zurück, wie sie sich bei Pierre Gassendi (1592–1655), Michel Montaigne (1533–1592) oder Jean de La Fontaine (1621–1695) finden lassen und radikalisiert diese (cf. Gunderson 1964:204; Wild 2006:142; Haßler/Neis 2009:179).
Verfolgt man die Ausführungen zur Tiersprache bei La Mettrie genau und parallelisiert man diese mit der zur menschlichen Sprache, so zeigt sich deutlich, dass er eine Saussure (cf. Cours de linguistique générale, 1916) sehr ähnliche Konzeption des Zeichens hatte: Vorstellungen (idées), Zeichenvorstellungen (signes d’idées) und willkürlich damit verknüpfte phonische oder graphische Zeichen.
Voilà des idées & des signes d’idées qu’on ne peut refuser aux bêtes, sans choquer le sens commun. […]
Qu’on ne nous objecte pas que les signes du discernement des bêtes sont arbitraires, & n’ont rien de commun avec leurs sensations: car tous les mots dont nous nous servons le sont aussi, & cependant ils agissent sur nos idées, ils les dirigent, ils les changent. (La Mettrie TA 1774:120; XI, §III)
Er geht in diesem Zusammenhang auch darauf ein, dass die Buchstaben der Schrift ebenfalls arbiträr sind und, auch hier Saussure vorgreifend, sekundär sind und später „erfunden“ wurden.
Les lettres qui ont été inventées plus tard que les mots, étant rassemblées, forment les mots, desorte qu’il nous est égal de lire des caracteres; ou d’entendre les mots qui en sont fait, parce que l’usage nous y a fait attacher les mêmes idées, antérieures aux unes & aux autres lettres, mots, idées, tout est donc arbitraire dans l’homme […]. (La Mettrie, TA 1774:120; XI, § III)
Wie so oft bei La Mettrie findet sich eine provokative Überspitzung (alles im Menschen ist willkürlich), die aber sicherlich mit Vorsicht zu genießen ist, was die eigentliche Intention anbelangt.
In dem obigen Zitat verbirgt sich jedoch ein weiteres wichtiges Moment in Bezug auf die Frage nach der Zeichenhaftigkeit der Sprache, nämlich die der Konvention, der gesellschaftlichen Übereinkunft (cf. Saussure),5 die La Mettrie dadurch ausdrückt, dass er den usage dafür verantwortlich macht, der die idées mit den mots bzw. den lettres verknüpft.
Im L’homme machine betont La Mettrie wiederum die Arbitrarität des Zeichens und verweist zusätzlich vor allem auf die gesellschaftliche Funktion des Zeichensystems der Sprache; nebenbei erklärt er, wiederum wie gewohnt eher mechanistisch-medizinisch, wie Kommunikation funktioniert.6
Rien de si simple, comme on voit, que la Mécanique de notre Education! Tout se réduit à des sons, ou à des mots, qui de la bouche de l’un, passent par l’oreille de l’autre, dans le cerveau, qui reçoit en même tems par les yeux la figure des corps, dont ces mots sont le Signes arbitraires. (La Mettrie, HM 1990:52, 54)
Diese prägnante Schilderung des Kommunikationskreislaufes, bei dem sowohl die physikalische Komponente der Übertragung impliziert wird, als auch die kognitive Repräsentation der Vorstellungen und deren Umsetzung in Zeichen, die von Mensch zu Mensch übertragen werden, ähnelt in vielen Elementen dem Saussure’schen Konzept und damit nicht zuletzt dem aktuellen Stand der sprachwissenschaftlichen Forschung.
La Mettrie betont außerdem die Schlüsselposition der Zeichen und damit der Sprache (v. supra) bei dem Erwerb von Kenntnissen und Erkenntnis (d.h. auch Wissenschaft).
Tout s’est fait par des Signes; chaque espèce a compris ce qu’elle a pu comprendre; et c’est de cette manière que les Hommes ont acquis la connoissance symbolique, ainsi nommée encore par nos Philosophes d’Allemagne.7 (La Mettrie, HM 1990:52)
Hier verknüpft sich der Themenkreis der Zeichenhaftigkeit bzw. des Zeichens in der Gesellschaft wieder mit der Frage nach dem Sprachursprung, insofern der Mensch grundsätzlich ein Bedürfnis hat (wie auch die Tiere) seine Empfindungen mitzuteilen; mit wachsender Komplexität der Gesellschaft und der damit verbundenen, komplexer werdenden Sprache wird der Geist des Menschen geschliffen (v. supra) und sein Kenntnisstand über die Welt wächst.
5 Fazit
Resümiert man nun die bei La Mettrie angesprochenen Aspekte der Sprachphilosophie bzw. die Reflexionen zur Sprache, so läßt sich folgendes konstatieren:
Die Ausführungen La Mettries zur menschlichen Sprache sind wie bei vielen anderen Philosophen der Zeit kein zentraler eigenständiger Abhandlungsgegenstand. Vielmehr sind seine Betrachtungen zur Sprache eng mit seiner philosophischen Gesamtkonzeption verbunden. Basierend auf seinen medizinischen Studien, die eben auch die physiologischen Aspekte des Körpers umfassen (Anatomie) und in direkter Auseinandersetzung mit seinen wichtigsten Vorbildern Boerhaave (Empirismus, Medizin, Chirurgie), Locke (Empirismus, Sensualismus) und Descartes (Rationalismus) kommt er zu einem sensualistischen-mechanistischen Weltbild, in dessen Mittelpunkt die sich selbst bewegende (force motrice) und empfindende Materie steht, aus der heraus alles erklärbar wird. In der Negierung von allem Metaphysischen wird die kreative Natur und die dort entstehende komplexe organisierte Materie, also das was man empirisch beschreiben kann, als die einzige Erklärungsbasis akzeptiert. Daraus resultiert auch seine Radikalität, d.h. sein reiner Materialismus, sein Atheismus und der bedingungslose Empirismus. Anders als der Titel seines Hauptwerkes L’homme machine suggeriert, ist dabei der Mensch mitnichten eine rein mechanistische seelenlose Maschine, sondern sein monistischer Materialismus veranlasst ihn dazu ein Kontinuum der Lebewesen Pflanze – Tier – Mensch zu postulieren, innerhalb dessen er z.B. auch den Tieren Empfindungen zugesteht (im Gegensatz zu Descartes) und bereits vor Rousseau zu einer sehr positiven Bewertung der Natur kommt. Die „menschliche Maschine“ ist bei ihm äußerst dynamisch und voller physikalisch-biologisch erklärbaren Empfindungen mit einem hedonistischen Telos.
Für seine Sprachauffassung, deren wesentliche Aspekte hier dargestellt wurden, bedeutet dies, dass er auch dort kompromisslose Positionen einnimmt. Dies gilt vor allem für die annährende Gleichsetzung von Mensch und Tier, sowohl was das Zeichensystem der Sprache anbelangt als auch das Erklärungsmodell zum Sprachursprung, im Zuge dessen er den Mensch letztlich der Gattung Tier zuschlägt und dies auch noch positiv bewertet. Diese Annahme ist für die damalige Zeit (und noch lange darüber hinaus), in der in erster Linie die Sonderstellung des Menschen (supériorité de l‘homme) vor dem Hintergrund der göttlichen Schöpfung betont wird, unerhört.
Die diesbezüglichen einzelnen Argumentationsstränge sind bei La Mettrie dabei nicht besonders originell, gehorchen sie doch den Themen der Zeit (wilde Kinder, Taubstumme, Papageien, Affen etc.), doch vor dem Hintergrund seiner radikalen Philosophie erscheinen sie in einem anderen Licht. Das gleiche gilt auch bezüglich der Arbitrarität der Zeichen und der Sprache in der Gesellschaft, denn auch hier bringt La Mettrie die einzelnen Aspekte sehr klar und deutlich hervor, betont die Wichtigkeit der Kommunikation in der Gesellschaft, den Zusammenhang von Sprache und Denken und den fortschreitenden Erkenntnisgewinn, der eben nur über Sprache, über die Zeichen repräsentierende imagination erfolgen kann, so dass Ideen entwickelt werden können. Dabei bleibt er im Gegensatz zu Cartesianern, die in der Sprache einen Ausdruck der ratio sehen, was wiederum die Existenz der menschlichen Seele beweisen würde und damit letztlich einen göttlichen Ursprung, streng bei einem naturwissenschaftlichen, medizinischen und atheistischen Erklärungsansatz.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass La Mettrie vor den wichtigen Schriften zur Sprachphilosophie von Condillac, Rousseau oder Herder schreibt und er hier trotz seiner dürftigen Rezeption als wichtiger Repräsentant und Impulsgeber der Sprachreflexion in der Aufklärung gesehen werden kann.
Literatur
Primärliteratur
Descartes, René (1960): Discours de la méthode. Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung. Übersetzt und herausgegeben von Lüder Gäbe. Hamburg: Meiner (= Meiner Philosophische Bibliothek, 261) [Nachdruck 1964].
Descartes, René (1992): Meditationes de prima philosophia. Lateinisch-Deutsch. Auf Grund der Ausgaben von Artur Buchenau neu herausgegeben von Lüder Gäbe. Durchgesehen von Hans Günter Zekl. Mit neuem Register und Auswahlbibliographie versehen von George Heffernan. Hamburg: Meiner (= Philosophische Bibliothek, 250a).
La Mettrie, Julien Offray de (1743): „Préface du traducteur“, in: Boerhaave, Herman: Institutions de médicine. Seconde édition. Avec un commentaire par M. de La Mettrie, docteur en médicine. Tome I. Paris: Huart/ Briasson/Durand, I-XVI (ohne Paginierung).
La Mettrie, Julien Offray de (1774): „L’Homme machine“, in: ibid.: Œuvres philosophiques. Nouvelle Édition. Corrigée & augmentée. 2 Bände. Band 1. Berlin [Nachdruck: Hildesheim/New York: Olms 1970], 269–356.
La Mettrie, Julien Offray de (1774): „L’Homme plante“, in: ibid.: Œuvres philosophiques. Nouvelle Édition. Corrigée & augmentée. 2 Bände. Band 2. Berlin [Nachdruck: Hildesheim/New York: Olms 1970], 1–22.
La Mettrie, Julien Offray de (1774): „Traité de l’âme“, in: ibid.: Œuvres philosophiques. Nouvelle Édition. Corrigée & augmentée. 2 Bände. Band 1. Berlin [Nachdruck: Hildesheim/New York: Olms 1970], 53–185.
La Mettrie, Julien Offray de (1987): Œuvres philosophiques. Texte revu par Francine Markovits. 2 Vols. Paris: Fayard (= Corpus des œuvres de philosophie en langue française).
La Mettrie, Julien Offray de (1990): L’homme machine. Der Maschine Mensch. Französisch-deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Claudia Becker. Hamburg: Meiner (= Philosophische Bibliothek, 407).
La Mettrie, Julien Offray de (2008): L’Homme-Plante. Der Mensch als Pflanze. Weimar: VDG (= edition weimar, 8).
La Mettrie, Julien Offray de (³2004): Der Mensch als Maschine. Mit einem Essay von Berns A. Laska. Nürnberg: LSR [1. Aufl. 1985].
La Mettrie, Julien Offray de (2015): L’Homme machine. Der Mensch eine Maschine. Französisch/Deutsch. Übersetzt von Theodor Lücke. Mit einem Nachwort von Holm Tetens. Stuttgart: Reclam (= Reclams Universal-Bibliothek, 19281) [Erstdruck der Übersetzung: 1965].
Locke, John (1959): An Essay Concerning Human Understanding. Collated and Annotated, with Prolegomena, Biographical, Critical, and Historical by Alexander Campbell Fraser. In two Volumes. Vol. II. New York: Dover Publications.
Sekundärliteratur
Baruzzi, Arno (1968): „La Mettrie“, in: Baruzzi, Arno (Hrsg.): Aufklärung und Materialismus im Frankreich des 18. Jahrhunderts. La Mettrie – Helvétius – Diderot – Sade. München: List (= Geschichte des politischen Denkens, 1502), 21–62.
Becker, Claudia (1990): „Einleitung“, in: La Mettrie, Julien Offray de: L’homme machine. Die Maschine Mensch. Französisch-deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Claudia Becker. Hamburg: Meiner (= Philosophische Bibliothek, 407), VII-XVIII.
Behrens, Rudolf (2014): „La mise en discours de l’imaginaire. Stratégies métaphoriques de la conceptualisation de l’imagination dans L’Homme Machine de La Mettrie“, in: Vallenthini, Michèle/Vincent, Charles/Godel, Rainer (Hrsg.): Classer les mots, classer les choses. Synonymie, analogie et métaphore au XVIIIe siècle. Paris: Garnier (= Rencontres, 100. Série Le dix-huitième siècle, 10), 137–154.
Christensen, Birgit (1996): Ironie und Skepsis. Das offene Wissenschafts- und Weltverständnis bei Julien Offray de La Mettrie. Würzburg: Könighausen & Neumann (= Epistemata. Würzburger Wissenschaftliche Schriften. Reihe Philosophie, 204).
Franzen, Winfried (1988): „Einleitung“, in: Maupertuis, Pierre Louis Moreau de: Sprachphilosophische Schriften. Mit zusätzlichen Texten von A.R.J. Turgot und E.B. de Condillac. Übersetzt und herausgegeben von Winfried Franzen. Hamburg: Meiner (= Philosophische Bibliothek, 410), VII-LXIV.
Gunderson, Keith (1964): „Descartes, La Mettrie, Language, and Machines“, in: Philosophy. The Journal of the Royal Institute of Philosophy 39 (Nr. 149), 193–222.
Haßler, Gerda (1983): „Zu einigen Aspekten der Diskussion um Zeichenproblematik und Sprachabhängigkeit des Denkens im 18. Jahrhundert“, in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (ZPSK) 36/5, 513–521.
Haßler, Gerda/Neis, Cordula (2009): Lexikon sprachtheoretischer Grundbegriffe des 17. und 18. Jahrhunderts. Band 1. Berlin/New York: de Gruyter.
Hausmann, Frank-Rutger (³2003): „La Mettrie, Julien Offray de“, in: Lutz, Bernd (Hrsg.): Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen. Stuttgart/Weimar: Metzler [11989], 392.
Hewes, Gordon W. (1996): „Disputes on the Origin of Language“, in: Dascal, Marcelo/Gerhardus, Dietfried/Lorenz, Kuno/Meggle, Georg (Hrsg.): Sprachphilosophie. Ein internationals Handbuch zeitgenössischer Forschung. 2. Halbband. Berlin/New York: de Gruyter (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 7/2), 929–943.
Jauch, Ursula Pia (1998): Jenseits der Maschine. Philosophie, Ironie und Ästhetik bei Julien Offray de La Mettrie (1709–1751). München/Wien: Hanser.
Klingen-Protti, Johannes (2016): „Julien Offray de La Mettrie: Histoire naturelle de l‘âme [Traité de l’Ame] (1745); L’homme machine (1748)“, in: Behrens, Rudolf/Steigerwald, Jörn (Hrsg.): Aufklärung und Imagination in Frankreich (1675–1810). Anthologie und Analyse. Unter Mitwirkung von Barbara Storck. Berlin/Boston: de Gruyter (= Hallesche Beiträge zur Europäischen Aufklärung, 54), 133–161.
Kondylis, Panajotis (1981): Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus. Stuttgart: Klett-Cotta.
Lange, Friedrich Albert (1866): Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung der Gegenwart. Iserlohn: Baedecker.
Laska, Bernd A. (1989): „Missglückte Repratrierung (Lamettrie). Zu Fayards Edition von La Mettries Œuvres philosophiques“, in: Laska, Bernd A.: La Mettrie im LSR-Projekt. Nürnberg: LSR [online: http://www.lsr-projekt.de/misclm.html#fayard, letzter Zugriff am 25.03.2017].
Laska, Bernd A. (³2004): „Julien Offray de La Mettrie. I. Leben, Werk und Wirkung“, in: La Mettrie, Julien Offray de: Der Mensch als Maschine. Mit einem Essay von Bernd A. Laska. Nürnberg: LSR-Verlag [11985], VII-XL.
Lambert, Cécile (2012): „Berliner Refraktionen: Bilder von Julien Offray de La Mettrie in den deutsch-französischen Netzwerken der Akademie der Wissenschaften“, in: Busch, Anna/Hengelhaupt, Nana/Winter, Alix (Hrsg.): Französisch-deutsche Kulturräume um 1800. Bildungsnetzwerke. Vermittlerpersönlichkeiten. Wissenstransfer. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag (= Berliner Intellektuelle um 1800, 2), 43–63.
Lemée, Pierre (1954): Julien Offray de La Mettrie. St Malo (1709) – Berlin (1751). Médecin – Philosophe – Polémiste. Sa vie. Son œuvre. Mortain: Imprimerie du Mortainais.
Lifschitz, Avi (2012): Language and Enlightenment. The Berlin Debates of the Eighteenth Century. Oxford: Oxford University Press (= Oxford Historical Monographs).
Mensching, Günther (2008): „Julien Offray de La Mettrie“, in: Rohbeck, Johannes/Holzhey, Helmut (Hrsg.): Die Philosophie des 18. Jahrhunderts. Band 2: Frankreich. Basel: Schwabe (= Grundriss der Geschichte der Philosophie), 506–518.
Neis, Cordula (1999): „Zur Sprachursprungsdebatte der Berliner Akademie (1771). Topoi und charakteristische Argumentationsstrukturen in ausgewählten Manuskripten“, in: Haßler, Gerda/Schmitter, Peter (Hrsg.): Sprachdiskussion und Beschreibung von Sprachen im 17. und 18. Jahrhundert. Münster: Nodus (= Studium Sprachwissenschaft. Beihefte, 32), 127–150.
Neis, Cordula (2004): „Das Problem des Sprachursprungs in Referenztexten und seriellen Texten des 18. Jahrhunderts“, in: Haßler, Gerda/Volkmann, Gesina (Hrsg.): History of Linguistics in Texts and Concepts. Vol. I. Münster: Nodus, 169–182.
Nöth, Winfried (²2000): Handbuch der Semiotik. Mit 89 Abbildungen. Stuttgart/Weimar: Metzler [11985].
Ricken, Ulrich (1984): Sprache, Anthropologie, Philosophie in der französischen Aufklärung. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses von Sprachtheorie und Weltanschauung. Berlin: Akademie-Verlag (= Sprache und Gesellschaft, 18).
Stoddard, Roger E. (2000): Julien Offray de La Mettrie, 1709–1751. A Bibliographical Inventory. Köln: Dinter.
Tetens, Holm (2015): „Nachwort“, in: La Mettrie, Julien Offray de (2015): L’Homme machine. Der Mensch eine Maschine. Französisch/Deutsch. Übersetzt von Theodor Lücke. Mit einem Nachwort von Holm Tetens. Stuttgart: Reclam (= Reclams Universal-Bibliothek, 19281) [Erstdruck: 2001], 171–188.
Thomson, Ann (2004): „La Mettrie’s Discussion of the Mind in Its Contemporary Context“, in: Hecht, Hartmut (Hrsg.): Julien Offray de La Mettrie. Ansichten und Einsichten. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag (= Aufklärung und Europa, 14), 153–166.
Vartanian, Aram (1960): La Mettrie’s L’Homme Machine. A Study in the Origins of an Idea. Critical Edition with an Introductory Monograph and Notes. Princeton: Princeton University Press.
Vartanian, Aram (1999): Science and Humanism in the French Enlightenment. Introduction by Lester G. Crocker. Charlottesville: Rookwood Press.
Wellman, Kathleen (1992): La Mettrie. Medicine, Philosophy, und Enlightenment. Durham/London: Duke University Press.
Wild, Markus (2006): Die anthropologische Differenz: Der Geist der Tiere in der frühen Neuzeit. Berlin/New York: de Gruyter (= Quellen und Studien zur Philosophie, 74).
Abkürzungen
La Mettrie, HM = L’homme machine
La Mettrie, TM = Traité de l’âme
La Mettrie, HP = L’homme plante