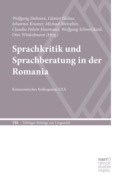Kitabı oku: «Seitenblicke auf die französische Sprachgeschichte», sayfa 8
1 Situierung des Problems
Im Folgenden soll die Frage nach der Entstehung des Subjektpronomens im Altfranzösischen noch einmal aufgenommen werden, die kontrovers diskutiert wird.1 Nach allgemeiner Ansicht hat sich die Setzung des Subjektpronomens vom Altfranzösischen zum Neufranzösischen in einem Prozess zunehmender Grammatikalisierung entwickelt. Da nach der communis opinio das Subjektpronomen im Altfranzösischen noch nicht obligatorisch war, war man an einer Interpretation der Setzung des Subjektpronomens immer mehr interessiert2 als an dessen Nicht-Setzung, die sozusagen das „Erwartbare“ war.3 Man könnte aber auch die Auffassung der „Nicht-Obligatorität“ des Subjektpronomens im Altfranzösischen präzisieren und die Meinung vertreten, dass das Subjektpronomen unter bestimmten syntaktischen Bedingungen regelmäßig gesetzt wurde und unter bestimmten anderen syntaktischen Bedingungen regelmäßig nicht gesetzt wurde. Dann wären Setzung und Nicht-Setzung nicht „beliebig“, sondern folgten klaren Regeln. Erst mit dem dem Wegfall dieser Regeln würde die Grammatikalisierung der Verwendung des Subjektpronomens dann ihren Lauf nehmen können.
Bevor wir uns genauer mit dieser Hypothese auseinandersetzen und anhand einiger der ältesten überlieferten Texte (9.–12. Jh.) überprüfen, müssen wir uns die Regeln der Setzung des Subjektpronomens im Altfranzösischen noch einmal vergegenwärtigen.
2 Zur Setzung bzw. Nicht-Setzung des Subjektpronomens im Altfranzösischen
Nach einem satz-einleitenden Nicht-Subjekt, im Folgenden „X“ genannt,1 steht das nominale Subjekt regelmäßig in Inversion (cf. Foulet 1968 [1930]:§ 450). Es heisst also
(1) Li rois dist: …
aber:
(2) Lors dist li rois: …
Das ist die berühmte „V2“-Regel des Altfranzösischen (cf. etwa Marchello-Nizia 1999:41).2 Ist das Subjekt hingegen pronominal, wird es meist nicht gesetzt, wenn es in Inversion nach „X“ stünde. Es heisst also
(3) Il dist: …
aber:
(4) Lors dist Ø: …
Die Nicht-Setzung des Subjektpronomens, stünde es in Inversion, wurde auf klare Weise von Foulet (1968 [1930]) und Franzén (1939) beschrieben. Foulet nennt dieses Merkmal zu Recht „un des faits les plus curieux de la syntaxe médiévale“:
[L]’inversion du sujet est souvent masquée par une habitude qui constitue un des faits les plus curieux de la syntaxe médiévale […]: si le sujet est un pronom personnel, il sera très souvent sous-entendu. C’est là un point fondamental de la syntaxe du vieux français: l’inversion du sujet entraîne facilement dans le cas du pronom personnel l’omission du sujet. (Foulet 1968 [1930]:§ 457; Hervorhebung von ihm)
Franzén beschreibt die Nicht-Setzung des Subjektpronomens sowohl in Haupt- als auch in Nebensätzen. Zur Nicht-Setzung in Hauptsätzen bemerkt er:
[Le sujet n’est pas exprimé quand] [l]e verbe est précédé d’un membre de phrase accentué, ce qui entraîne le plus souvent l’omission du pronom sujet. (Franzén 1939:24)
Dasselbe gilt auch für Nebensätze:
[Q]uand le verbe de la subordonnée était précédé d’un membre de phrase à accent propre, le pronom sujet était à l’ordinaire omis. (Franzén 1939:27)
Allerdings ist die Position des nicht-gesetzten Subjektpronomens im Haupt- und Nebensatz nicht identisch: während sie sich im Hauptsatz nach dem Prädikat befindet (cf. Beisp. (4)), ist sie im Nebensatz vor dem betonten Element anzusetzen:
(5) Quant Ø infans fud (Leodegarlied V. 13)3
Cf. Foulet (1968 [1930]:§ 466) und das folgende Beispiel
(6) Qu’elle Deo raneiet (Eulaliasequenz V. 6)
wo das Subjektpronomen ausnahmsweise gesetzt wird.4
In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig festzuhalten, dass die Nicht-Setzung des pronominalen Subjekts nicht etwa von seiner Referenzidentität mit einem unmittelbar zuvor genannten Subjekt abhängt; cf. Franzén zu Haupt- und Nebensätzen: „[I]l n’est pas nécessaire que le sujet sous-entendu soit identique à celui de la proposition précédente“ (1939:26)5 und „Cette règle était observée, que le sujet de la subordonnée fût identique, ou non, à celui de la principale“ (Franzén 1939:27, Anm. 5). Die Nicht-Setzung des Subjektpronomens ist also syntaktisch bedingt. Dasselbe gilt auch für seine Setzung: „The use of the unstressed subject pronoun in OFr depends mainly on the structure of the clause“ (Price 1979:§ 11.5.2). Sie hat, den Bemerkungen von Foulet, Franzén und Price zufolge, nichts mit einem etwaigen „Subjektwechsel“, „Topicwechsel“6 oder einer besonderen Hervorhebung des Subjektreferenten7 zu tun, sondern stellt den „Normalfall“ dar. Wenn diese Auffassung richtig ist, müssen wir also nicht die Setzung, sondern im Gegenteil die Nicht-Setzung des Subjektpronomens erklären.
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die unterschiedliche Frequenz der Setzung des Subjektpronomens in Haupt- und Nebensätzen. Da Hauptsätze im Altfranzösischen sehr häufig durch ein Element „X“ eingeleitet werden, das die Inversion auslöst, kommen Subjektpronomina in Hauptsätzen viel seltener als in Nebensätzen vor, wo die einleitende Konjunktion oder das Relativpronomen8 nicht als „X“ zählen (cf. Foulet (1968 [1930]:§ 459). Das Subjektpronomen steht folglich ganz regulär nach der Konjunktion oder dem Relativpronomen (sofern nicht ein betontes Element dem Verb vorausgeht):
(7) la nef […] ou il deveit entrer (Alexiusleben V. 77)
Franzén (1939:29) fasst diesen Sachverhalt folgendermaßen zusammen:
Quand le sujet n’était pas un substantif, la principale se construisait, dans l’immense majorité des cas, complément + verbe, tandis que, dans la subordonnée, la construction conjonction + pronom sujet + verbe (+ complément) prédominait dès l’époque de l’Alexis.
Daraus ergibt sich eine offensichtliche „Asymmetrie“ zwischen Haupt- und Nebensätzen,9 ohne dass dafür etwaige pragmatische Gründe geltend gemacht werden können.
Im Folgenden sollen im Licht dieser Erkenntnisse die ältesten Sprachdenkmäler des Altfranzösischen einer genauen Analyse in Bezug auf die Setzung/Nicht-Setzung des Subjektpronomens unterzogen werden, von den Straßburger Eiden (9. Jh.) bis zu den Quatre Livre des Reis (12. Jh.).10 Dass die meisten der bis dahin überlieferten Texte metrisch gebundene Texte sind, ist für eine syntaktische Untersuchung ein Nachteil, der sich aber nicht umgehen lässt.
3 Empirische Untersuchung
3.1 Vorbemerkungen
Untersucht werden deklarative Hauptsätze (keine Fragesätze, Imperativsätze und Optativsätze) und Nebensätze. Nicht berücksichtigt werden weiter impersonale Ausdrücke, da die Setzung des expletiven il oder „il neutre“ (dt. „es“) der Setzung des referentiellen Subjektpronomens chronologisch nachgeordnet ist; cf. dazu Moignet (1965:96–97) und Buridant (2000:§ 342, S. 427): „La non-expression est particulièrement fréquente dans le cas des verbes impersonnels, où il sujet neutre ne s’impose que lentement“. Die Setzung bzw. Nicht-Setzung des expletiven il muss von derjenigen des referentiellen Subjektpronomens daher unbedingt getrennt beschrieben werden.1
Festzuhalten ist, dass auch die Negation als Element „X“ funktionieren kann, welches dann Inversion bewirkt, mit der Folge der Nicht-Setzung eines pronominalen Subjekts:2
(8) [Ewruin:] Ne vol Ø reciwre Chielperin (Leodegarlied V. 57)
Cf. dazu Franzén (1939:24, 66–67, 128) und Buridant (2000:§ 340). Grund ist nach Franzén, dass die Negation ursprünglich ein betontes Element war.
Vorauszuschicken ist auch noch eine Bemerkung zur Nicht-Setzung des Subjektpronomens innerhalb derselben Satzkonstruktion in syndetischer oder asyndetischer Parataxe bei dem Vorliegen eines identischen Subjektreferenten. In solchen Fällen muss der Referent, der das aktuelle Diskurstopic darstellt, nicht noch einmal genannt werden. Zunächst zu syndetischer Parataxe mittels et:3
(9) Après parlat ses filz envers Marsilies,Et Ø dist al rei: „[…]“ (Rolandslied V. 496)
Noch im Neufranzösischen ist bei Topic-Kontinuität nach et eine nochmalige Nennung des Subjektreferenten nicht nötig, cf. Il mange un bifteck et Ø boit un verre de rouge. Zu asyndetischer Parataxe:
(10) Voldrent la veintre li Deo inimi,Ø Voldrent la faire dïaule servir. (Eulaliasequenz V. 3–4)
(11) La domnizelle celle kose non contredist:Ø Volt lo seule lazsier, si ruovet Krist. (Eulaliasequenz V. 24)
(12) Ille amat Deu, Ø lo covit;Ø rovat que litteras apresist. (Leodegarlied V. 17–18)
Da die Interpunktion von dem modernen Herausgeber stammt, können wir auch einen Doppelpunkt wie in Beisp. (11) und ein Semikolon wie in Beisp. (12) unter „Topic-Kontinuität innerhalb derselben komplexen Satzkonstruktion“ subsumieren, denn der Herausgeber hätte ja auch ein Komma schreiben können.4
Im Fall von syndetischer und asyndetischer Parataxe sind es also pragmatische Gründe (Topic-Kontinuität), die für die Nicht-Setzung des Subjektpronomens verantwortlich sind.5
3.2 Corpus-Untersuchung1
3.2.1 IX. Jh.
Straßburger Eide (843) 1
(Textumfang: 14 Zeilen)
Vorbemerkungen: om „man“ (Z. 6) wird nicht als Subjektpronomen angesehen, und auch io in ne io ne neuls (Z. 13), ein disjunktes Pronomen, das nicht weggelassen werden kann, wird nicht als Subjektpronomen gezählt, obwohl io hier Subjekt von er (Z. 14) ist.
Der althochdeutsche (genauer: rheinfränkische) Wortlaut wird nur angegeben, wenn Parallelen zwischen dem altfranzösischen und dem althochdeutschen Text aufgezeigt werden sollen.2
(13) [Der Ostfranke Ludwig der Deutsche leistet den Schwur auf Altfranzösisch:]31 Pro Deo amur […]42 et nostro commun salvament […],3 in quant Deus savir et podir me dunat,4 si salvarai eo cist meon fradre Karlosō haldih thesan mīnan bruodher5 et in aiudha et in cadhuna cosa,6 si cum om per dreit son fradra salvar dift,7 in o quid il mi altresi fazet,in thiu thaz er mig sō sama duo,8 et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai Ø,indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango Ø,9 qui, meon vol, […] in damno sit.
(14) [Die Heerführer leisten den Schwur in ihrer jeweiligen Muttersprache – derjenige Karls des Kahlen auf Altfranzösisch und derjenige Ludwigs des Deutschen auf Althochdeutsch:]10 Si Lodhuuigs sagrament que Ø son fradre Karlo jurat conservat,Oba Karl then eid, then er sīnemo bruodher Ludhuuuīge gesuor, geleistit11 et Karlus […] non l’ostanit,12 si io returnar non l’int pois,ob ih inan es iruuenden ne mag:13 ne io ne neuls cui eo returnar int pois,noh ih noh thero nohhein, then ih es iruuenden mag,14 in nulla aiudha contra Lodhuuuig nun li iu er.
Alle Setzungen bzw. Nicht-Setzungen des Subjektspronomens sind „regelkonform“, mit einer einzigen scheinbaren Ausnahme (v. infra). Im altfranzösischen Wortlaut wird viermal das Subjektpronomen gesetzt,5 einmal im Hauptsatz: si salvarai eo (Z. 4) und dreimal im Nebensatz: in o quid il [...] fazet (Z. 7); si io [...] pois (Z. 12); cui eo [...] pois (Z. 13), ohne jede Hervorhebung. Der althochdeutsche Wortlaut weist in allen Fällen eine Entsprechung auf.
In zwei Fällen wird das Subjektpronomen nicht gesetzt; einmal im Hauptsatz nach „X“: X prindrai (Z. 8)6 (genauso im Althochdeutschen) und einmal im Nebensatz in Verbindung mit „X“: que [.…] jurat (Z. 10).
Alle diese Fälle entsprechen der „Prognose“ in § 2 bis auf Z. 4, wo es im Hauptsatz heisst: si salvarai eo… Si ist Adverb und löst Inversion aus; hier steht also ausnahmsweise das Subjektpronomen in Inversion (ebenso im althochdeutschen Wortlaut: sō haldih). Es werden uns noch weitere derartige Fälle begegnen. Bei der Prognose bezüglich der Nicht-Setzung in Inversion handelt es sich also nicht um eine strikte „Regel“, sondern nur um eine mehr oder weniger ausgeprägte „Tendenz“. In den Zitaten in § 2 aus Foulet und Franzén heisst es ja auch, dass das Subjektpronomen in Inversion „très souvent“, „le plus souvent“ fehle, aber eben nicht immer.7
3.2.2 X. Jh.
Eulaliasequenz (um 900) 1
(Textumfang: 29 Zeilen)
Das Subjektpronomen wird hier siebenmal ohne jede Hervorhebung gesetzt, viermal im Hauptsatz: Elle nont2 eskoltet (V. 5), Il […] enortet (V. 13), Ellent3 adunet (V. 15), Elle […] non auret (V. 20), und dreimal im Nebensatz: Qu’elle […] raneiet (V. 6), Qued elle fuiet (V. 14), Qu’elle perdesse (V. 17).
Das Subjektpronomen wird im Hauptsatz elfmal nicht gesetzt (ohne Berücksichtigung der impersonalen Verbform chielt, V. 13), davon neunmal nach „X“, z.B. bel auret corps (V. 2),4 und zweimal in asyndetischer Parataxe nach einem Komma/Doppelpunkt des Herausgebers bei identischem Subjekt/Topic, cf. oben die Beispiele (10)-(11). Im Nebensatz wird dreimal das Subjektpronomen nicht gesetzt, davon zweimal in Verbindung mit „X“ vor dem Verb (V. 26, V. 28).5 Alle Setzungen/NichtSetzungen sind „regelkonform“ mit einer Ausnahme:
(15) Enz enl fou lo6 getterent com Ø arde tost:Elle colpes non auret, poro nos coist. (V. 19–20)
wo im Nebensatz nach com das Subjektpronomen elle gesetzt werden sollte. Die Nichtsetzung in V. 19 ist sicher dem Metrum geschuldet, denn wir hätten sonst in dieser Zeile mit elf Silben, die mit der folgenden elfsilbigen Zeile in V. 20 durch die Assonanz gebunden ist, zwei Silben mehr.7 Cf. dazu auch Buridant (2000:426, § 341): „[D]ans les textes versifiés, des facteurs métriques peuvent jouer dans le choix entre expression/non-expression“. Dasselbe gilt auch für die frühen assonierenden Texte.
Jonasfragment (2. Viertel 10. Jh.) 8
(Textumfang: ein Folium; 226 Zeilen)
(Mischsprachlich lat.-afrz.)
Es handelt sich um das Fragment einer Homilie über den Propheten Jonas, z.T. in Tironischen Noten auf der Basis des Lateinischen geschrieben. Die recto-Seite ist in so schlechtem Zustand überliefert (cf. die Abbildung von Vorder- und Rückseite des Foliums bei de Poerck 1955, nach S. 40), dass sie sich kaum auswerten lässt. Immerhin fällt ein Subjektpronomen im Nebensatz ins Auge, das festzuhalten ist, auch wenn der Kontext fehlt:
(16) quant il lo… (Z. 22)9
Die verso-Seite ist besser lesbar. Hier fallen im Hauptsatz auf:
(17) tu douls mult a… (Z. 178)
(18) e jo ne dolreie de tanta milia hominum […]? (Z. 181–182)
und im Nebensatz:
(19) inde habuit misericordias si cum il semper solt haveir de peccatore. (Z. 115–116)„daher hatte er Mitleid mit dem Sünder, wie er [es] immer zu haben pflegte“10
(20) cum il faciebat de perditione Iudeorum. (Z. 127)
(21) porqet il en cele durecie et en cele encredulitet permes sient. (Z. 166–167)
(22) si cum il ore sunt. (Z. 173)
(23) cum co uidit qet il se erent convers de uia sua mala (Z. 194)
(24) liberi de cel peril qet il habebat discretum (Z. 196–197)
Andererseits fehlt das Subjektpronomen „regelkonform“ in Inversion nach si:
(25) si escit Ø foers de la ciuitate. e si sist Ø contra orientem ciuitatis. e si auardevet11 Ø cum Deus parfereiet… (Z. 136–138)
Wir finden sogar eine Reihe von nicht gesetzten Subjektpronomina im Nebensatz in Verbindung mit „X“ (cf. § 2, Beisp. (5) und Z.10 der Straßburger Eide):
(26) qe Ø super els metreiet. (Z. 118)
(27) [als Fortsetzung von Beisp. (24)]: qe Ø super els mettreiet. (Z. 197)
(28) <et preparavit Dominus> un edre sore sen cheve qet Ø umbre li fesist. (Z. 145–146)12
(29) <tant laveient of>fendut. qe Ø tost le uolebat delir. (Z. 187)
(30) E poro si vos avient <qe bie>n faciest cest triduanum ieiunium qet Ø oi comenciest. (Z. 201–203)
(31) poscite li qe cest fructum qe Ø mostret nos habet qel nos conservet. (Z. 214–216)
Das Fazit ist, dass sich auch in dieser schwer beschädigten Handschrift die Regeln der Setzung bzw. Nicht-Setzung des Subjektpronomens deutlich erkennen lassen. Den angeführten Beispielen kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie die Mechanismen zeigen, denen nicht-literarische, metrisch nicht gebundene Gebrauchstexte (zu denen auch die Straßburger Eide gehören) folgen. Der Setzung des Subjektpronomens in den Beisp. (16)-(24)), die den in § 2 vorgestellten Prinzipien folgen, kommt keinerlei „Hervorhebungsfunktion“ zu. Von größtem Interesse sind auch die nicht gesetzten Subjektpronomina in Nebensätzen in Verbindung mit einem dem finiten Verb vorangestellen „X“ (Beispiele (26)-(31)).
Leodegarlied (um 1000) 13
(Textumfang: 240 Verse)
Regelkonforme Setzungen des Subjektpronomens im Hauptsatz (z.B. Il lo reciut, V. 21) und im Nebensatz (z.B. cum il l’audit, V. 42) müssen hier und im Folgenden nicht mehr kommentiert werden, und auch nicht mehr die häufige Nicht-Setzung im Hauptsatz nach „X“ (z.B. Dominedeu devemps Ø lauder, V. 1). Es sollen also nur noch interessante Fälle und „Ausreißer“ zur Sprache kommen.
Die Nicht-Setzung des Subjektpronomens kommt im Hauptsatz, außer nach „X“ und in Verbindung mit der Negation (cf. Beisp. (8)), auch in Teilsätzen vor, die bei identischem Subjektreferenten/Topic in asyndetischer Parataxe angeschlossen sind, cf. Beisp. (12). Im Nebensatz finden wir die Nicht-Setzung in Verbindung mit einem betonten Element vor dem Verb. Auch sie ist als regelkonform anzusehen (cf. oben zum Jonasfragment).
„Ausreißer“ im Hauptsatz sind nur zwei Vorkommen des Verbs in absoluter Initialstellung:
(32) Ø Uarda, si vid grand claritet (V. 201)
(33) Ø Rendet ciel fruit espiritelquae Deus li auret per donet. (V. 215–216)
In beiden Beispielen ist der Subjektreferent mit dem des vorausgehenden Subjekts und Topics identisch (Topic-Kontinuität), aber es beginnt ein neuer Satz (ein Punkt geht voraus). Franzén (1939:50) bemerkt zu solchen Fällen nur kurz, sie kämen mit Vorliebe in den Chansons de geste vor.
Im Hauptsatz gibt es ein paar Fälle, in denen das Subjektpronomen trotz der Anwesenheit eines vorausgehenden „X“ gesetzt wird, z.B.
(34) fid aut.il grand e veritet (V. 34)„lealtà ebbe egli grande e scrupolo della verità“14
Die Konstruktion X-V-Spr wird hier durch das Metrum (den Achtsilbler) bedingt sein. Aber auch in nicht metrisch gebundenen Texten kann die Setzung des Subjektpronomens nach „X“ vorkommen (cf. Z. 4 der Straßburger Eide), so dass diese Konstruktion nicht als „Ausreißer“ gelten soll.
In den folgenden beiden Beispielen fällt hingegen die unregelmäßige Setzung des Subjektpronomens auf:
(35) Dominedeu [= DO], // il lo laissat (V. 127)15
(36) Dominedeu [= IO] // il les lucrat (V. 214)„al Signore Iddio li guadagnò“16
Hier würde die Nicht-Setzung des Subjektpronomens nach dem einleitenden Element „X“ Dominedeu das Metrum des 2. Halbverses zerstören, das vier Silben erfordert:
(35') *Dominedeu // laissat Ø
(36') *Dominedeu // les lucrat Ø
In Beisp. (36') wäre außerdem aufgrund des „Tobler-Mussafia-Gesetzes“ die Stellung des unbetonten Objektpronomens zu Beginn des zweiten Halbverses nicht zulässig (cf. dazu Foulet 1968 [1930]:§ 162).
Unregelmäßig, aber im Altfranzösischen zuweilen (v.a. in Versepen) vorkommend, ist auch die Wiederaufnahme eines lexikalischen Subjekts durch das Subjektpronomen:
(37) [Am Laissenanfang:] Rex Chielperings // il se fud mors; (V. 115)
Dieser Konstruktionstypus, der formal wie ein Subjekts-Left detachment im modernen Französisch aussieht, besitzt jedoch im Altfranzösischen eine andere Funktion, die man „rhetorisch“ und „rhythmisch“ nennen kann; cf. die Diskussion bei Wehr (2007:486–488).
Auch im Nebensatz gibt es ein paar „Ausreißer“, nämlich die Nicht-Setzung des Subjektpronomens nach der Konjunktion und dem Relativpronomen, die den Nebensatz einleiten. Hierbei ist zu unterscheiden, ob die (zu erwartende) Setzung das Metrum verändern würde oder nicht:
(38) [Leodegar ist Topic:] cum Ø vit les meis, a lui ralat. (V. 90)
Hier würde cum il vit den Achtsilbler zerstören. Im folgenden Beispiel hätte aber por cio qu’il fud… keinerlei Folgen für das Metrum:
(39) por cio que Ø fud de bona feit (V. 53)
Fazit: Die Setzung bzw. Nicht Setzung des Subjektpronomens in diesem Text ist fast durchgehend regelkonform, mit ein paar Ausnahmen, die z.T. dem Metrum geschuldet sind wie in Beisp. (35), (36) und (38). Nur Fälle wie Beisp. (39), in denen das Subjektpronomen im Nebensatz nicht steht und dieses Fehlen nicht durch das Metrum bestimmt wird, stellen tatsächlich Ausnahmen von der Regel dar.