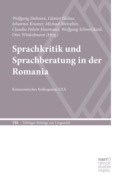Kitabı oku: «Seitenblicke auf die französische Sprachgeschichte», sayfa 9
3.2.3 XI. Jh.
„Griffonnages“
(Textumfang: zwei Sätze)
Wenn das Jonasfragment der einzige erhaltene „Prosatext“ des 10. Jh.’s ist, so sieht die Beleglage für die Prosa im 11. Jh. noch schlechter aus, denn hier finden wir nur zwei kurze Sätze, die unten auf die Seite einer Handschrift gekritzelt sind (cf. Woledge/Clive 1964:12). Darauf machte Moignet (1965:89, Anm. 3) aufmerksam. Es handelt sich um eine Handschrift aus Douai (Dép. Nord), die eine Vita Sancti Cilliani enthält; vielleicht waren diese Notizen für eine Predigt gedacht. Moignet betont zu Recht die Tatsache, dass diese beiden kurzen Sätze drei Subjektpronomina enthalten, ohne jede Hervorhebungsfunktion:1
(40a) […] en noster segneur… ie croi ke uos amee par amos nostre segnor. bin est raison car il uos puet bin rendere2(Woledge/Clive 1964:12, 73; Gysseling 1949:210; „d’une main maladroite et assez archaïque du 11e s.“)
Auf der nächsten Seite derselben Handschrift findet man noch einmal dieselbe Formulierung, diesmal besser geschrieben und von einer späteren Hand („par une main 11e-12e siècle qui écrit mieux“, Gysseling 1949:210):
(40b) ie croi ke uos ames par amoes nostre segnor(Woledge/Clive 1964:73; Gysseling 1949:210)
Wie im Fall des Jonasfragments sind diese Belege sehr wertvoll, denn sie zeigen, dass auch hier wieder in einem Gebrauchstext, der keinen metrischen Einschränkungen unterlag, die Regeln der Setzung des Subjektpronomens (einmal im Hauptsatz und zweimal im Nebensatz) angewendet wurden.3
Alexiusleben (Ende 11. Jh.) 4
(Textumfang: 625 Verse)
Alle Setzungen bzw. Nicht-Setzungen sind regelkonform, nur fehlt manchmal zu Beginn einer Laisse das Subjektpronomen (cf. dazu Beisp. (32)-(33)):
(41) Ø Fud baptizet (V. 31)
(42) Ø Noment le terme (V. 46)
(43) Ø Vint en la cambre (V. 136)
(44) Ø Eist de la nef (V. 211)
Wir finden Nicht-Setzung des Subjektpronomens in Verbindung mit der Negation und in asyndetischer Parataxe nach Komma, Semikolon oder Doppelpunkt bei identischem Subjektreferenten/Topic. Beide Phänomene brauchen nicht mehr kommentiert zu werden (cf. § 3.1). Auch die Konstruktion X-V-Spr, die schon mehrfach erwähnt wurde (cf. Z. 4 der Straßburger Eide), ist nur eine scheinbare Ausnahme von der Regel, denn wir haben gesehen, dass es diesen Konstruktionstypus durchaus gibt, auch wenn er zunächst nur selten vorkommt.
Im Nebensatz finden wir einige „echte“ Ausreißer, nämlich die Nichtsetzung des Subjektpronomens nach der unterordnenden Konjunktion oder dem Relativpronomen, ohne dass ein Element „X“ dafür verantwortlich ist. Zwei Beispiele sind:
(45) [Alexius ist Topic:] Escrit la cartra tute de sei medisme,Cum Ø s’en alat e cum il s’en revint. (V. 284–285)
(46) E ço lur dist cum Ø s’en fuït par mer,E cum il fut en Alsis la citét (V. 381–382)
In V. 285 sollte man Cum il s’en alat und in V. 381 cum il s’en fuït par mer erwarten; diese Unregelmäßigkeiten sind zweifellos dem Metrum (einem Zehnsilbler) geschuldet.5
3.2.4 XII. Jh.
Rolandslied (um 1100) 1
(Untersuchtes Corpus: Laisse I-XXXVII, V. 1–500)
Die Hauptsätze beginnen hier meist mit einem Element „X“, mit der Folge, dass die Setzung des Subjektpronomens in der Struktur X-V-Ø regulär unterbleibt. Dieses Phänomen ist uns zwar nicht neu, es tritt aber im Rolandslied außerordentlich häufig auf:
(47) Ben en purrat Ø [= Charlemagne] lüer ses soldeiers.En ceste tere ad Ø asez osteiét:En France, ad Ais, s’en deit Ø ben repairer. (V. 34–36)
Auch bei Topic-Kontinuität innerhalb desselben Satzgefüges wird es in asyndetischer Parataxe nicht gesetzt. Hier eine Folge derartiger Teilsätze ohne Setzung des Subjektpronomens:
(48) Marsilies fut esculurez de l’ire,Ø Freint le seel, getét en ad la cire.2Ø Guardet al bref, Ø vit la raisun escrite (V. 485–487)
Auch in Verbindung mit der Negation wird das Subjektpronomen oft nicht gesetzt. Während alle genannten Merkmale durchaus den Regularitäten der altfranzösischen Syntax entsprechen, fallen Initialstellungen des Verbs ohne einleitendes Subjektpronomen heraus:
(49) Ø Vindrent a Charles, ki France ad en baillie (V. 94)
(50) „Ø Voelt par hostages“, ço dist li Sarrazins (V. 147)3
(51) Ø Entret en sa veie, si s’est achiminez. (V. 365)4
Bei Stempel (1964:289–292) wird dieses Merkmal ausführlicher diskutiert; er spricht von „Verbalasyndese“, und dies in einem Kapitel, das „Epische Asyndese“ überschrieben ist. Auch Franzén (1939:50) sieht die Initialstellung des Verbs ohne das zu erwartende vorausgehende Subjektpronomen als ein Charakteristikum der Chansons de geste an (cf. den Kommentar zu Beisp. (32)-(33)).
Es fällt auch auf, dass im Nebensatz das Subjektpronomen oft nach der unterordnenden Konjunktion oder dem Relativpronomen fehlt; eine weitere Unregelmäßigkeit:
(52) „S’Ø en volt ostages, e vos l’en enveiez“ (V. 40)
(53) Quant Ø se redrecet, mult par out fier lu vis. (V. 142)
(54) Quant Ø le dut prendre, si li caït a tere. (V. 333)
In diesem Text gibt es damit eine Reihe von Auffälligkeiten gegenüber dem in § 2 Gesagten. Die verb-initialen Strukturen in Beisp. (49)-(51) entsprechen einem „epischen Stil“, und die fehlenden Subjektpronomina in Beisp. (52)-(54) sind höchstwahrscheinlich dem Metrum (einem Zehnsilbler) geschuldet. Auch aufgrund der häufigen regulären Nichtsetzungen wie in Beisp. (47)-(48) kann leicht der Eindruck der „Beliebigkeit“ der Setzung des Subjektpronomens in diesem Text entstehen.
Adamsspiel (2. Hälfte 12. Jh.) 5
(1. Teil. Textumfang: 588 Verse)
Dieser Text, der metrisch gebunden ist (Acht- und Zehnsilbler), konstituiert das älteste religiöse Drama (cf. Hasenohr/Zinc 1992:863); er wurde also gesprochen.6 Hier finden wir sehr häufig das Subjektpronomen am Satzanfang vor dem Verb; vor allem auch in der 1. Ps. Sg. und 2. Ps. Sg.:
(55) F. [= Figura (Gott)]: Je te aj fourme a mun semblant (V. 3)7
(56) F.: Je tai dune bon cumpainun (V. 8)
Diese Tatsache ist natürlich der genannten Textsorte geschuldet, in der die Dialogpartner häufig Subjektfunktion haben. Aber auch in den anderen Personen steht das Subjektpronomen häufig satzeröffnend:
(57) D. [der Teufel/die Schlange]: Il [= Adam] est plus durs que nest emfersE. [Eva]: Il est mult francs (V. 222–223)
Es gibt nur selten ein „X“ in Initialstellung, das die Inversion und damit die Nicht-Setzung des Subjektpronomens auslösen würde. Das ist meines Erachtens generell der Grund für die höhere Frequenz des Subjektpronomens in den Passagen direkter Rede als in den narrativen Textpassagen.8
Vereinzelte „Ausreißer“ sind im Hauptsatz die Nicht-Setzung des Subjektpronomens am absoluten Satzanfang:
(58) F.: Adam – A.: Sire – F.: Ø Dirrai toi mon auis (V. 80)
(59) F.: Ø Manias le fruit sanz mon otroi (V. 423)
und in Nebensätzen fehlt manchmal das Subjektpronomen nach der unterordnenden Konjunktion oder dem Relativpronomen:
(60) F.: Si Ø uos faire ma uolente (V. 26)
Beide Phänomene sind wahrscheinlich dem Metrum geschuldet.
Li Quatre Livre des Reis (QLR; 2. Hälfte 12. Jh.) 9
(Untersuchtes Corpus: Buch II (= 2. Buch Samuel), Kap. I, 1 – VII, 7 (S. 61–71))
(Anglofranzösisch)
Zusammen mit den Interlinearübersetzungen der Psalmen, die zeitlich früher entstanden sind (v. infra), konstituieren die QLR die älteste überlieferte französische Prosa. Curtius (1911: XCIII-XCV) macht gute Gründe dafür geltend, warum diese Sprachdenkmäler gerade in England entstehen konnten. Vorlage des Übersetzers der vier Bücher der Könige war der Text der Vulgata, aber in einer anderen Rezension als der heute gültigen. Neben gewissen Veränderungen am Text wurden auch zahlreiche Glossen in die QLR eingefügt (cf. Curtius 1911:LX-LXXI).
Franzén (1939:33–34) hat Buch II (S. 61–109) in Bezug auf die Setzung des Subjektpronomens untersucht und kommentiert. Er konnte nur diejenigen Passagen mit der lateinischen Vorlage vergleichen, in denen der Wortlaut der QLR dem heute gültigen Text der Vulgata entspricht. In diesen stellt er fest, dass der Übersetzer das Subjektpronomen regelmäßig am Satzanfang hinzufügt:
(61) Doleo super te: Jo duil sur tei (I, 26; S. 62)
und in Nebensätzen:
(62) loca, quae transivi: les liéus ú jó passái (VII, 7; S. 71)10
Dabei stellt Franzén verblüffende Parallelen mit der altfranzösischen Interlinearversion des Psalters in der Hs. Arundel 230 fest, die er ebenfalls analysiert hat (cf. dazu infra).
Auch Herman (1990 [1954]:260–284) hat sich detailliert mit einem Auszug der QLR (Buch III, Kap. VII-XX, S. 126–165) befasst.11 Neben nominalen Subjekten in der Position vor und nach dem Verb listet er in einer Tabelle (S. 262) die Ergebnisse für seine Zählung der Subjektpronomina auf. In Hauptsätzen zählt er in seinem Corpus 75 Fälle in Voranstellung und 10 Fälle in Postposition. In Nebensätzen findet er sogar 148 Fälle, alle in Voranstellung vor dem Verb. Für die Setzung des Subjektpronomens versucht er, funktionale Gründe zu finden.12
Weder Franzén (1939) noch Herman (1990 [1954]) erwähnen die Tatsache, dass in den QLR der Hauptsatz oft mit dem Verb beginnt, ohne dass das Subjektpronomen davor gesetzt würde, da sie sich nur für dessen Setzung interessieren. In meinem Teilcorpus habe ich auf 10 Seiten 16 Fälle gezählt. Zwei Beispiele:
(63) Reparlad en ceste maniere á ces de Benjamin. (III, 19; S. 66)
(64) Vint en Ebron […] (III, 20)
Die lateinischen Entsprechungen in der Vulgata lauten:13
(63') Locutus est autem Abner etiam ad Benjamin.
(64') Venitque ad David in Hebron […]
Diese auffälligen Nicht-Setzungen des Subjektpronomens am Satzanfang widersprechen der Beleglage in den bisher untersuchten Corpora, wo es nur vereinzelte „Ausreißer“ dieser Art gab, cf. Beisp. (32)-(33) im Leodegarlied, Beisp. (41)-(44) im Alexiusleben und Beisp. (49)-(51) im Rolandslied. Da in den QLR weder das Metrum eine Rolle spielt noch „epischer Stil“ vorliegen kann, haben wir es aller Wahrscheinlichkeit nach hier mit einen Latinismus zu tun.14
Psalmen
Die anglofranzösischen Interlinearübersetzungen der Psalmen sollen an den Schluss unseres Überblicks gestellt werden, obwohl sie zeitlich vor den QLR anzusetzen sind;15 sie sind aber nicht Teil unseres Corpus.
Franzén (1939) hat die Hs. von Arundel (Arundel 230) untersucht und gezeigt, dass es sich um eine „Wort für Wort“-Übersetzung – z.T. ohne Rücksicht auf die altfranzösische Syntax, cf. Franzén (1939:30) – aus dem Lateinischen handelt. Dennoch hat der Übersetzer in 322 Fällen das Subjektpronomen hinzugesetzt, ohne dass die Vorlage einen Anlass dazu bot. Franzén bemerkt dazu: „En exprimant les pronoms sujets […], il [le traducteur] n’a fait que suivre les habitudes syntaxiques de sa propre langue“ (Franzén 1939:30). Das Subjektpronomen wird im Hauptsatz am absoluten Satzanfang hinzugesetzt:
(65) Odisti oms16 qui opantur17 iniquitatem: Tu hais tuz cels ki ouerunt felunie(Franzén 1939:31)
Das Subjektpronomen steht jedoch nicht, wenn dem Verb ein betontes Element vorausgeht (ibid. 31). Im Nebensatz steht das Subjektpronomen zwischen dem subordinierenden Element und dem Verb:
(66) cum clamauero ad eum: quant io crierai a lui(Franzén 1939:31)
Auch Herman (1990 [1954]:240–259) hat die Psalmen untersucht. Im Psalter von Cambridge (C) zählt er 355 Fälle von hinzugesetzten Subjektpronomina, von denen 332 Fälle dem Verb vorausgehen (ibid. 252–253). Er schließt aus, dass die Setzung mit einem „besoin de clarté“ zu tun habe, da die Verbendungen vollständig erhalten sind, und schlägt stattdessen vor, dass das Subjektpronomen, das er als betontes Element ansieht, als „,introducteur‘ accentué“ (ibid. 254) diene, damit das Verb nicht in die Erstposition gerate, und si ablöse, das im Jonasfragment mehrfach in Initialposition auftrete (ibid. 255). Nach Franzén (der bei Herman 1990 [1954]:254 ausführlich zitiert wird) ist das Subjektpronomen allerdings unbetont. Dafür hat Franzén überzeugende Argumente, vor allem die gehäuften Vorkommen in Nebensätzen:
On ne saurait expliquer l’usage fréquent qu’ont fait des pronoms sujets le traducteur des Quatre livres des rois et celui du manuscrit Arundel, à moins qu’on n’admette l’emploi atone de ces mots dès le XIIe siècle. Encore n’est-il pas question d’un développement naissant, mais d’un usage solidement établi, ce que prouve avant tout la fréquence des pronoms sujets dans les subordonnées. (Franzén 1939:34)
Franzén geht auch auf die Frage ein, ob sich das Französische in England im 12. Jh. von dem des Kontinents unterschieden habe. Das verneint er:
Les traductions que nous venons d’examiner [= die Psalmen und die QLR] sont – on le sait – d’origine anglo-normande. Le français continental ne se distinguait pas de l’anglo-normand en ce qui concerne l’emploi des pronoms sujets. La statistique qui précède montre une grande conformité entre tous les textes examinés, quelle que soit leur origine. Si, au XIIe siècle, les pronoms sujets étaient devenus atones dans le dialecte anglo-normand, il en était assurément de même dans la langue du continent. (Franzén 1939:34)
Auch Moignet (1965:91), der Franzéns Analyse aufgreift, ist dieser Meinung, wenn er resümiert: „C’est donc que, pour les traducteurs des Psautiers, le verbe français accompagné du pronom est l’équivalent exact du verbe latin sans pronom“.
Diese Beobachtungen passen gut zur folgende Annahme von Price (1979:§ 11.5.4): „It seems probable that the construction SpV was already well-established in the pre-literary period.“
4 Diskussion
4.1 Synchrone Beschreibung der Fakten
Sowohl Foulet (1968 [1930]) als auch Franzén (1939) haben die Regelmäßigkeiten der Setzung bzw. der Nicht-Setzung des Subjektpronomens im Altfranzösischen beschrieben. Beide stellten auch schon die „Asymmetrie“ der Setzung im Hauptsatz und im Nebensatz fest (cf. § 2): da unterordnende Konjunktionen oder das Relativpronomen nicht als Element „X“ gelten, das die Inversion i.a. mit der Folge der Nicht-Setzung des Subjektpronomens auslöst, erscheinen Subjektpronomina wesentlich frequenter in Nebensätzen als in Hauptsätzen. Was fehlt, ist noch eine Erklärung dieser Tatsache.1
4.2 Zu einer Erklärung: Sprachkontakt mit dem Altwestfränkischen
Kuen (1970 [1957]) hatte mit überzeugenden Gründen die Meinung vertreten, dass die Existenz des Subjektpronomens im Altfranzösischen auf Interferenzen des Altwestfränkischen mit dem Galloromanischen zurückzuführen sei. Die Entdeckung, die die Nicht-Setzung des Subjektpronomens unter bestimmten syntaktischen Voraussetzungen erklären kann, ist Hilty (1968) zu verdanken, der zufällig Kenntnis von der Züricher Dissertation Eggenbergers (1961) bekommen hatte, in der die Setzung des Subjektpronomens im Althochdeutschen beschrieben wird. Daraus geht hervor, dass in der Inversion das Subjektpronomen im Althochdeutschen fehlen kann und meist auch fehlt (cf. Eggenberger 1961:143–144). Nach Auskunft von Damaris Nübling (Mainz) ist diese Tatsache bei den Germanisten „Standardwissen“. Die Parallelen mit dem Altfranzösischen sind frappierend. So vergleicht z.B. Kattinger (1971) in Kap. III seiner Arbeit die Daten des Altfranzösischen mit denjenigen des Althochdeutschen und Altenglischen.1 Nicht nur im Althochdeutschen, sondern auch im Altenglischen erfolgt nach „betonten Ausdrücken“ am Satzanfang Inversion oder Nicht-Setzung des Subjektpronomens (zu Unterschieden des Altenglischen gegenüber dem Althochdeutschen und Altfranzösischen cf. Kattinger 1971:167). Zum Althochdeutschen konstatiert Kattinger: „Ähnlich wie im Afrz. ist […] auch im Ahd. die ungerade Wortfolge (Typ VI, VIa) für den Hauptsatz, die gerade Wortfolge (Typ I) für den Nebensatz charakteristisch“ (ibid. 170).2 Mit anderen Worten: auch im Althochdeutschen ist die Setzung des Subjektpronomens in Nebensätzen wesentlich häufiger als in Hauptsätzen (cf. Eggenberger 1961:143, Sonderegger 1979:268, Szczepaniak 2011:119 und Fleischer 2011:199–200, 202). Man ist erstaunt zu sehen, dass Hiltys wichtige Bemerkungen, die die identischen Phänomene in beiden Sprachen miteinander in Verbindung bringen, in der Forschung bislang offenbar unbeachtet blieben.3 Vermutlich hat das mit der Abneigung der Forschung in den Sechziger Jahren gegenüber jeder Art von „Substrat- und Superstrat-Theorie“ zu tun, mit der zugegebenermaßen oft übertrieben wurde. Die negativen Besprechungen von Hiltys Artikel (1968) durch Stempel (1970) und Hunnius (1975) werden dazu beigetragen haben.4
Die Regel der Nicht-Setzung des Subjektpronomens nach „X“ gibt es übrigens noch in den aktuellen bairischen und alemannischen Dialekten bei der 2. Ps. sg. (cf. auch Kaiser 2014:269). So heisst es im Bairischen zwar Du spinnst!, aber in Inversion
(67) Jetzt spinnst Ø aber
(68) Da legst Ø di nieder!
Da hier eventuell der auslautende Dental der Verbform in der 2. Ps. sg. das Subjektpronomen absorbiert haben könnte, seien noch eindeutige Beispiele aus dem Alemannischen angeführt. Im alemannischen Dialekt heisst es Du bisch, aber
(69) Mit Achtzig bisch Ø en alte Maa.5
(70) jetz bisch Ø aber verschrocke6
4.3 Zu Zimmermanns Kritik (2014) an dem „Borrowing approach“
Zimmermann (2014) möchte in Kap. 3.1.4 „The ‚borrowing approach‘“ (ibid. 79–84) seines Buchs in fünf Kritikpunkten die Annahme widerlegen, die Existenz des Subjektpronomens im Französischen sei auf Interferenz des (Proto-) Altfranzösischen mit dem Altwestfränkischen zurückzuführen. Er kommt zu dem Schluss: „[A]n approach to the expression of expletive and referential subject pronouns in terms of (syntactic) borrowing in the context of language contact is highly improbable“ (Zimmermann 2014:84). Gehen wir die Punkte nacheinander durch. Vorauszuschicken ist, dass borrowing (‚Entlehnung‘) in diesem Zusammenhang kein geeigneter Terminus ist, denn es sind „Reliktmerkmale“ in der Sprache der Sprecher, die die Sprache gewechselt haben (und die dann von anderen Sprechern imitiert werden).1
1. Zur Tatsache, dass Subjektpronomina im Altfranzösischen häufiger in Nebensätzen als in Hauptsätzen auftreten: „This is unexpected under the present approach, given its crucial underlying assumption that in the Germanic variety of the Franks, expletives and referentials are consistently expressed“ (ibid. 81). Dazu ist erstens zu sagen, dass expletive und referentielle Pronomina nicht gemeinsam beschrieben werden dürfen (cf. § 3.1; im Folgenden verstehe ich unter „Subjektpronomen“ immer das referentielle Subjektpronomen), und zweitens, dass im Althochdeutschen (und folglich wohl auch im Altwestfränkischen) das Subjektpronomen in Inversion fehlen kann und meist auch fehlt, wie Eggenberger (1961) gezeigt hat; es ist also nicht „constantly expressed“.
2. Zur chronologischen Diskrepanz. Dass sich die obligatorische Setzung des Subjektpronomens erst im 17. Jh. vollständig durchsetzt, ist für Hunnius (1975) und Zimmermann ein gewichtiges Argument, Superstrat-Einfluss zurückzuweisen. Dazu hat jedoch schon Hilty (1975:425) auf klare Weise Stellung bezogen.2 Er weist darauf hin, dass nach der Epoche des Altfranzösischen die Inversionsregel abgeschafft wurde, die für die (fast) regelmäßige Nicht-Setzung des Subjektpronomens verantwortlich war. Damit setzt sich ab dem Mittelfranzösischen die Stellung X-Spr-V durch, die zuvor extrem selten war. In Hiltys Worten: „Es ging weitgehend um die Eliminierung jenes häufigen altfranzösischen Satztypus, in dem das Subjektpronomen nicht gesetzt wurde, weil die Inversionsregeln spielten [also X-V-Ø, B.W.], und um die Verallgemeinerung jenes anderen Satztypus, in dem das Pronomen seit ältester Zeit auftrat [also Spr-V, jetzt auch in X-Spr-V; B.W.].“3
Man muss sich natürlich fragen, wieso die Inversionsregel samt der Regel oder der Tendenz der Nicht-Setzung des Subjektpronomens ab dem Ende des 13. Jh.’s/Anfang des 14. Jh.’s entfiel. Dafür kann man den Prozess der „Degermanisierung“ im Mittelfranzösischen verantwortlich machen, cf. Wehr (2013:199–205; 2017:80). Was in den folgenden Jahrhunderten bezüglich der Setzung/Nicht-Setzung im Französischen geschieht, ist eine Entwicklung, die uns in diesem Zusammenhang nicht weiter zu interessieren braucht (cf. den Überblick bei Zimmermann 2014:19–25).
3. Unter diesem Punkt werden Ansichten zur zunehmenden Setzung des Subjektpronomens ohne die Funktion von Emphase oder Kontrast in den südamerikanischen Varietäten des Portugiesischen und Spanischen referiert, die ich für die vorliegende Diskussion für irrelevant halte.
4. Syntaktische Entlehnungen seien zweifelhaft („Syntactic borrowing is dubious“). Hierbei handelt es sich um ein verbreitetes Vorurteil. In Adstrat-Situationen oder Phasen der Bilingualität kann einfach alles durch Interferenz übernommen werden (cf. Thomason 2001:63). Bei Interferenzen durch Sprachkontakt sind als erstes Phonetik/Phonologie und die Syntax betroffen, cf. Thomason/Kaufman (1988:39): „[U]nlike borrowing, interference through imperfect learning does not begin with vocabulary: it begins with sounds and syntax“ (Hervorhebung von Thomason/Kaufman) und „Moderate to heavy substratum/superstratum/adstratum interference, especially in phonology and syntax“ (ibid. 50).4 Kuen (1970 [1957]:168–171) führt überzeugend eine Reihe von Beispielen aus romanischen Sprachen und Dialekten im Kontakt mit dem Germanischen und dem Griechischen an. Die nördliche Galloromania zur Zeit des Altfranzösischen ist ein besonders fruchtbares Forschungsgebiet für syntaktische Interferenzen, denn hier kann neben der Voranstellung des attributiven Adjektivs auch die Endstellung des Prädikats in Nebensätzen auf germanischen Einfluss zurückgeführt werden (cf. Wehr 2013:197–198).5 Es ist auch nicht so, dass in eine Sprache nur übernommen werde, was in ihr schon „angelegt“ sei (so Hilty 1968; cf. dazu Wehr 2013:210–211) – auch das gehört zu den verbreiteten Vorurteilen.
5. Hier geht es bei Zimmermann noch einmal um expletive Subjektpronomina, wobei auf widersprüchliche Weise6 festgestellt wird, sie seien im Althochdeutschen noch nicht obligatorisch gewesen. Aber das waren sie im Altfranzösischen ja auch noch nicht.