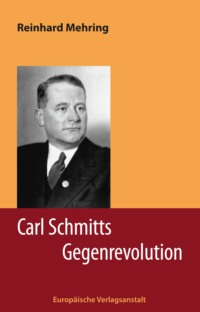Kitabı oku: «Carl Schmitts Gegenrevolution», sayfa 3
4. Positionierung zu Kaufmanns Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie
An einer Stelle seiner Binder-Rezension deutet Schmitt an, dass Kelsen der naiven Verwechselung von Macht und Recht, Sein und Sollen entgangen sei. Schmitt lobt die „Konsequenz, mit der z.B. Kelsen die Jurisprudenz als normative Wissenschaft den soziologisch explikativen Wissenschaften gegenüberstellt“ (SS 178). Stammler wie Binder verwechselten ihren Rechtspositivismus dagegen mit transzendentaler Rechtsphilosophie. Schon früh sieht Schmitt also Kelsens Schritt vom Positivismus zum Normativismus als solchen, während er Jellinek als Ausgangspunkt nicht weiter erwähnt. Er nimmt die Theoriedynamik mit eigenem Impetus innovativ wahr und betrachtet Kelsen als Erben Jellineks. Kelsen legte das selbst nahe, obgleich er keinen persönlichen Zugang zu Jellinek fand.20 Für Schmitt lag eine Weiterführung seiner Kritik der neukantianischen Rechtslehre durch Auseinandersetzung mit Kelsen also akademisch schon früh nahe; 1922 knüpfte er in seiner Politischen Theologie auch explizit an Kelsen an. Dazwischen liegt aber das Erscheinen von Erich Kaufmanns (1880–1972) Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie von 1921, das für Schmitt schon deshalb wichtig war, weil er damals als Nachfolger Smends in Bonn Kaufmanns direkter Kollege wurde. Smend war mit Kaufmann seit Studientagen spannungsvoll befreundet; er betrieb Schmitts Berufung, die ohne Kaufmanns unterstützendes Plazet gewiss nicht erfolgt wäre. Kaufmann zitierte in seiner Kritik der neukantianischen Rechtslehre Schmitts Binder-Kritik zustimmend, nahm dessen verwandte Kritik zur Kenntnis. Für Schmitt lag es 1922 also akademisch nahe, seine Auseinandersetzung mit der neukantianischen Rechtslehre mit Kelsen weiterzuführen und sich hier zu Kaufmanns exponierter Kritik zu positionieren.
Die Schrift Politische Theologie wird heute selten in der Erstausgabe von 1922, mehr in der Ausgabe von 1934 gelesen, der alle neueren Ausgaben folgten. Es ist deshalb kaum bekannt, dass Schmitt 1933 seitenlange Ausführungen21 zu Kaufmann strich, mit dem er sich Mitte der 1920er Jahre verfeindet hatte. Schmitt tilgte alle früheren positiven Referenzen, aus persönlicher Feindschaft, Opportunismus und Kampf gegen „jüdischen“ Geist. Das ohnehin schwierige wissenschaftsgeschichtliche zweite Kapitel seiner Programmschrift wurde dadurch im Gedankengang fast unverständlich; es gewann seine Gliederung aber gerade durch seinen aktuellen Bezug auf Kaufmanns Kritik der neukantianischen Rechtslehre. Schmitt positionierte sich, gerade in Bonn angekommen, eingehend zu seinem Bonner Kollegen. Das Kapitel beginnt 1922, laut Inhaltsübersicht, mit neueren Schriften zur Staatslehre: „Kelsen, Krabbe, Wolzendorff, Erich Kaufmann“. Die Ausführungen zu Kaufmann, über drei Seiten lang, sind später dann vollständig gestrichen.
Kaufmanns 1921 erschienene Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie22 geht von einer Stammler- und Kelsen-Kritik aus und schlägt vehement auf den „Formalismus“ und „Positivismus“ von Stammler, Binder und anderen ein. Sie zitiert Schmitts Binder-Kritik zustimmend,23 klagt aber, anders als Schmitt, „Metaphysik“ ein und ruft gegen den Neukantianismus zum „wahren“ Kant zurück. Kaufmann grenzt sich scharf von Stammler, Kelsen und dessen Wirkungen ab, konzediert aber ähnlich wie Schmitt:
„Konnte nach alledem der südwestdeutsche Neukantianismus eine eigentliche Rechtsphilosophie nicht begründen, so konnte er auf der anderen Seite durch sein Einmünden in den Rechtspositivismus und seine Tendenz, philosophische Fragen in methodologische Fragen aufzulösen, die Methodenlehre der positiven Rechtswissenschaft fördern und anregen.“24
„Der metaphysikfreie Neukantianismus ist substanzloser Rationalismus“,25 meint Kaufmann; Kelsen habe als „Meister des Rechtsformalismus“ immerhin einige „Reinigungsarbeiten“ erledigt. Kaufmann macht den Neukantianismus für eine gegenwärtige „Krisis“ des „deutschen Geistes“ verantwortlich und meint am Ende:
„Aushöhlung und Entleerung alles Lebendigen ist das letzte Wort. Erkenntnistheorie ohne Wahrheitsbegriff, Psychologie ohne Seele, Rechtswissenschaft ohne Rechtsidee, formale Gesinnungsethik ohne Sittlichkeitsbegriff, Geisteswissenschaft ohne Gefühl für konkrete Geistigkeiten sind die Kinder der Zeit. Nirgends ein leerer Halt in den uferlosen Meeren der leeren Formen und der vom Denken nun einmal nicht auflösbaren empirischen Tatsächlichkeit. So wurde der Neukantianismus, ohne es selbst zu ahnen, das Gegenteil dessen, was er wollte: der unmittelbare Wegbereiter jener an sich selbst verzweifelnden Spengler-Stimmung, der jüngsten Erkrankung unserer, einer Metaphysik des Geistes beraubten Volksseele.“26
Es ist hilfreich, Kaufmanns Ton von 1921 zu hören, um Schmitts Krisis-Ton besser einzuordnen. Schmitts Schrift Politische Theologie beginnt im ersten Kapitel mit einer „Definition der Souveränität“ und schließt mit dem zweiten Kapitel eine akademische Auseinandersetzung mit neueren Staatslehren an, die die frühere Neukantianismus-Kritik weiterführt und eine idealtypische Kontrastierung von Normativismus und Dezisionismus skizziert. Im titelgebenden Kapitel „Politische Theologie“ ordnet Schmitt diese Alternativen dann in eine metaphysikgeschichtliche Skizze ein. Was zunächst als einfache Alternative erscheint, wird damit im „Übergang von Transzendenzvorstellungen zur Immanenz“ als geschichtliche Entwicklung fatal und prekär. Am Ende des zweiten Kapitels scheint Schmitt für seine „dezisionistische“ Souveränitätslehre eine starke Gegenposition zum Neukantianismus aufzubieten. Wo Kaufmann zu Kant zurückrief, geht Schmitt mit Hobbes aber auf ein älteres „Weltbild“ zurück, das eigentlich kaum zu vertreten sei. Im vierten und letzten Kapitel stellt er sich deshalb auch in die Reihen der „Gegenrevolution“. Dieser Rückgang hinter Kant auf Hobbes ist signifikant: Schmitt strebt bereits aus dem Mainstream heraus zu einem unzeitgemäßen Autor, mit dem er sich identifiziert.
Die Auseinandersetzung mit Kelsen und Kaufmann ist für die akademische Profilierung dieser überraschenden Volte, des Rückgangs hinter Kant auf Hobbes, wichtig. Während die – hier nicht näher zu analysierende – erste eingehende Auseinandersetzung mit Kelsen eine Fortsetzung der früheren Auseinandersetzung mit dem neukantianischen Transzendentalismus war, geht Schmitt mit Krabbe und Wolzendorff dabei auch auf die Genossenschaftstheorie zu, die er stets als „organischen“ Gegenspieler der mechanistisch-positivistischen Linie Labands betrachtete, die mit Kelsen endete. Schmitt stellt Krabbe und Wolzendorff in die Linie der Genossenschaftstheorie, die Gierke begründete und mit Preuß und Smend in Weimar triumphierte, weil sie die staatsbürgerliche Politisierung und Demokratisierung besser zu erfassen vermochte. Schmitts Ausführungen sind nicht leicht nachvollziehbar. Es sei nur erwähnt, dass Schmitt mit dem gerade verstorbenen Wolzendorff in engerer Korrespondenz stand27 und seine Ausführungen deshalb auch einen nekrologischen Nebenaspekt haben. Die Fassung von 1934 springt sehr plötzlich von Wolzendorff zu Max Weber, weil sie Kaufmann herausgekürzt und exorziert hatte. Nur von den Kaufmann-Ausführungen von 1922 her wird aber verständlich, dass Schmitt über Kaufmanns Kritik hinausgeht, indem er hinter Kant auf Hobbes zurückgeht. Dabei stellt er Kaufmanns Schlussfolgerungen korrekt dar; er fragt aber gegen Kaufmanns Konfrontation von „Form“ und „Leben“ leicht skeptisch und spöttisch:
„Ist das die goldene Mitte zwischen den beiden Extremen Formalismus und Nihilismus und nur eine Wiederholung jener alten Antithesen von lebendig und tot, organisch und mechanisch usw.? Kaufmann hat bisher eine Darstellung einer Lebens- oder Irrationalitätsphilosophie nicht gegeben.“28
Diese Formulierungen zeigen schon, dass Schmitt seine Wendung zur „Irrationalitätsphilosophie“, wie sie die Parlamentarismus-Broschüre ausführt, als weiterführende Antwort auf den Bonner Kollegen exponiert. Zuvor bemerkt er im ersten Kapitel seiner Programmschrift, dass auch Kaufmann, ähnlich wie Anschütz, „die extremen Fälle vom Recht ausschließen“29 wolle. Schmitts so akademisches, den Forschungsstand rekapitulierendes zweites Kapitel, „das Problem der Souveränität als Problem der Rechtsform und der Entscheidung“ übertitelt, hat seine Pointe aber in der Überbietung von Kaufmanns Kritik durch den Rückgang auf Hobbes. Wo Kaufmann einen Rückgang hinter den zeitgenössischen Neukantianismus auf Kant proklamierte, ruft Schmitt zu Hobbes zurück und stellt die „Gegenrevolution“ in dieses Erbe.
5. Transzendentale Souveränität?
Schmitt schließt 1922 also mit seiner Positionierung zu Kaufmann seine eigene Kritik der neukantianischen Rechts- und Staatslehre ab, die er in seiner Habilitationsschrift begonnen hatte und in der Binder-Besprechung weiterführte. Wo er vor 1918 diagnostizierte, dass der Neukantianismus auf dem „schmalen Weg des Transzendentalismus“ gestrandet sei und den Transzendentalismus an Positivismus und Methodologie verraten habe, scheint er der „Machttheorie“ nun selbst zu verfallen. Das zeigt sich insbesondere im phänomenologischen und anerkennungstheoretischen Hinweis auf die „religiöse“ „Bewertung“ faktischer Macht als Recht. Vielleicht suchte Schmitt mit seiner Souveränitätslehre eine eigene Variante des „Transzendentalismus“. Wiederholt habe ich seine Habilitationsschrift als „transzendentalpragmatische“ Grundlegung bezeichnet.30 Schmitt nannte eine „relativ dauernde und beständige Macht“, wie zitiert, ein „Symbol oder Indiz einer Qualität“ (WdS 35): nämlich des Rechts, und er berief sich dafür auf kirchenrechtliche Literatur. Beide Aspekte kehren in der Politischen Theologie wieder: Schmitt anerkennt 1922 nicht jede Macht als Recht, er erkennt nur derjenigen Macht eine Rechtsqualität zu, die den „Ausnahmezustand“ entscheidet, einen Normalzustand schafft und also Ordnung stiftet.
Wo Schmitt im Wert des Staates auf kirchenrechtliche Literatur verweist, skizziert er 1922 seine „begriffssoziologische“ These und Skizze vom Wandel des Weltbildes und „Übergang von Transzendenzvorstellungen zur Immanenz“. Vergleicht man diese Säkularisierungsthese – Schmitt spricht im Vorwort zur zweiten, revidierten Auflage, auf Webers „Zwischenbetrachtung“ anspielend, von Stufen eines „Säkularisierungsprozesses“ – etwa mit Wilhelm Diltheys „Weltanschauungslehre“ und „Philosophie der Philosophie“, so konstatiert Schmitt keine Pluralität konsequent möglicher Idealtypen, die zur alternativen Option stünden, sondern eine historische Abfolge. Was er im „Ausnahmezustand“ praktisch für nötig erachtet: die souveräne Entscheidung, historisiert er in den „metaphysischen“ Voraussetzungen. Damit formuliert er einen zwiespältigen Befund: Systematisch betont er, dass dezisionäre Entscheidungen einen starken Personalismus fordern, der auf „Transzendenzvorstellungen“ beruht und eigentlich nur in einem „theistischen“ Weltbild begründet und gehalten sei; säkularisierungsgeschichtlich konstatiert er aber, dass dieses Weltbild seit der Französischen Revolution mit dem Übergang zur Volkssouveränität und demokratischen „Immanenzvorstellungen“ hoffnungslos in die Defensive geraten sei und die „Gegenrevolution“ deshalb schon 1848 ihre „Legitimität“ verlor. Auch Schmitt konstatiert also, ähnlich wie Kaufmann, eine metaphysische „Krisis“. 1922 weist er Kaufmanns Ruf nach dem „Lebensgefühl“ und einer „Metaphysik des Geistes“ dennoch zurück. Die „Darstellung einer Lebens- oder Irrationalitätsphilosophie“, die er 1922 bei Kaufmann vermisst, wird er 1923 im Schlusskapitel seiner Broschüre Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus dann in Georges Sorels „Lehre vom Mythos“ finden, die Mussolini mit dem Marsch auf Rom gerade einem nationalistischen Praxisbeweis unterzog.
6. Rekapitulation
Schmitts Binder-Rezension von 1916 wurde hier als ein missing link in der Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie betrachtet, die 1914 mit dem Wert des Staates begann und mit der Politischen Theologie zu einem Abschluss gelangte. Der Neukantianismus beschränkte den erkenntnistheoretischen Grundansatz Kants stark auf Wissenschaftstheorie und Methodologie. Wie gelangte man philosophisch über ihn hinaus? Der philosophische Gegenwartsdiskurs antwortete mit einer Wendung zu Hegel31 oder (etwas später) einer erneuten Rückkehr zu Kant und zu strikter Kant-Philologie (Julius Ebbinghaus u.a.). Die juristische Rezeption folgte mit Binder und Larenz der Wendung zu Hegel und entwickelte einen stark politisierten Rechtshegelianismus, der sich dem Nationalsozialismus empfahl. Schmitt dagegen prüfte seine schwache transzendentalpragmatische Auslegung der Rechtsidee (aus dem Wert des Staates) vergleichend und lehnte Binders Auslegung ab. Mit der Politischen Theologie nahm er 1922 dann seinen Abschied vom Neukantianismus, indem er seine schwach-transzendentale Auslegung der „Rechtsidee“ als Souveränitätslehre explizierte und sich vom Bonner Kollegen Erich Kaufmann absetzte, indem er seinen Referenzkanon umstellte: Wo Kaufmann einen Rückgang auf Kant, „Leben“ und „Metaphysik“ gegen den Neukantianismus (und namentlich auch Kelsen) setzte, proklamierte Schmitt einen souveränitätstheoretischen und „gegenrevolutionären“ Rückgang auf Thomas Hobbes und Donoso Cortés. Seine schwache Lesart der Rechtsidee hatte 1914 vor allem besagt: Der Staat muss sich als „Diener des Rechts“ darstellen und die Differenz von Macht und Recht konstitutionalisieren, indem er sie für sich reklamiert und behauptet. Mit seiner Souveränitätslehre betont Schmitt 1922 nun die konstitutive Ordnungsleistung des Souveräns als Koinzidenzfall von Macht und Recht: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet; das heißt auch: Wenn die Machtbehauptung Gehorsam findet, ist sie im Recht; sie setzt dann die Differenz von Macht und Recht als Ordnungsund Friedensfunktion.
Mit dieser Auslegung der „Rechtsidee“ als Souveränitätslehre war Schmitts Bedarf an rechtsphilosophischer Fundamentierung gleichsam erschöpft. Er sprach nicht weiter im Namen der Rechtsphilosophie, entsagte jeder naturrechtlichen Philosophie, kritisierte philosophische Grundlegungen als Rechtfertigungsideologien und Bürgerkriegsparolen und sprach stattdessen nur noch von Legalität und „Legitimität“. Seine Lage als Jurist situierte er stets „zwischen Theologie und Technik“. Der Theologie billigte er dabei immerhin zu, im Namen der „Offenbarung“ die diskursive Zugänglichkeit letzter Fragen zu tabuisieren und die philosophische Kritik zu suspendieren. Zwar rekurrierte Schmitt auf den „Dezisionismus“ von Thomas Hobbes, wo Kaufmann Kant gegen den zeitgenössischen Neukantianismus ausgespielt hatte. Den philosophisch-naturrechtlichen Ansatz von Hobbes ignorierte er aber stets. Sein Leviathan-Buch interessierte sich 1938 nur noch für den Mythenpolitiker. Philosophisch neigte Schmitt zwar in mancher Hinsicht Hegel zu; niemals äußerte er sich darüber aber eingehender. Seine Reserve gegenüber dem zeitgenössischen Neuhegelianismus war nicht zuletzt politisch motiviert: nicht nur gegenüber dem Links-Hegelianismus (Lukács), sondern auch gegenüber einem politisierenden Rechts-Hegelianismus, der dem Nationalsozialismus nach 1933 eine Philosophie schenken wollte und so, in anderer Weise als Heidegger, den Traum vom Philosophenkönigtum träumte, den „Führer“ zu führen. Schmitts Entscheidung gegen starke philosophisch-naturrechtliche Legitimierungen der herrschenden Legalität stand eigentlich schon 1922 fest; die Entwicklung des Links- wie Rechtshegelianismus vor und nach 1933 bestätigte ihn dann in seiner Reserve gegenüber starken rechtsphilosophischen Fundamentierungsansprüchen.
Mit der Binder-Rezension markiert Schmitt 1916 bereits seinen Auszug aus der Rechts- und Staatsphilosophie. Seine Transformation der “Rechtsidee“ in die Souveränitätslehre ist im scharfen Rückgang hinter Kant auf Hobbes nur dann deutlich zu sehen, wenn die Erstausgabe der Politische Theologie von der späteren Fassung von 1934 unterschieden wird, die alle Verweise auf Kaufmann gestrichen hat. Schmitt positionierte sich 1922, gerade in Bonn angekommen, zu Kaufmanns Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie, indem er dessen Rückruf zu Kant mit einem Rückruf zu Hobbes konterte. Eine starke Rechtsphilosophie hat er nie zu schreiben beabsichtigt. Er verblieb aber auf dem Boden der zeitgenössischen Lebensphilosophie und Weltanschauungslehre, indem er metaphysikgeschichtliche Voraussetzungen seines starken Dezisionismus und Personalismus problematisierte und historisierte. Schmitt bezog einen verlorenen Posten und sah sich nach seiner Politischen Theologie fortan als unzeitgemäßer Autor und Außenseiter an. Es ließe sich also von einer doppelten Transformation des Transzendentalismus sprechen: Einerseits schrieb Schmitt den Transzendentalismus in das historische Apriori einer Weltanschauungslehre um und andererseits hoffte er doch auf die Selbstbehauptung des Staates in der Setzung der Differenz von Macht und Recht, im außerordentlichen Notrecht des „Ausnahmezustandes“.
II. Offene Anfänge? Carl Schmitts frühe Option für die Gegenrevolution
1. Zwischenkriegszeit
Die Weimarer Republik war der Bundesrepublik niemals nur Geschichte, sondern stets auch eine Mahnung, Lehrstück und Modell. In der Vergangenheitspolitik der alten Bundesrepublik diente „Weimar“ dabei meist als negatives Vorbild. Bonn war nicht Weimar, die Bundesrepublik sollte „Weimarer Verhältnisse“ tunlichst meiden. Die alte Bonner Republik fürchtete die historische Parallele und grenzte sich vielfältig ab. In der Auseinandersetzung mit der Weimarer Verfassung suchte sie in „Widerspruch und Umkehrung“ ein „Gespenst“ zu bannen.32
Die junge Disziplin der „Zeitgeschichte“ begann in den 1950er Jahren mit dem „Untergang“ der Weimarer Republik und der – heute gerne auch als „Machtübergabe“ erörterten – „Machtergreifung“ des Nationalsozialismus. Der Blick auf den Untergang Weimars konzentrierte sich dabei auf das politische System und „Strukturprobleme“ der Verfassung. Karl Dietrich Bracher33 steht – nach althistorischen Anfängen – mit seinen Maßstäbe setzenden Monographien für diese Agenda zeitgeschichtlicher Forschung. Bracher schritt vom Untergang Weimars und den „Stufen der Machtergreifung“ zur Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Diktatur, totalitären Erfahrung und Zeit der Ideologien. Kurt Sontheimer34 sondierte das heute vielfältig weiter ausgeleuchtete „antidemokratische Denken“ der Weimarer Republik und bot Thomas Mann als eine positive Alternative an. Dolf Sternberger35 distanzierte sich vom anti-institutionellen Politikbegriff der verehrten Hannah Arendt im Rückgang auf Aristoteles und setzte die bürgerliche „Vereinbarung“ gegen die anstaltsstaatliche „Herrschaft“. Wolfgang J. Mommsen36 kritisierte in seiner durchschlagenden Dissertation über Max Weber und die deutsche Politik Webers Befangenheit im Wilhelminischen Machtstaatsgedanken und zog eine Linie von Weber zu Schmitt. Der alte Schmitt37 stimmte dieser Weber-Kritik gerne zu, betonte sie doch den Nationalismus im Nationalliberalismus. Tatsächlich unterschätzen wir heute, wie sehr der gegenrevolutionäre Nationalismus nach „Versailles“ ein Gemeinposten bis weit ins nationalliberale Lager war.38 Schmitt vertrat damals mit seiner Positivismuskritik und extensiven Auslegung der Diktaturbefugnisse des Reichspräsidenten zwar eine exponierte Minderheitsposition; seine Verfassungslehre ließ sich bis 1933 aber elastisch als konstruktive Kritik und Verteidigung der „Substanz“ Weimars auffassen.
Die deutsche Staatsrechtslehre knüpfte nach dem revolutionären Bruch des Nationalsozialismus erneut an Theoriedebatten der Weimarer Republik an. Restaurationen des „Naturrechts“ konnten sich nicht durchsetzen. Die rivalisierenden Schüler und Schulen Smends und Schmitts bestimmten das Terrain,39 ohne allzu dogmatisch und epigonal an Weimar anzuknüpfen. Der Theoriebedarf der Rechtswissenschaft war trotz der neuen menschenrechtlichen Fundamentierung nicht sehr groß und die Weimarer Entwürfe galten ein Stück weit als aktuelle Orientierungsposten. Hermann Heller trat seit den 1960er Jahren dann verstärkt als sozialliberales Antidot neben Smend und Schmitt.
Erst in der neuen Bundesrepublik nach 1990 verabschiedete man sich eigentlich von einer direkten Anknüpfung an die Weimarer Theorieentwürfe, pointierte den Abstand und entwickelte eine tiefenscharfe Historisierung der Staatsrechtswissenschaft. Wegweisend wurde hier Michael Stolleis’ magistrale Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Erst seitdem intensivierte sich die – u.a. von Christoph Gusy40 angestoßene - Erforschung des „demokratischen Denkens“ in der Weimarer Republik. Es ist bezeichnend, dass Hugo Preuß als Vordenker und „Vater“ der Weimarer Verfassung erst in letzter Zeit gegen Weber neu entdeckt wurde. Dreyers41 „Biografie eines Demokraten“ kann als späte Gegendarstellung und Antwort auf Mommsens Weber-Buch verstanden werden: Friedrich Ebert entschied am 15. November 1918 richtig, Preuß gegen Weber den Vorzug zu geben und zum Staatssekretär des Innern zu ernennen. Preuß stand in Theorie und Praxis weitaus vorbehaltloser und unproblematischer für den liberaldemokratischen Verfassungsstandard; er war ein prädestinierter „Verfassungsvater“. Solche Wiederentdeckungen des liberaldemokratischen Diskurses der Weimarer Republik kamen aber reichlich verspätet. Lange dominierte die Krisenoptik vom Ende her.
Nach 1968 verlagerte sich die bundesdeutsche Vergangenheitspolitik im Zuge der neuen Ostpolitik und des differenzierten Systemvergleichs auf den langsamen Abschied vom Totalitarismustheorem und die Betonung eines deutschen „Sonderwegs“ und „Zivilisationsbruchs“ im Nationalsozialismus. Der Kontrapunkt, den Ernst Nolte42 als Erbe des Totalitarismustheorems dagegen mit seiner Betonung der europäischen Dimension des Faschismus und des europäischen „Weltbürgerkriegs“ setzte, war im sog. „Historikerstreit“ – Ende der 1980er Jahre und vor dem Mauerfall – noch heftig umstritten. Nach 1989 wurde mit dem Ende des „Kalten Krieges“ dann aber vom linksliberalen Sonderwegsnarrativ auf relative Normalisierungs- und Glücksgeschichten des nationalgeschichtlichen Kampfes um „Einheit und Freiheit“43 umgestellt. Die starken Modernisierungs- und Verwestlichungslegenden gerieten dabei verstärkt unter geschichtsphilosophischen Determinismusverdacht.
Mit dem Mauerfall weitete sich der historische Fokus erneut europäisch und die politischen Koordinaten gerieten ins Wanken. Wer nach 1989 hoffte, dass der liberaldemokratische Standard sich weltweit durchsetzen würde, wurde spätestens seit den Entwicklungen nach dem 11. September 2001 herb enttäuscht. Demokratisierungsmissionen und -projekte scheiterten nicht nur in Afghanistan und dem Irak. China stieg zur Industrienation und Weltmacht auf, die die Hegemonie der USA für das 21. Jahrhundert zu beerben scheint, ohne nach einem liberaldemokratischen Modell zu streben. Auch in den westlichen Kernstaaten erodierte der liberaldemokratische Standard. Die Entwicklung des Liberalismusdiskurses in der Zwischenkriegszeit ist damit erneut interessant und die neuere Literatur kehrt ein Stück weit in die Bahnen der älteren Totalitarismusforschung ein.
Hannah Arendt,44 beispielsweise, hatte die totalitäre Bewegung und Herrschaft vom Antisemitismus und Imperialismus her gesehen und die moderne Diskriminierungs- und Terrorgeschichte vom Scheitern des Ordnungsprinzips des Nationalstaats her beschrieben. Der Nationalstaat trug den Sprengstoff des Nationalismus in sich. Das zeigte sich in europäischen Kernstaaten zunächst im Scheitern der Emanzipation und Assimilierung am Antisemitismus, wie er Ende des 19. Jahrhunderts als Dreyfus-Affäre in Frankreich eskalierte. Mit dem kolonialen Imperialismus radikalisierte sich die Diskriminierungslogik auch rassistisch. Dieser entfesselte Nationalismus und Rassismus traf am Ende des Ersten Weltkriegs auf Wilsons doktrinären Glauben an die Weltmission der demokratischen „Selbstbestimmung“45 der Völker. Arendt beschrieb in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft schon das Scheitern der europäischen Nachkriegsordnung von Versailles am Nationalstaatsprinzip und Nationalismus. Es war nicht möglich, die europäische Landschaft mit dem Prinzip der „Selbstbestimmung“ zu ordnen, weil der Nationalismus überall imperial und diskriminierend wurde. Die Erbschaft der Doppelmonarchie ließ sich damit ebensowenig pazifizieren wie die nordeuropäischen Verhältnisse am Rande der weltrevolutionären Sowjetunion.
Die heutige Historiographie entdeckt dieses gesamteuropäische Krisenszenario neu. So stellte Jörn Leonhard46 das Scheitern von „Versailles“ detailliert heraus. Er zeigte eindrücklich, wie „global“ die Entwicklungen waren und wie die hohen Erwartungen und offenen Ausgänge vom Herbst 1918 seit dem Frühjahr 1919 in diplomatischen Verhandlungen, Kriegs- und Bürgerkriegslagen enttäuscht wurden, sodass Versailles keine stabile Nachkriegsordnung schuf. Es ist zwar wenig plausibel, dass Robert Gerwarth seiner Darstellung des „blutigen Erbes des Ersten Weltkriegs“ einen Lobpreis des revolutionären „Aufbruchs in eine neue Zeit“ folgen ließ.47 Die neuere Forschung hat aber in einer Gegenrechnung zur älteren Forschung auch die offenen und positiven Möglichkeiten der Weimarer Republik vielfach erwogen. Dreyer spricht in einem knappen Überblick gar von einem „Paradigmenwechsel“,48 der gängige „Irrtümer“49 und „teleologische Täuschungen“50 kritisiert, die von 1930 oder 1933 her finalisieren.
Zwar gab es selbstverständlich auch für die Übergangszeit 1918/19 schon Traditionen und Hypotheken, Präferenzen und Präfigurationen, Vorprägungen und Richtungsentscheidungen. Gerade für diese Übergangszeit vor der Ratifizierung des Versailler Vertrages und der Weimarer Verfassung ist aber eine relative Offenheit der Lage zu betonen. Oliver Haardt und Christopher Clark schreiben dazu: „So instabil war die politische Lage im Frühjahr 1919, dass wirklich alles möglich schien – eine kommunistische Machtübernahme, wie in München kurzzeitig geschehen, die Errichtung eines von der Reichswehr gestützten rechtsautoritären Regimes oder gar eine Wiedereinsetzung der Hohenzollern. Diese Offenheit der historischen Situation war vor allem Folge des plötzlichen Wegfalls der alten Machtstrukturen.“51 Der Weimarer Verfassungstext bot zwar eine innovative „soziale Programmatik“, wie Stolleis und Dreier im selben Band ausführen.52 Das geläufige Urteil, dass die Gewaltenbalancierung zwischen Reichstag und Reichspräsident nicht wirklich funktionierte, weil der schwache Parlamentarismus aus der Primärverantwortung der Regierungsbildung in die Präsidialkabinette floh, wird aber weiter vertreten.53 Schmitt warnte in Weimar einst vor der Schwäche des Parlamentarismus und der Machtfülle des Reichspräsidenten, seine „kommissarischen“ Befugnisse in die Richtung einer „souveränen Diktatur“ zu entwickeln. Seine Pathogenese der Weimar Dekomposition ist nach wie vor vielfach erhellend und zutreffend, so interessiert und einseitig sie auch war.