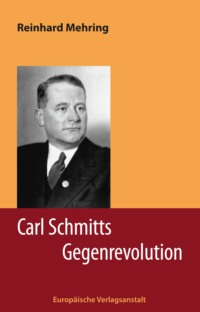Kitabı oku: «Carl Schmitts Gegenrevolution», sayfa 5
6. Spiegel der Politischen Romantik
Schmitt war also ein intimer Kenner der Münchner Bohème und spiegelte seine Lage in historischen Parallelen. Als Jurist mied er die direkte politische Parteinahme. Es ist deshalb nicht genau geklärt, wem er damals persönlich begegnete. Die gefährlichste Phase der Münchner Räterevolution: die kommunistische Rätediktatur (Leviné, Levien, Axelrod) von Mitte bis Ende April 1919, erlebte er in der Münchner Stadtkommandantur. Er soll damals in persönliche Lebensgefahr geraten sein, hat sich darüber aber nicht schriftlich geäußert. Als Jurist hatte er selbstverständlich Bedenken gegen Selbstjustiz. In seinem Buch über Die Diktatur erklärte er, dass „das Wesen des Notwehrrechtes darin besteht, dass durch die Tat selbst über seine Voraussetzungen entschieden wird“ (D 179). Nur in einer Fußnote zitierte er einen „Aufruf der kommunistischen Revolutionsleitung in Duisburg“ zum Standrecht und eine Bemerkung des Reichswehrministers: „‚Da finden Sie das neue Staatsrecht‘. ‚Da kommt das Erschießen fast vor dem Urteil, möchte man meinen.‘“ (D 177) Wenn Schmitt einen Reichswehrminister mit rechtstaatlichen Bedenken gegen das kommunistische Standrecht zitiert, verteidigt und kritisiert er die Niederschlagung und Aburteilung der Münchner Rätediktatur gleichermaßen.
Schmitt hatte 1919/20 in München persönlichen Kontakt zu Max Weber. Er hörte Vorlesungen und Vorträge und saß in Webers Dozentenseminar. Der genaue Umfang dieser Kontakte ist nicht ermittelt. Seine – wahrscheinlich vor Kriegsende abgeschlossene – Politische Romantik erschien Anfang 1919 Monate vor Webers Münchner Rede Politik als Beruf im Druck. In erster Annäherung lässt sich die Absage an die zeitgenössischen Romantiker mit Webers Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungspolitikern vergleichen: Schmitt wirft den politischen Romantikern eine ideologische Orientierung und mangelnden Realismus vor. Wo er „Romantik“ exorziert, spricht Weber, auch unter dem Eindruck des Toller-Prozesses,66 von verantwortungsloser „Gesinnung“. Weber lehnte „Gesinnungen“ zwar nicht pauschal ab, kritisierte die reine Gesinnungsethik aber konsequentialistisch. Von dieser Rede unterschied sich Schmitts Kritik schon durch das geistesgeschichtliche Gewand.
Die Monographie Politische Romantik gehört in die katholische oder katholisierende Phase, die spätestens 1925 mit der zweiten Fassung des Essays Römischer Katholizismus und politische Form endete. Unter dem Eindruck des Weltkriegs neigte Schmitt religiöser Apokalyptik zu. Seine Politische Romantik unterscheidet zwischen Gegenrevolution und ästhetisierender Romantik und richtet sich gegen romantische Auffassungen der „organischen“ Staatslehre. In die Endphase des Ersten Weltkriegs hinein korrigiert Schmitt die Fahnen. Schmitt kritisiert die politische Romantik exemplarisch am „Typus“ und Beispiel Adam Müllers. Novalis und Friedrich Schlegel zieht er nur ergänzend heran. Zwei Müller-Kapitel umklammern zwei Kapitel zur „Struktur des romantischen Geistes“. Schmitt übernimmt zwar polemische Topoi von Hegels Romantikkritik; Hegel konzentrierte sich aber auf Schlegel und führte die romantische Auslegung moderner Subjektivität philosophiegeschichtlich auf den „subjektiven Idealismus“ Fichtes zurück; Schmitt verlagert die Herleitung dagegen von Kant und Fichte auf Descartes und Malebranche und definiert die Romantik eigenwillig als „subjektiven Occasionalismus“ (PR 23f, 140f, 147). Er verwirft nicht nur Kant und die Folgen, sondern den neuzeitlichen Rationalismus insgesamt. Schmitt übernimmt zwar fast alle Aspekte von Hegels Romantikkritik; er kritisiert den Typus des Romantikers moralistisch wie Hegel als eitlen, ästhetizistischen Bourgeois, der sich an die Stelle Gottes setzt, betrachtet die Romantik aber darüber hinaus auch als eine pseudokonservative „Reaktion gegen den modernen Rationalismus“, die die „höchste Realität“ der alten Metaphysik, das vorreflexive Sein Gottes, durch moderne Ideen von „Volk“ und „Geschichte“ ersetzte. Mit der Formel vom „subjektiven Okkasionalismus“ streicht er die Epigonalität der Romantik als „Reaktionsform“ (PR 84) heraus. So profiliert er die katholische Kirche, und ihre Ontologie und Theologie, der er nahe steht, gegen die Romantik.
Systematisch betont Schmitt, dass die Romantik vor der normativen Entscheidung über „Recht und Unrecht“ (PR 161, 205), der Parteinahme und politischen Aktion in ein passives Vertrauen auf die „organische“ Entwicklung und sentimentalische „Begleitaffekte“ ausweicht. Der Romantiker betrachtete die Entwicklungen mit „Ironie“ und einer „Gesinnung der Intrige“ (PR 105) und ersetzte den Glauben an „Gott“ durch das optimistische (rousseauistische) Vertrauen in die Menschheit und Geschichte. Die Politische Romantik weist mit ihrer Disjunktion von Gegenrevolution und Romantik auf die Programmschrift Politische Theologie und Option für die Gegenrevolution voraus. Dabei spielt Schmitt den Katholizismus gegen die Romantik aus. Gentz, Haller und die Restauration zählt er nicht zur Romantik. Donoso Cortés ist noch nicht erwähnt und es gibt noch keine klare Absage an die dynastische Legitimität und Restauration. Ausdrücklich sagt Schmitt vielmehr: „Legitimität aber ist eine unromantische Kategorie.“ (PR 171)
Nach 1918 verabschiedete Schmitt den altkonservativen Traditionalismus strikt. Eine nostalgische Verklärung der „dynastischen Legitimität“ ist ihm gänzlich fremd. Wenn er in der Politischen Romantik über die romantische Mobilisierung der „Gefühle von Liebe und Treue“ gegenüber dem Staat eingehend spottet, könnte das 1918, als Schmitt das Buch abschloss, noch auf eine Verteidigung des militanten Wilhelminismus gegen das Bürgertum zielen. Eine starke Absage an den Monarchismus ist jedenfalls nicht herauszulesen, eher Spott auf die bürgerliche Verklärung und Ästhetisierung des Staates. Damit erscheint die Schrift als ein letztes Abwehrgefecht in der Option für die Gegenrevolution. Wie eine Selbstbeschreibung liest sich aber die seitenlange Abrechnung mit Müllers „Argumentationssystem“ und „oratorischem Talent“. „Nur als oratorische Leistung darf man Müllers Argumentation beurteilen“ (PR 191), schreibt Schmitt. Polare Begriffsbildungen kennzeichneten aber auch seine „Lehre vom Gegensatz“. Schmitt musste sich mit seiner Romantikkritik zur Option für die Gegenrevolution gleichsam selbst überreden. Der Name Adams Müllers ließe sich im Buch deshalb durch „Carl Schmitt“ ersetzen. Als eine solche Selbstentlarvung und Selbstinquisition haben frühe Kritiker das Buch sogleich gelesen: Sie richteten das Charakterbild vom politischen Opportunisten gegen Schmitt selbst. Im Spiegelgefecht zeigt sich eine Familienähnlichkeit zwischen Müller und Schmitt. Später wird Schmitt immer wieder sagen: Der Feind ist die „eigne Frage als Gestalt“. Mitte der 1920er Jahre verabschiedete er die Romantik ziemlich plötzlich und vollständig aus seinem Referenzkanon; er orientierte sich kanonpolitisch um und verlegte sich auf die Konstellation um 1848.
7. Briefliche Äußerungen
Es wurde bereits gesagt, dass sich nur wenige private Zeugnisse aus den Jahren 1918/19 finden. So ist ungeklärt, wie Schmitt seit 1916 seinen Lebensschwerpunkt als Privatdozent in Straßburg und Soldat in München gestaltete. Das Vorwort zur zweiten Auflage betont, dass die Politische Romantik „1917/18 entstand und Anfang 1919 erschien“ (PR 27). Einige Briefe an den befreundeten Verleger Feuchtwanger (CSLF 17ff) belegen, dass Schmitt im Juli 1918 noch am Text schrieb, im Oktober eine „Einfügung“ nachschob und das Buch Anfang 1919 erschien. Es ist also von einem definitiven Abschluss des Textes spätestens im Dezember 1918 auszugehen. Jahrzehnte später, 1978, schreibt Schmitt, fast 90 Jahre alt, seinem Bonner Schüler Huber zum Erhalt des fünften Bandes der monumentalen Verfassungsgeschichte, der Weltkrieg, Revolution und „Reichserneuerung“ in den Jahren 1914 bis 1919 behandelt:
„Seit fast einem Monat lese ich in Ihrem Bd. V. der Deutschen Verfassungsgeschichte und bei jedem Abschnitt war ich von neuem gefesselt. Es ist ein ungewöhnliches, bewunderungswürdiges Werk, sowohl in der Forschungsarbeit und Dokumentierung, wie in der Urteilskraft seiner Konklusionen und in der erquickenden Sicherheit seiner klaren Darlegung. Sie haben Recht, wenn Sie vermuten, dass ich diese Geschichte des ersten Weltkriegs und der anschließenden Nachkriegsjahre als Zeitgeschichte mit autobiographischem Interesse lesen kann: denn ich war vier Jahre lang Referent für Kriegszustandsrecht (nach dem bayerischen Kriegszustand-Gesetz) der Abteilung P beim Stellvertretenden Generalkommando I beim Armee-Korps in München in der Herzog-Max-Burg, anschließend Objekt der Eisner- und Niekisch-Republik und dann wieder beim Stabe der Regierungstruppen (Hauptmann Roth, der spätere bayerische Justizminister) – alles Abschnitte Ihrer verfassungsgeschichtlichen Darstellung, die ich persönlich verifizieren kann. So bin ich ein geradezu prädestinierter Leser und Benutzer Ihres Werkes und darf mir ein Urteil erlauben“. (CSHU 384f)67
Huber schickte 1981 noch den folgenden sechsten Band über die Institutionen der Weimarer Verfassung. Dazu schrieb Schmitt, bereits 93 Jahre alt, aber nur noch: „Der wahre und angemessene Dank ist mir nicht mehr möglich.“ (CSHU 390) 1978 unterschied er rückblickend zwischen seiner Tätigkeit im Generalkommando und der anschließenden Rolle als „Objekt der Eisner- und Niekisch-Republik“. Dass er Huber gegenüber von einer Niekisch-Republik sprach, nicht etwa von Leviné o.a., resultiert wohl aus der gemeinsamen Bekanntschaft mit Niekisch im Jünger-Kreis. Schmitt scheint sich 1978 jedenfalls erneut von der Räterevolution zu distanzieren. Eine beachtliche zeitgenössische Äußerung ist dazu der erwähnte Brief vom August 1920, den er zusammen mit dem befreundeten Georg von Schnitzler in der Münchner Post zur öffentlichen Verteidigung des Hauptmanns Roth publizierte. Schmitt schreibt hier:
„Wir waren jahrelang in der von Dr. Roth geleiteten Abteilung des Generalkommandos tätig und standen, wie Roth bekannt war, auf einem ganz anderen politischen Standpunkt als er selbst. […] Die Abteilung Roth war kein Scharfmacherbüro und Dr. Roth alles andere als ein bornierter Militarist. […] Bei der Abteilung waren offen demokratische Mitarbeiter, was Dr. Roth wusste, ohne sie in ihrer Selbständigkeit zu beeinträchtigen.“ (TB 1915/19, 519)
Es ist hier nicht zu klären, ob dieses Zeugnis zutreffend war und Schmitt sich selbst zu den „offen demokratischen Mitarbeitern“ zählte. Er reklamiert jedenfalls einen „ganz anderen politischen Standpunkt“ für sich, und so merkwürdig das im Kontext sonstiger Bekenntnisse klingt, so strategisch der Brief auch geschrieben ist, gibt es hermeneutisch doch schwerlich sichere Gründe, Schmitts Erklärung nicht ernst zu nehmen. Will man seinen damaligen „Standpunkt“ genauer fassen, so ist neben der Politischen Romantik vor allem Die Diktatur zu berücksichtigen. Sie ging im Herbst 1920 in den Druck.
8. Die Jakobiner nach 1918
Wie zitiert, kam Schmitt das Interesse an der Diktatur als dienstlicher Auftrag entgegen. 1916 publizierte er eine erste längere „staatsrechtliche Studie“ zur Unterscheidung von Diktatur und Belagerungszustand, die sich auf den Bedeutungswandel in der französischen Revolution und Verfassungsgeschichte konzentrierte. Schmitts erste große rechts- und begriffsgeschichtliche Monographie führt 1921 dann – laut Untertitel – von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf. Nur der kritische Schluss mit dem „proletarischen Klassenkampf“ soll hier interessieren.
Auf den letzten Seiten erörtert Schmitt erstmals die Diktatur des Reichspräsidenten nach Artikel 48 im Verhältnis zur „Diktatur des Proletariats“. Dabei konstatiert er einen Begriffswandel vom älteren Belagerungszustand zur Konzeption der Weimarer Verfassung: 1848 war bereits „eine Reihe von umschriebenen Befugnissen“ an die Stelle einer unbestimmten Ermächtigung zur nach Lage der Sache erforderlichen Aktion getreten. Der Reichspräsident erhielt dagegen „die Ermächtigung zu einer rechtlich nicht begrenzten Aktion“ (D 201): eine „grenzenlose Ermächtigung“, „grenzenlose Delegation“ und „Übertragung der Souveränität“. Nur die Selbstbeschränkung auf ein Maßnahmehandeln unterschied seine Praxis von der souveränen Diktatur. „Das Recht über Leben und Tod wird implicite, das Recht zur Aufhebung der Pressfreiheit explicite erteilt.“ (D 203)
Am Beispiel des Art. 48 entdeckt Schmitt 1921 erstmals „Widersprüche“ in der Weimarer Verfassung: Weil die existentielle Frage der Souveränität nicht klar geregelt ist, kann der Reichspräsident sein Handeln über die „kommissarische Diktatur“ hinausgehend in Richtung auf eine „souveräne Diktatur“ entwickeln. Schmitt gibt ein soziologisches Argument für das mangelnde Problembewusstsein und Schweigen des Verfassungstextes zu diesem entscheidenden Fall: „Beim Übergang vom fürstlichen Absolutismus wurde als selbstverständlich vorausgesetzt, daß nunmehr die solidarische Einheit des Staates endgültig gesichert sei.“ (D 203) Schmitts Monographie schließt mit dem Befund, dass diese Voraussetzung einer staatlichen Einheit und Einheitsbildung, die die nationalliberale Bewegung des 19. Jahrhunderts beherrschte, mit dem „proletarischen Klassenkampf und der Theorie der „Diktatur des Proletariats“ aktuell negiert sei. Schmitt schreibt:
„In den Jahren 1832 und 1848, die für die Entwicklung des Belagerungszustands zu einer rechtlichen Institution das wichtigste Datum sind, war gleichzeitig schon die Frage gegeben, ob die politische Organisation des Proletariats und ihre Gegenwirkung nicht einen ganz neuen politischen Zustand, und damit neue staatsrechtliche Begriffe schafft.“ (D 204)
Die Diktatur schließt also mit einer Verhältnisbestimmung der Diktatur des Reichspräsidenten und des Proletariats und kündigt weiterführende Publikationen an; der Vortrag von 1924 über Die Diktatur des Reichspräsidenten nach Artikel 48 der Weimarer Verfassung ist dann als „Anhang“ seit 1927 allen folgenden Auflagen beigefügt. Der Text von 1921 schließt folgendermaßen:
„Wie der Begriff [der souveränen Diktatur] sich im systematischen Zusammenhang mit der Philosophie des 19. Jahrhunderts und im politischen Zusammenhang mit den Erfahrungen des Weltkrieges entwickelt hat, muss einer besonderen Darstellung vorbehalten bleiben. Es darf jedoch hier schon bemerkt werden, dass, von einer allgemeinen Staatslehre aus betrachtet, die Diktatur des mit dem Volk identifizierten Proletariats als Übergang zu einem ökonomischen Zustand, in welchem der Staat ‚abstirbt‘, den Begriff einer souveränen Diktatur voraussetzt, wie er der Theorie und der Praxis des Nationalkonvents zugrunde liegt. Auch für die Staatstheorien dieses Übergangs zur Staatlosigkeit gilt das, was Engels in einer Ansprache an den Bund der Kommunisten im März 1850 für seine Praxis verlangte: es ist dasselbe ‚wie in Frankreich 1793‘.“ (D 205)
In seiner gewichtigen und schwierigen „Vorbemerkung“ von 1921 geht Schmitt näher auf die „sozialistische Literatur“ zur Theorie des Proletariats ein und betont sein grundlegendes rechtsphilosophisches Interesse. Er erwähnt im sozialistischen Diskurs und Revisionismusstreit vom „Sommer 1920“ Antworten von „Lenin, Trotzki und Radek“ auf Kautsky, die die Diktatur als Mittel zum revolutionären Zweck auffassten und den Staat als bloßes Mittel der Revolution instrumentalisierten. Schmitt schreibt:
„Wo nun, wie in der kommunistischen Literatur, nicht nur die bekämpfte politische Ordnung, sondern auch die erstrebte eigene politische Herrschaft Diktatur heißt, tritt eine weitere Veränderung im Wesen des Begriffs ein. Der eigene Staat heißt in seiner Gesamtheit Diktatur, weil er das Werkzeug eines durch ihn zu bewirkenden Übergangs zu einem richtigen Zustand bedeutet, seine Rechtfertigung aber in einer Norm liegt, die nicht mehr bloß politisch oder gar positiv-verfassungsrechtlich ist, sondern geschichtsphilosophisch. Dadurch ist die Diktatur – weil sie als Ausnahme in funktioneller Abhängigkeit von dem bleibt, was sie negiert – ebenfalls eine geschichtsphilosophische Kategorie geworden.“ (D XV)
Schmitt spricht für die „Unterscheidung von kommissarischer und souveräner Diktatur“ auch von einem „Übergang von der früheren ‚Reformations-‘ zur Revolutions-Diktatur“ (D XVIII). Gelegentlich meinte er später, die Weimar Verfassung sei 1919 bereits „posthum“, eigentlich von 1848 gewesen. Wenn er den zeitgenössischen Bolschewismus 1921 mit den Jakobinern von 1793 parallelisiert, spricht er ein geschichtsphilosophisches Urteil: Schmitt zeigt zwar, dass die fundamentale Voraussetzung der „Einheit“ des Staates, auf der die Diktatur des Reichspräsidenten basierte, von der Theorie des proletarischen Klassenkampfes negiert wurde; er scheint die proletarische Revolution aber 1921 nicht mehr wirklich zu fürchten. In der Vorbemerkung beruft er sich dagegen zustimmend auf Bruno Bauer und Ostrogorski, unausgesprochen wohl auch auf Max Weber, wenn er konstatiert:
„Stets aber ist nach dem neueren Sprachgebrauch eine Aufhebung der Demokratie auf demokratischer Grundlage für die Diktatur charakteristisch, so daß zwischen Diktatur und Caesarismus meistens kein Unterschied mehr besteht und eine wesentliche Bestimmung, nämlich das, was […] als der kommissarische Charakter der Diktatur entwickelt ist, entfällt.“ (D XIII)
9. Gegenrevolutionäre Bejahung der „konstitutionellen Demokratie“
Damit sind Schmitts früheste Stellungnahmen zum Umbruch von 1918/19 einigermaßen geklärt. Es ließen sich spätere anschließen. Ein kleiner Artikel Reichspräsident und Weimarer Verfassung liest sich im März 1925 wie eine zusammenfassende Warnung vor der „großen Machtfülle“ des Reichspräsidenten: „Man kann sagen, daß keine Verfassung der Erde einen Staatsstreich so leicht legalisiert, wie die Weimarer Verfassung.“ (SGN 25) Ignorieren wir die späteren Schriften und beschränken uns auf die ersten Antworten der Monographien von 1919 und 1921, so ist abschließend zu sagen: Von einer umfassenden verfassungspolitischen Antwort auf den Systemumbruch kann damals noch keine Rede sein. Schmitt schweigt von Versailles und Genf; zur Weimarer Verfassung äußert er sich aber bereits dezidiert, auf die Souveränitätsfrage von Diktatur und Ausnahmezustand bezogen. Als Jurist meidet er direkte Stellungnahmen und versteckt sie „esoterisch“ hinter indirekten Spiegelungen. Deshalb sind Exkurse zu David Friedrich Strauss und Wallenstein68 innerhalb der beiden Monographien auch eine konfessionelle Botschaft: Schmitt grenzt sich von Strauss’ romantisierender Auffassung der Religionspolitik des antichristlichen Kaisers Julian ab und betrachtet Wallenstein als kommissarischen Diktator und „Aktionskommissar“ im Dienste kaiserlicher Reichseinungspolitik: „Allerdings verschafften die militärischen Erfolge Wallensteins dem Kaiser eine solche Macht, dass es einen Augenblick scheinen konnte, als bestünde die Möglichkeit, das Deutsche Reich zu einem nationalen Einheitsstaat unter einem absoluten Fürsten zu machen.“ (D 86) Kontrafaktisch deutet Schmitt hier eine versäumte historische Chance an, die 1848 erneut verfehlt worden sei.
Schmitt macht 1921 also das Telos des Einheitsstaats explizit, um die Risiken einer diktatorischen Wendung gegen die Reichseinheit aufzuzeigen. Von einer Apologie des Reichspräsidenten scheint er aber noch weit entfernt zu sein; eher warnt er vor den Gefahren eines Übergangs zur souveränen Diktatur des Reichspräsidenten. Seine Stoßrichtung richtet sich mehr gegen den „proletarischen Klassenkampf“. Hier liegt eine thematische Verknüpfung der beiden Monographien Politische Romantik und Die Diktatur: Während die Politische Romantik die Akteure im historischen Spiegel moralisch wie politisch zu diskreditieren scheint, zielt Die Diktatur auf den grundsätzlichen Wandel. Schmitt betont, dass sein Interesse „sich nicht erst an den gegenwärtigen Diskussionen über Diktatur, Gewalt oder Terror entzündet hat“ (D XIX), und er verweist auf frühere Schriften. Rechtsphilosophisch fragt er nach der „Rechtfertigung der Diktatur, die darin liegt, dass sie das Recht zwar ignoriert, aber nur, um es zu verwirklichen“ (XVI); die Diktatur zeige die „Möglichkeit einer Trennung von Normen des Rechts und Normen der Rechtsverwirklichung“. Schmitt sucht einen Zugang zu einem weiten Rechtsbegriff und will das Recht vom „Problem der konkreten Ausnahme“ (D XVII) her fassen. Daran schließt die Souveränitätslehre der Politischen Theologie an. Schmitt stellt sich dort in die Reihen der „Theorie der Gegenrevolution“ und beantwortet ein Jahr später, mit der Parlamentarismus-Schrift, die „Diktatur im marxistischen Denken“ dann mit einer Berufung auf Mussolini und den „nationalen“ oder nationalistischen Mythos. Im Vorwort zur zweiten Auflage der Diktatur schließt er 1927 dann erneut mit einem Verweis auf Mussolini und der Rede vom „autoritären Staat“.
Damit ist einigermaßen geklärt, mit welchen Erwartungen Schmitt die Weimarer Entscheidung für die „konstitutionelle Demokratie“ gegen die Rätediktatur begrüßte: Mit der Diktatur des Reichspräsidenten fand er die Antwort des „Caesarismus“. Seine Grundentscheidung war damals bereits antibolschewistisch und gegenrevolutionär. Der Wille zur Reichseinheit und die Ablehnung der „Diktatur des Proletariats“ stehen am Anfang seiner Weimarer Verfassungslehre.