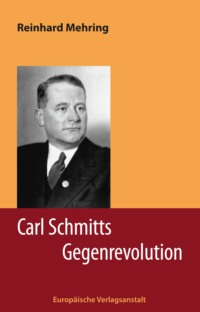Kitabı oku: «Carl Schmitts Gegenrevolution», sayfa 8
1. Von Mauthner zu Landauer: von der Sprachskepsis zur anarchistischen Revolutionsmystik
Fritz Mauthner wurde 1849 in Böhmen geboren. In seinen späten Erinnerungen schildert er seine Sozialisation von seiner Dreisprachigkeit ausgehend. Die „Leichen dreier Sprachen“108 – deutsch, tschechisch und hebräisch – trug er mit sich herum. In einem strikt säkularen, jüdischen und bürgerlichen Elternhaus geboren, in Prag aufgewachsen, war er durch eine kurze Phase jüdischer Identitätssuche und Bekehrung hindurchgegangen und früh zu einem „wütenden“ und „kriegerischen Atheismus“109 gelangt. Nach einem geschäftlichen Bankrott des Vaters empfand er sich als Außenseiter. Mauthner betont den „nationalen Zwist“ zwischen Deutschen und Tschechen in Böhmen. An allen „Raufereien mit den Tschechen“110 war er beteiligt. Nach 1866 optierte er kleindeutsch. Wie viele nationalliberale Deutsche und Juden sah er Bismarck als gewaltigen Modernisierer und Befreier aus den nationalistisch zerrissenen und instabilen Verhältnissen des Vielvölkerstaates an. Die Doppelmonarchie war für ihn keine kulturelle und politische Heimat. Nach dem Studium verließ er Prag, wie er schreibt, „für immer, um in Deutschland zu leben“.111 Das Basisfaktum seiner Biographie ist diese Entscheidung für das deutsche Kaiserreich. Es war in erster Linie eine Entscheidung für deutsche Kultur und politische Ordnung, Modernität und prosperierende Stabilität.
Mauthner verachtete den zeitgenössischen universitätsphilosophischen Betrieb und verstand sich primär als Dichter. Von seinen dichterischen Produktionen gelangte er über die Literatur- und Theaterkritik zur Sprachkritik. In Berlin wurde er ein erfolgreicher Literaturkritiker und schrieb dort in den 1890er Jahren seine Beiträge zur Kritik der Sprache. Mauthner suchte die Sprache vom Zwang sozialer Konventionen zu emanzipieren und in eine sprachlose Mystik und unmittelbare Präsenzerfahrung zu überführen. Diese Utopie mystischer Unmittelbarkeit trennte ihn trotz vieler Gemeinsamkeiten von der „fiktionalistischen“ Philosophie des Neukantianers Hans Vaihinger. Sein Spätwerk, seine vierbändige Geschichte des Atheismus, endete mit einer Absage ans Christentum und dem Etikett einer „gottlosen Mystik“.
Landauer war mit Mauthner lange eng befreundet. Seine Broschüre Skepsis und Mystik von 1903 schildert Mauthners Weg von der Sprachskepsis zur Präsenzmystik. Landauer betrachtete seine anarchistische Politik als eine praktische Folgerung aus Mauthners Philosophie. Mauthners kleindeutscher Option wollte er nicht folgen. Im Juli 1918 liest er die Jugenderinnerungen und ist verwundert: „Es würde mich interessieren“, schreibt er an Mauthner, „ob Dir in Deiner Jugend der Name Bakunins […] nie begegnet ist? Er hat damals in Prag eine wichtige Rolle gespielt“.112 Landauer betrachtete Mauthners Sprachkritik über Kant hinaus als eine kopernikanische Wendung zur mystischen Innerlichkeit und Subjektivität113 und sah dies als notwendige Voraussetzung für die eigene revolutionäre Wendung an. Er fand es inkonsequent, dass Mauthner nicht den Schritt von der Sprachkritik zur politischen Revolution machte. „Die Erschütterung ist da“, schreibt er Weihnachten 1918, „der Fluß und die Bewegung, das beginnende Chaos – und der Sprachkritiker klammert sich an ‚Deutschland‘“.114 Landauer las Mauthner als „Wegbereiter für neue Mystik und für neue Aktion“.115 Er habe mit den Fiktionen der Grammatik gebrochen und die Sprache insgesamt als „Metapher“ erkannt. Damit habe er das „Ende Gottes“116 begrüßt und zu einem „spiritualistischen Pantheismus“117 gefunden. Für ihn war das neue Selbstgefühl entscheidend, die idealistische Destruktion der Grenzen von Ich und Welt. Landauer berief sich dafür auch auf Hofmannsthal und George; er pries die Befreiung der Poesie zur „Musik“ und fand mit Mauthner zur „großen Stimmung“ des „dionysischen Pessimismus“.118
In der Broschüre Die Revolution von 1907 heißt es:
„Entweder kommt bald der Geist über uns, der nicht Revolution, sondern Regeneration heißt; oder wir müssen noch einmal und noch mehr als einmal ins Bad der Revolution steigen. Denn das ist in unseren Jahrhunderten des Übergangs die Bestimmung der Revolution: den Menschen ein Bad des Geistes zu sein. In dem Feuer, der Hingerissenheit, der Brüderlichkeit dieser aggressiven Bewegungen erwacht immer wieder das Bild und das Gefühl der positiven Einung durch verbindende Eigenschaft, durch Liebe, die Kraft ist; und ohne diese vorübergehende Regeneration könnten wir nicht weiter leben und müssten versinken.“119
Landauer schwärmte vom „Freudegeist“ von 1789 und 1848, von Proudhon und Bakunin. Die Revolution war ihm „um der Auffrischung der Kräfte, um des Geistes willen, Selbstzweck“.120 Dafür setzte er auf eine bündische Selbstorganisation der „Einsichtigen“. Landauer schloss „Judentum und Menschheitsidee“ in seinem sozialistischen Bundesbegriff zusammen. Sehr emphatisch meinte er, „dass der Jude nur zugleich mit der Menschheit erlöst werden kann“121 und Deutschtum und Judentum wie zwei Brüder „einander nichts zuleid und vieles zulieb“ tun.
1911 publizierte Landauer für seinen „sozialistischen Bund“ die Programmschrift Aufruf zum Sozialismus, die er als „Revolutionsausgabe“ 1919 erneut auflegte. Darin bezeichnete er seinen Sozialismus als einen „Idealismus“ des „Geistes“. „Geist ist Gemeingeist, Geist ist Verbindung und Freiheit, Geist ist Menschenbund.“ Diese „Erleuchtung“ ist nur zu „Einzelnen“, „Wenigen“ gelangt. Landauers Programmschrift richtete sich primär gegen die marxistische Auslegung des Sozialismus und spielte Proudhon gegen Marx aus. Der organisierte Sozialismus ist „ganz und gar kein Sozialismus“; er ist „eine Karikatur, eine Imitation, eine Travestie des Geistes“.122 Der Marxismus will den Industriekapitalismus und den Staat erobern. Der Staat ist aber auch nur ein „Surrogat des Geistes.“123 Der „Wissenschaftswahn“ und „Wissenschaftsaberglauben“ des Marxismus sei völlig vermessen.
Landauer setzte nicht auf das Industrieproletariat, sondern auf die Genossenschaftsbewegung und Gründung von Landkommunen. Er wünschte einen ökokommunistischen Umstieg der Arbeiter in eine landwirtschaftliche Autarkiewirtschaft. Gegen den Mythos vom Generalstreik des Industrieproletariats forderte er den „aktiven Generalstreik“124 der antimodernistischen Wendung von der Stadt zum Land, von der Fabrik zum Dorf. Landauer knüpfte den sozialistischen „Geist“ an den „Bund“ agrarkommunistischer „Gemeinden“. Wenn er von „Siedlungen“ sprach, klingen zionistische Visionen vom „neuen Menschen“ für Deutschland an. Landauer setzte sich mit seinem Agrarkommunismus parteipolitisch dabei zwischen die Stühle, jenseits der sich formierenden Fronten von SPD, USPD und KPD.
Mit dem Aufruf zum Sozialismus hatte er seine Position gefunden. Seine „mystische Anthropologie“ vom „werdenden Menschen“ artikulierte er nach 1911 dann meist in der Form literaturkritischer Essays. Er verband oder verquickte hier mittelalterliche Mystiker mit anarchistischen Autoren, rezipierte Meister Eckart und Jakob Böhme, Proudhon und Kropotkin. Seit 1916 stand Landauer in engerer Verbindung mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus und hielt dort zahlreiche Vorträge über Goethe, Shakespeare und andere Dichter. Seit dem November 1918 engagierte er sich dann in München. In der Revolution hielt er zahlreiche politische Reden. Dazu kamen Gedächtnisreden u.a. für Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Kurt Eisner. Am 12. Januar kandidierte Landauer in seinem schwäbischen Wohnort Krumbach für die USPD. Noch Ende Januar 1919 plante er aber einen Umzug nach Düsseldorf, um ein Engagement als Dramaturg am dortigen Stadttheater anzunehmen.
Der Shakespeare-Zyklus, 1920 von Martin Buber posthum herausgegeben, ist ein letzter Stand seines Denkens. Landauer deutet den Liebestod von Romeo und Julia hier als religiöses „Versöhnungswunder“: „Die Liebe hat sich opfern müssen, um die Menschen vom Haß zu erlösen“, heißt es im Shakespeare-Vortrag.125 Vielleicht betrachtete er sein Revolutionsengagement, nach dem Tod seiner Ehefrau, als ein solches Opfer. Als romantischer und utopischer Sozialist hing er einer irrationalistischen Lebensphilosophie erotischer Vergemeinschaftung und „Verbrüderung“ der Menschen im spontanen Handeln an. Ähnlich wie Hannah Arendt unterschied er strikt zwischen dem politischen Handeln „zwischen den Menschen“ und politischer Organisation und bejahte die revolutionäre Aktion als „Selbstzweck“: als transindividuellen Liebesakt und Happening vom Selbstgefühl des Lebens. Dieser politische Enthusiasmus war für die Zwecke des Alltags und deren bürokratische Organisation völlig blind. Landauer sah gleichsam nur das Feeling, den Rausch und Charme der Revolution, ohne Blick für die anstaltsstaatlichen Formen. Er setzte das Erleben ins flüchtige Ereignis, beschwor die verändernde Kraft revolutionärer Erfahrung, zielte nicht auf Organisation, sondern auf Mentalität. Kant erörterte die enthusiastische Anteilnahme und „Teilnehmung“ der politischen Öffentlichkeit am „Geschichtszeichen“ der Französischen Revolution. Ein solches „Phänomen in der Menschengeschichte vergisst sich nicht mehr“, meinte er, „weil es eine Anlage und ein Vermögen in der menschlichen Natur zum Besseren aufgedeckt hat.“126 Landauer wurde durch sein Engagement und seine brutale Ermordung zu einem Märtyrer und Mythos vom Scheitern des politischen Idealisten. Er war ein exemplarischer Vertreter eines antipolitischen und antibürokratischen Konzeptes charismatischer Herrschaft, das praktisch terroristisch wurde.
Was Landauer 1919 zum gewaltbereiten Revolutionär machte, ist letztlich kaum entscheidbar. Im Verlauf der Revolution radikalisierte er sich aber immer mehr. Charismatischer Erwählungsglaube und revolutionäres Avantgardbewusstsein sperrten sich gegen eine verantwortliche Wahrnehmung der diktatorischen Praxis. Die Praktiker der Revolution glaubten an charismatische Herrschaft und betrachteten sich als Kommissare und Diktatoren „des Geistes“. Landauer war ein revolutionärer Gesinnungsethiker und Utopist, der zur Aktion schritt, einen Einklang von Theorie und Praxis suchte und das „Risiko des Politischen“ mit seinem Leben bezahlte.
2. Landauer und Schmitt als Antipoden in der Münchner Revolution
Landauer und Schmitt waren 1919 Antipoden. Während Landauer in München Revolution machte,127 war Schmitt als Jurist in der Heeresverwaltung tätig. Die bayerische Revolutionsgeschichte beginnt im Oktober 1918 mit der Entlassung Kurt Eisners aus Untersuchungshaft. Eisner organisierte mit dem Mehrheitssozialisten Erhard Auer zusammen dann eine Aktionseinheit. Sie proklamierte die Absetzung des bayerischen Königs, der umgehend nach Österreich floh. Es konstituierte sich ein Revolutionskabinett, ein Regierungsprogramm bekannte sich zum Sozialismus und zielte gegen Österreichs großdeutschen Anschlusswillen auf die Separation einer „Donauföderation“. Eine Aktenveröffentlichung zur Kriegsschuldfrage brüskierte das Reich. Eisner reklamierte die Kommandogewalt über die bayerischen Truppen und suchte Wahlen aufzuschieben. Darüber kam es auch innerhalb des Revolutionskabinetts zu Auseinandersetzungen. Die Wahlen vom 12. Januar 1919 brachten dann eine katastrophale Wahlniederlage. Die Unabhängigen Sozialisten erlangten lediglich drei von 180 Sitzen und das Revolutionskabinett war abgewählt.
Eisner spielte nun auf Zeit und berief den gewählten Landtag erst zum 21. Februar ein. Auf dem Weg zum Landtag wurde er von Anton Graf Arco-Valley erschossen. Der Mehrheitssozialist Auer wurde dann im Landtag von einer anderen Person angeschossen und schwer verletzt. Ein „Rätekongress“ übernahm daraufhin die Macht und entschied gegen eine Rätediktatur, verschob aber erneut die Einberufung des Landtags und konstituierte ein Kabinett unter Martin Segitz, in dem u.a. Ernst Niekisch und Edgar Jaffé mitwirkten. Dieses Kabinett wurde von der Berliner Reichsregierung nicht anerkannt. Erst am 17. März wählte der Landtag den Mehrheitssozialisten Johannes Hoffmann zum Ministerpräsidenten, der einige Tage auf der Grundlage eines Ermächtigungsgesetzes eine Minderheitsregierung geführt hatte. Der weiterhin bestehende revolutionäre Zentralrat erklärte diese gewählte Regierung Hoffmann aber für abgesetzt und rief am 7. April 1919 mit Unterstützung eines Soldatenrates die Räterepublik aus. Das war ein Putsch der Unabhängigen Sozialisten im Bündnis mit Anarchisten, sozialistischen Intellektuellen und Mitgliedern des Bauernbundes. Diese Proklamation einer Räterepublik unterzeichneten u.a. Ernst Niekisch, Gustav Landauer und Erich Mühsam. Ernst Toller übernahm den Vorsitz. Das Kabinett Hoffmann floh nach Bamberg und suchte die Hilfe der Reichsregierung.
Landauer stand damals zwischen Eisner und Leviné. Nach der Wahlniederlage vom 12. Januar 1919 schrieb er an Margarete Susmann: „Es hätte nie so kommen dürfen, nie hätte sich die Revolution dieser Sorte Wählerei und Parlamentarismus anvertrauen dürfen; sie hätte die Massen in ihren neuen Gebilden umformen und erziehen müssen“.128 Am 29. Januar sprach er davon, dass die Forderung nach dem „alten Parlamentarismus“ „sogar einen Mann wie Kurt Eisner vom rechten Wege abgebracht“129 habe. Landauer meinte hier, vor der Ermordung Eisners, die verspätete Anerkennung der Wahlniederlage, die Landauer offenbar ablehnte. Er bejahte die Revolutionsdiktatur gegen das demokratische Votum der Wahlen. Im letzten überlieferten Brief an Mauthner schreibt er dazu mit dünner Ironie:
„Die Bayerische Räterepublik hat mir das Vergnügen gemacht, meinen heutigen Geburtstag zum Nationalfeiertag zu machen. Ich bin nun Beauftragter für Volksaufklärung, Unterricht, Wissenschaft und Künste und noch einiges. Läßt man mir ein paar Wochen Zeit, so hoffe ich etwas zu leisten; aber leicht möglich, daß es nur ein paar Tage sind, und dann war es ein Traum.“130
Der „Vorgang der Ämterverteilung“, erinnert sich Niekisch später, war damals „voll grotesker Züge“. Fast unbekannte Personen erhielten Macht. Landauer hatte sich selbst vorgeschlagen.131 Er musste damals wissen, dass diese Räterepublik keine demokratische Legitimation und Machtbasis hatte. Politisch war er darüber mit Mauthner entzweit. Mauthner schrieb dazu am 3. April in seinem letzten Brief noch:
„Was uns seit bald 5 Jahren trennen will, erscheint mir plötzlich, genau besehen, als etwas sehr Dummes: die Frage der prophetischen Gabe. Es wäre niedrig, das mit der Frage des Erfolges zu verwechseln.“132
Anders als die kommunistischen Berufsrevolutionäre war Landauer ein realpolitisch blinder Utopist. Nachdem er „Mitglied der revolutionären Regierung Bayerns“ wurde,133 schwelgte er Ende November 1918 schon in Revolutionsemphase:
„Revolution! Es wird entsetzliche Nöte geben, vielleicht hunderttausendfache Arbeitslosigkeit und schließlich Industrieruinen wie früher Burgruinen – denn aus diesem Krieg haben wir das Eine gelernt: Daß die Menschen das Gebotene und Nahliegende erst dann tun, wenn die bitterste Not da ist und gar kein verkehrter Weg mehr übrig ist.“134
Landauer erklärte das abgewählte Häuflein revolutionärer Selbstermächtiger gegenüber Mauthner zur „Nation“ und gab dem diktatorischen Institut des Kommissars den Nimbus charismatischer Erwählung mit ausufernden Zuständigkeiten. Sein „Kulturprogramm“ forderte eine strikte Trennung von Staat und Kirche, monumentale Revolutionsarchitektur, eine „Lebensgemeinschaft“ der „Meister“ mit ihren Schülern und eine „Streichung der theologischen und juristischen Fakultät“ an den Hochschulen. An seine Mitarbeiter im Ministerium schrieb Landauer am 12. April:
„Unter Räteregierung ist nichts anderes zu verstehen, als daß das, was im Geiste lebt und nach Verwirklichung drängt, nach irgendwelcher Möglichkeit durchgeführt wird. Wenn man unsere Arbeit nicht stört, so bedeutet das keine Gewalttätigkeit; nur die Gewalt des Geistes wird aus Hirn und Herzen in die Hand und aus den Händen in die Einrichtungen der Außenwelt hineingehen.“135
Landauer erteilte sich damit eine unbeschränkte Vollmacht jenseits bürokratischer Formen. Landauer akzeptierte Diktatur, Putsch und revolutionäre Gewalt. Seine charismatische Apologie einer amorphen „Gewalt des Geistes“ war ein klarer Fall von „Erziehungsdiktatur“, wie Schmitt sie 1923 in seiner Broschüre über Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus als „Schicksal der Demokratie“ und Dialektik der Revolution beschrieb: „Die Konsequenz dieser Erziehungslehre ist die Diktatur, die Suspendierung der Demokratie im Namen der wahren, erst noch zu schaffenden Demokratie.“ (GLP 37)
In der Nacht von Landauers diktatorischer Dienstanweisung, vom 12. zum 13. April, putschte das Münchner Militär und verhaftete einige Mitglieder der Räteregierung. Nun kam die Stunde der Kommunisten, die sich strategisch im Hintergrund gehalten hatten und an der ersten Räteregierung nicht beteiligt waren. Die bolschewistischen Berufsrevolutionäre Eugen Leviné und Towia Axelrod, in Russland geboren, organisierten den gewaltsamen Widerstand gegen das Militär. Landauer und Niekisch schieden aus dieser zweiten Räteregierung aus. Umgehend kam es zu einer Reichsintervention mit Beteiligung des Freikorps Epp. Ende April eskalierten die Kämpfe. Die kommunistische Führungstroika tauchte unter. Anfang Mai wurde München durch Regierungstruppen befreit. „Gustav Landauer wurde festgenommen und im Gefängnis Stadelheim ohne Verhandlung von Soldaten ermordet.“136 Die gewählte Regierung Hoffmann übernahm nun vorübergehend wieder die Macht. Landauer war damals wohl der einzige Revolutionsführer, der ohne Prozess ermordet wurde. Viele andere wurden von Standgerichten und Volksgerichten abgeurteilt, aber nur Leviné wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Da Landauer nur der ersten Räteregierung angehört hatte, wäre er aller Wahrscheinlichkeit nach, wie Erich Mühsam oder Ernst Toller, lediglich zu Festungshaft verurteilt worden.
3. Schmitts Mauthnerkritik
Carl Schmitt äußerte sich niemals eingehend über Landauer und den zeitgenössischen Anarchismus. Er positionierte sich auch zu philosophischen Klassiker wie Kant, Nietzsche oder Dilthey nur beiläufig; es ist also nicht nachweisbar, wie er Landauer wahrnahm. Wenn Landauer aber von Mauthner her verstanden werden kann, so gibt Schmitts frühe Mauthner-Kritik einigen Aufschluss. Für seine erkenntnistheoretische Positionsnahme waren frühe Auseinandersetzungen mit Mauthner und Vaihinger wichtig. Für Mauthners Problemstellung fand Schmitt dabei mit Vaihingers Fiktionalismus gleichsam die Lösung. Deshalb verschwand Mauthners Name nach 1914 aus seinem Werk. Zwei deutliche Spuren hat die Auseinandersetzung mit Mauthner aber im Werk hinterlassen: eine Miszelle und eine satirische Parodie: Als Rechtsreferendar in Düsseldorf publizierte Schmitt in einer Monatsschrift für deutsche Kunst, dem von Wilhelm Schäfer herausgegebenen Organ Die Rheinlande, vor 1914 mehrere kleine Miszellen. 1913 erschien seine Mauthner-Miszelle unter dem Titel Die Philosophie und ihre Resultate. Sie kritisiert das gerade erschienene Wörterbuch der Philosophie. Schmitt verteidigt Mauthner hier eingangs gegen den „Gerichtshof“ des banalen Publikums. Er kritisiert aber, dass „ein imponierender Aufwand von Scharfsinn und Tiefe des Geistes als inhaltliches Ergebnis ein armseliges Mäuslein gebiert“.137 Schmitt meint, dass Mauthners Philosophie systematisch nicht vertretbar sei; Sprachgeschichte und Sprachkritik treffen nicht den idealen Geltungsanspruch der Erkenntniskritik. Die praktische Wahrheitspräsupposition sei unhintergehbar. Grundsätzlich meint Schmitt: „Das Problem der Wahrheit und das der Objektivität ist nicht identisch mit dem der Intersubjektivität.“138 Mauthners Methode hält er aber für fruchtbar. Er bestätigt dem Wörterbuch Einsichten in die alltagssprachliche Form des philosophischen Vokabulars und betont die anregenden „Beobachtungen und Ergebnisse“ im Detail. Schmitt sieht Mauthner in der Tradition der Skeptiker und würdigt seine zentrale Einsicht, dass es „noch andere Richtigkeit [gibt] als die sprachliche“. Er nennt ihn einen „Mensch[en] mit guten Augen“ und verwendet also eine mystische Metapher für den Mystiker.
Die Mauthner-Miszelle ist ein Gelegenheitswerk. Intensiver beschäftigte sich Schmitt damals mit Vaihinger. Wenn er seine Vaihinger-Rezension in der Deutschen Juristen-Zeitung mit dem Titel „Juristische Fiktionen“139 überschrieb, ist der Rezeptionsgesichtspunkt bezeichnet, weshalb er Vaihinger gleichsam als pragmatische Antwort auf Mauthner las. Schmitt interessierte sich für den Fiktionalismus als praktische Philosophie und Ansatz zu einer pragmatischen, handlungsorientierten Auffassung der Sprache. Der Jurist setzt die praktische Bedeutung sprachlicher Fiktionen als Normen voraus. Die Tragweite von Vaihingers Fiktionalismus prüft Schmitt damals gleich in mehreren kleinen Texten und parodiert Mauthner dann in seiner Jugendsatire Schattenrisse als rechthaberischen Vielschreiber.140 Satirisch ergänzt er Mauthners Wörterbuch um einen Eintrag „Schmarrn“ und karikiert den Argumentationsstil so: „Denken ist Sprechen, Sprechen ist Muskelbewegung, Muskelbewegung ist Anstrengung, Aristoteles ist unangenehm, unangenehm ist Aristoteles, folglich ist Denken Schmarrn.“ (TB 1912/15, 343)
Schmitt charakterisiert Mauthner durch einen „jüdischen Witz“. Er greift Mauthners Rede vom „Witz“ der Sprache auf und ersetzt die „Sprache“ durch den Verweis auf das Judentum; er persifliert Mauthner als Juden, in einem satirischen Buch, das er zusammen mit seinem jüdischen Jugendfreund Fritz Eisler pseudonym schreibt. Im Wert des Staates verweist er in einer Fußnote auf Mauthner, wenn er Lichtenbergs „es denkt in mir“ gegen Mauthner als „Ausdruck der überindividuellen Gültigkeit jeder richtigen Norm“ rechtfertigt. Schmitt trennt in Rezension und Satire zwischen der anregenden Wirkung von Mauthners Wörterbuch und der problematischen Philosophie insgesamt. Die Destruktion der Sprache als Verständigungsmittel findet er als Jurist absurd; er teilt aber Mauthners Anliegen, durch die Sprache hindurch zu einer präreflexiven Mystik zu finden. Damals war Schmitt bereits mit dem expressionistischen Dichter Däubler befreundet. In seinem 1916 erschienenen Buch Theodor Däublers ‚Nordlicht‘ spricht er dem Dichter das Verdienst zu, die Sprache vom „Naturalismus“ der Verständigung emanzipiert zu haben. Schmitt attestiert Däubler „die Umschaffung der Sprache zu einem rein künstlerischen Mittel“ und eine „absolute Musik der Sprache“.141 Die „Transzendenz“ des „Geistes“ betrachtet er als eine Wendung vom „Utilitaristimus“ der „Mittel“ zum ursprünglichen oder religiösen „Zweck“.
Schmitt bejahte die expressionistische Emanzipation der poetischen Sprache vom alltäglichen Verständigungsmittel und löste seine Stellung zwischen Kaserne und Bohème, Alltag und Mystik in einen Dualismus der Perspektiven auf. Schon vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs unterschied er im Wert des Staates zwischen „Zeiten des Mittels und Zeiten der Unmittelbarkeit“ (WdS 197). Als doppelte Optik von Normal- und Ausnahmezustand hielt er an dieser Unterscheidung im Gesamtwerk fest. Oft wurde er einseitig in das Lager der Unmittelbarkeit und des apokalyptischen Ausnahmezustands gestellt. Der Jurist kann aber eigentlich nur ein „Advokat der Mittelbarkeit“ (WdS 108) sein. Schmitt war zwar der Meinung, dass die politische Theorie im 20. Jahrhundert von der „irrationalistischen“ Willensbildung der Massen ausgehen und die Medien politischer Kommunikation darauf ausrichten muss. Er wünschte als Jurist aber den „Aufschub“ und die rechts- und verfassungsstaatliche Formierung eines Normalzustands. Dem apokalyptischen „Einbruch“ des Ausnahmezustands konnte er aber in seiner doppelten Optik und expressionistischen Prägung einen postkonventionellen religiösen und mystischen Sinn abgewinnen. Mauthner gehörte dabei zu den Autoren, die ihm früh einige Stichworte gaben.