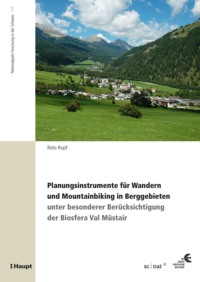Kitabı oku: «Planungsinstrumente für Wandern und Mountainbiking in Berggebieten», sayfa 3
2 Outdoorsport – Management- und Planungsmethoden
2.1 Überblick
„Sport in unserer malerischen Natur ist ein besonderes Erlebnis. Für die Biosfera Val Müstair sind die Sportlerinnen und Sportler willkommene Gäste und eine Stütze unserer Wirtschaft. Damit wir unseren Gästen auch künftig einmalige Erlebnisse in einer intakten Natur anbieten können, sind wir auf das Management des Outdoorsports angewiesen. “ (Gabriella Binkert Becchetti, ehemalige Direktorin Biosfera Val Müstair: Testimonial zum Weiterbildungsstudiengang „CAS Outdoorsport Management“ 2013)
Mit diesem Statement fasst die ehemalige Direktorin der Biosfera Val Müstair die Situation in prägnanten Worten zusammen. Allein die Antwort auf die Frage „wie?“ bleibt offen.
In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen für die Arbeit dargelegt, zentrale Begriffe definiert und der Forschungsstand aufgearbeitet. In einem ersten Block (Kapitel 2.2 – 2.6) wird das Umfeld der Arbeit, also die Zusammenhänge zwischen Tourismus, Freizeit und Sport beleuchtet, welche sich überschneidende Bereiche darstellen (vgl. Abbildung 2.1). Ein spezieller Fokus wird auf den naturorientierten Outdoorsport in der Freizeit gerichtet – insbesondere auf Wandern und Mountainbiking.

Abbildung 2.1: Thematisches Umfeld der Arbeit (eigene Darstellung)
In einem zweiten Block in Kapitel 2.7 steht die Planung im Bereich Outdoorsport und Natur in den Alpen im Zentrum der Betrachtungen (vgl. Abbildung 2.2). Bestehende Planungsmethoden und -konzepte sowie Methoden für die Erfassung der Raumnutzung werden vorgestellt. Eine besondere Aufgabe ist dies für Grossschutzgebiete, Pärke oder Outdoorsport-Destinationen – diese planen nicht nur angebotsseitig umweltnormkonforme Infrastrukturen, sondern möchten gleichzeitig eindrückliche Naturerlebnisse für Besucher oder Gäste anbieten. In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf Wanderern und Mountainbikern. Betreffend der Nachfrageorientierung weist die Standard-Planung (vgl. gestrichelte Linien Abbildung 2.2) beispielsweise bei Baugesuchen oder Umweltverträglichkeitsprüfungen einige Mängel auf, indem sie die Wechselwirkungen der Wanderer und Mountainbiker auf die Natur, auf einander sowie zu den Infrastrukturen und weiteren Outdoorsport-Angeboten kaum berücksichtigen (vgl. ausgezogene Pfeile in Abbildung 2.2). In einer optimierten Planung soll diesen Wechselwirkungen Rechnung getragen werden.

Abbildung 2.2: Optimierte Planung im Bereich Outdoorsport und Natur mit neuen Beziehungen zwischen Nutzern und dem Planungsgegenstand (eigene Darstellung)
Dazu werden in den Kapiteln 2.8 – 2.10 neue bedürfnisintegrierende und die für die nachfolgenden Untersuchungen zentrale Methoden Discrete-Choice-Experiment und Agenten-basiertes Modell vorgestellt. Abschliessend werden als Folgerung dieser Aufarbeitung die konkreten Forschungslücken und -fragen in Kapitel 2.11 formuliert
2.2 Zentrale Begriffe und systemische Betrachtungen
2.2.1 Outdoorsport im Kontext von Tourismus und Freizeit
2.2.1.1 Tourismus
Outdoorsport ist im Begriffsgefüge von Freizeit, Tourismus und Sport eingebettet (vgl. Abbildung 2.1), für welche vielfältige Definitionen existieren, die teilweise sehr allgemein gehalten und schwer operationalisierbar sind (Bieger, 2010).
So kann Tourismus angebotsseitig definiert werden, wenn die Abgrenzung gegenüber anderen Wirtschaftszweigen im Vordergrund steht; wobei diese Abgrenzungen jedoch nicht absolut erfolgen können. Zudem existieren nachfrageseitige Definitionen des Tourismusbegriffes mit „Touristen“ im Zentrum der Definition. Die World Tourism Organisation der Vereinigten Nationen (UNWTO) definiert Touristen wie folgt: Ein Tourist ist eine Person, die eine Reise in eine Destination ausserhalb der üblichen Umgebung unternimmt und dabei mindestens einmal, aber weniger als 365-mal in der Destination übernachtet. Zusätzlich darf das primäre Ziel dieser Reise nicht in der Suche einer Arbeitsstelle liegen. Erfolgt das Aufsuchen der Destination ohne Übernachtung, wird die Person als Besucher bezeichnet (United Nations World Tourism Organisation, 2013).
Die touristische Destination wird als Ort oder Region verstanden, welche mit ihren Eigenschaften für den Grund der Reise entscheidend ist. Die Reise in eine Destination kann bei Touristen wie bei Besuchern beruflich oder privat begründet sein (Freyer, 1998, Bieger, 2010, United Nations World Tourism Organisation, 2013).
Zur ganzheitlichen Erfassung des Phänomens Tourismus bieten sich Systemmodelle an (Müller, 2002). Anfänglich waren dies sehr einfache, statische Modelle, die zunehmend durch komplexere, dynamische Modelle abgelöst werden (Bieger, 2010). Ein erwähnenswertes Modell ist das touristische Strukturmodell (vgl. Abbildung 2.3), das im Rahmen des Schweizerischen Tourismuskonzeptes im Jahr 1979 entwickelt wurde (Beratende Kommission für Fremdenverkehr des Bundesrates (Hrsg.), 1979). Diesem Modell kann eine gewisse Vorreiterrolle zugesprochen werden, da es bereits Ende der 1970er-Jahre eine nachhaltige Entwicklung beinhaltete (Stettler, 2012) – also acht Jahre vor der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitskonzepts mit dem Brundtland-Bericht der Vereinigten Nationen (Brundtland und Khalid, 1987). Das touristische Strukturmodell ist ein offenes System mit Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Elementen (Bieger, 2010). Verschiedene Ereignisse wie beispielsweise die Erweiterung der touristischen Infrastruktur mit der Eröffnung eines neuen Weges können Veränderungen des ganzen Systems bewirken, indem sich die Nutzungen in einer Region wandeln (Kernen et al., 2010) oder neue Gästesegmente anziehen usw. Solche Systemmodelle bilden die Grundlage für die Modellierung künftiger Szenarien (vgl. Abbildung 2.3).

Abbildung 2.3: Touristisches Strukturmodell (leicht verändert nach Beratende Kommission für Fremdenverkehr des Bundesrates (Hrsg.), 1979, 84)
Einige Jahre später entwarf Krippendorf (1984) ein Modell für das Leben der Menschen in der Industriegesellschaft (vgl. Abbildung 2.4). Dabei betrachtet er den menschlichen Alltag als Dreiteilung zwischen Arbeit, Wohnen und Freizeit. Dieses Gefüge stellt er in den Kontext der Dimensionen Gesellschaft (W erthaltungen) – Wirtschaft sowie Staat – Umwelt. Tourismus und Reisen sind im Modell von Krippendorf als Gestaltung eines Gegenalltags zu verstehen, in welchem Reisende auf Bereiste treffen – Menschen im Gegenalltag begegnen also Menschen im Alltag. Im Modell sind zudem wichtige Rückkoppelungen aufgezeigt, welchen oftmals zu wenig Beachtung geschenkt wird.

Abbildung 2.4: Industriegesellschaftliches Lebensmodell (Krippendorf, 1984, 29)
Aus der nachfrageseitigen Definition des Tourismus werden verschiedene Tourismusarten nach dem Motiv der Reise festgelegt (Kaspar, 1991, Kaspar, 1996), welche z.T. heute immer noch ihre Berechtigung haben (Bieger, 2010), sich aber zunehmend überschneiden. Zu nennen sind u.a.
- Erholungstourismus:
- Nah- und Ferienerholung zur physischen und psychischen Regeneration
- Kurerholung zur Herstellung von Heilung
- Kulturorientierter Tourismus:
- Bildungstourismus (Kennenlernen anderer Kulturen und Sitten)
- Alternativtourismus (Kennenlernen des Lebens anderer individueller Menschen in ihrem Wohnumfeld)
- Wallfahrtstourismus
- Gesellschaftsorientierter Tourismus
- Verwandtentourismus
- Klubtourismus (Integration des Feriengastes in der Gruppe)
- Sporttourismus
- Aktiver Sport
- Passiver Sport
- Wirtschaftsorientierter Tourismus
- Politikorientierter Tourismus
Hyde und Laesser (Bieger, 2010) verfolgen einen aktivitätsorientierten Strukturansatz bei der Definition des Tourismus und schlagen drei Makrostrukturen vor, bei welchen sich das Reiseverhalten der Touristen mit den damit verknüpften Strukturen des Tourismussystems voneinander unterscheidet:
- Ferien an Ort und Stelle
- Ferien mit arrangierten Touren
- Ferien mit freien Touren
Zum Reiseverhalten äussert sich Bieger (2008, 9) wie folgt und bietet damit eine Erklärung für die zunehmende Attraktivität des Outdoorsports:
„Je mehr der Mensch in seinem Alltag die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen spürt, je mehr er durch Normen geprägt wird, je mehr ein anonymer Staat in sein Leben eingreift und je weniger er am Arbeitsplatz direkt mitgestalten kann, desto mehr will er seine Ferien aktiv, naturnah und möglichst frei erleben. “
2.2.1.2 Freizeit
Freizeit wird in der Literatur sehr unterschiedlich festgelegt, vielfach wird zwischen negativen und positiven Formulierungen unterschieden. Negative Freizeitdefinitionen bezeichnen Freizeit als Residualzeit der Lebenszeit (vgl. Abbildung 2.4), d.h. als Zeit, welche neben Arbeiten und Wohnen (schlafen, essen, familiäre Kontakte pflegen usw.) noch übrig bleibt (Egner, 2000, Müller, 2002). Bei den positiven Definitionsansätzen erfolgt die Beschreibung von Freizeit als frei verfügbare Zeit im Sinne der Selbstbestimmung oder über die Zuordnung von Funktionen wie Erholung, Kontemplation, Kompensation des Berufsalltags (Müller, 2002).
In Abbildung 2.5 kombiniert Bieger (2010) diese beiden Definitionsansätze zu einem neuen Modell im Bezugsrahmen von „Inhaltsautonomie“ (was ich tue) und „Zeitautonomie“ (wann ich etwas tue). In den letzten Jahren treten zunehmend Vermischungstendenzen zwischen Erwerbsarbeitszeit und Freizeit auf und somit steht der dualistische Ansatz vermehrt in der Kritik (Müller, 2002).

Abbildung 2.5: Abgrenzung von Freizeit (Bieger, 2010, 91)
Die Aussagen zur Freizeitthematik in der Schweiz stützen sich vielfach auf die im Rahmen der Langzeitbeobachtung UNIVOX durchgeführten, repräsentativen Telefonerhebungen von gfs-Zürich in Zusammenarbeit mit der Universität Bern, Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus (Müller, 2010). Hinsichtlich des Stellenwertes wird in der Befragung 2009 Freizeit als drittwichtigster Lebensbereich nach Familie/Freunde und Gesundheit unmittelbar vor Arbeit/Beruf eingestuft. Gegenüber der Befragung 1996 stieg die Bedeutung der Freizeit merklich. So schätzten im Jahr 1996 45 % der Befragten und im Jahr 2009 58 % den Lebensbereich Freizeit als sehr wichtig ein (Müller, 2010).
2.2.1.3 Sport als Freizeitaktivität
Die für die Schweizer Bevölkerung wichtigste und tägliche Freizeitbeschäftigung stellt der Medienkonsum dar (Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften, Radio hören, Surfen im Internet, Bücher lesen). „Aktiv Sport treiben“ wird typischerweise wöchentlich ausgeführt (31 %). Als tägliche Freizeitbeschäftigung hat „aktiv Sport treiben“ zwischen den Jahren 2000 und 2009 von 14 % auf 19 % zugenommen (Müller, 2010).
Sport nimmt als Freizeitbetätigung also eine wichtige Stellung ein und wird diese auch in Zukunft behalten. So wollten künftig 47 % der Befragten dem „aktiven Sport treiben“ eine höhere Bedeutung zukommen lassen (Müller, 2010). Ob dies die Befragten tatsächlich umsetzen werden, ist eine andere Frage, denn bereits 2004 gaben 48 % an, dass sie künftig mehr Sport treiben wollten (Müller, 2010).
In der deutschen Bevölkerung konnte ebenfalls eine Zunahme der regelmässigen Sportaktivitäten um ca. 5 % (n=15 202 Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren) zwischen den Jahren 1992 und 2001 beobachtet werden. Dabei betraf die Zunahme in erster Linie die Frauen (Becker et al., 2006).
2.2.1.4 Herleitung der Definition des naturorientierten Outdoorsports
Für den Begriff Sport hat sich keine allgemeingültige Definition durchgesetzt (Stettler, 1997, Lamprecht und Stamm, 2000, Scherrer, 2001, Wopp, 2006). Eine weit gefasste Definition liefert Wopp (2006, 24): „Sport ist die Lösung von Bewegungsaufgaben, die von den Handelnden als Sport bezeichnet werden. “ Diese Überlassung der Definition von Sport an die Handelnden wandten bereits Lamprecht und Stamm (2000) an. Einen weiteren Aspekt der Freiwilligkeit bringt der Schweizerische Landesverband für Sport (heute Swiss Olympic) ein und definiert Sport wie folgt: „Sport ist jede freudbetonte, körperliche Betätigung, die spielerische Eigenschaften aufweist und Möglichkeiten einer verantwortungsbewussten Auseinandersetzung mit sich selbst, mit andern und der Natur bietet. “ (Lorch, 1995, 6).
Freizeitsport beinhaltet gemäss Wopp (2006) die Idee „Sport für alle“. Andere Definitionen von Freizeitsport haben die Leistungsverbesserung explizit nicht zum Ziel (Brinkmann und Spiegel, 1986). Da der Bereich Fitness und Leistungssteigerung im Freizeitsport für viele Menschen eine wichtige Rolle spielt (Beier, 2001, Woll, 2006, Lamprecht et al., 2008a, Wydler, 2011), wird diese Definition nicht weiter verfolgt, denn Sport und Freizeitsport, insbesondere Ausdauersport wie Triathlon, Laufen oder Radfahren, bergen gar eine gewisse Suchtgefahr in sich. Dies manifestiert sich, indem die Sportler körperliche Signale ignorieren, trotz Schmerzen trainieren, Lebenspartner und Freunde zugunsten des Trainings vernachlässigen oder Entzugserscheinungen auftreten (NZZ am Sonntag, 2013).
Diverse Kategorisierungen von Sportarten werden unter Anwendung verschiedenster Kriterien vollzogen; in Tabelle 2.1 sind einige Beispiele angeführt.
Tabelle 2.1: Einteilungssysteme von Sportarten – einige Beispiele (eigene Darstellung)
| Kriterium | Sportartentyp | Erläuterung |
| Antriebsart der Bewegung | Motorsport | |
| Bewegungsart | LaufsportRadsportWurfsport | |
| Medium | AerosportBergsportSchneesportWassersport | |
| Motiv | GesundheitssportNatursport | Auseinandersetzung mit sich selbst in der Natur und mit der Natur (Seewald et al., 1998) |
| Risikosport | Gefahr wird gesucht, jedoch ist deren Verwirklichung nicht gewollt (Scherrer, 2001) – d.h. es wird der Adrenalinschub gesucht und die Gefahr dadurch in Kauf genommen. | |
| Trendsport | Sportarten, welche in jüngster Zeit entstanden sind und welche einer Trendkurve unterliegen (Roth et al., 2003) | |
| Organisationsform | IndividualsportTeamsport | |
| Professionalität | Amateursport | Amateursportler erhalten für ihre Leistung keine Entschädigung, allenfalls Auslagenvergütungen (Scherrer, 2001) |
| Berufssport | Berufssportler üben Sport im Rahmen eines Vertragsverhältnisses aus, meist Arbeitsverträge (Scherrer, 2001) | |
| Breitensport / Freizeitsport | Sport für alle (Wopp, 2006) | |
| Leistungssport / Spitzensport | Sport zur Erzielung besonderer Leistungen, insb. auch an Wettkämpfen | |
| Umgebung | IndoorsportOutdoorsport | Sportarten, welche in einer Halle betrieben werdenSportarten, welche im Freien ausgeübt werden. (vgl. auch unten) |
Im Zentrum dieser Arbeit stehen die Begriffe Natursport und Outdoorsport, welche im deutschen Sprachgebrauch teilweise synonym, hier aber differenziert verwendet werden. Abbildung 2.6 stellt den Zusammenhang verschiedener Begriffe in diesem Kontext vor, welche anschliessend beschrieben werden.

Abbildung 2.6: Begriffe im Bereich Outdoorsport (eigene Darstellung)
Outdoorsport ist gemäss Roth et al. (2004) kein englischsprachiger Begriff, sondern eine Wortkreation, welche v.a. im deutschsprachigen Raum und in den Niederlanden Verwendung findet. Seewald et al. (1998, 166) definieren Outdoorsport wie folgt:
„Outdoorsportarten sind anlagengebundene oder nicht anlagengebundene Freizeitsportarten, die immer im Freien ausgeführt werden, einem Modetrend unterliegen können, auch auf speziell für sie errichteten offenen Anlagen durchgeführt werden und auch Wettkampfcharakter aufweisen können.“ Im englischen Sprachraum wird von „outdoor recreation“ oder von „outdoor recreation activitiy“ gesprochen. Im Unterschied zu Seewald et al. (1998) sind in der englischen Bedeutung allerdings Motorsportarten wie Motorbootfahren, Schneemobilfahren, Offroad-fahren mit Motorrädern, Quads, Geländewagen usw. ebenfalls enthalten (Flather und Cordell, 1995, Outdoor Recreation Resources Review Commission 1962 zitiert nach: Fennell, 2002, Manning, 2011).
Roth et al. (2004, 17) definieren Natursport als „selbstbestimmte Bewegungsaktivität in der freien Landschaft, die sowohl die eigentliche Ausübung von Sportarten als auch die körperliche Bewegung aus verschiedenen Motiven und in unterschiedlichen Erlebnisformen umfasst. Dabei ist die Bewegungsaktivität weder an Motorantrieb, noch an Sportanlagen zwingend gebunden und ermöglicht die Auseinandersetzung mit sich selbst in der Natur und mit der Natur. “
Egner (2000) kombiniert die Begriffe Natursport und Trendsport zu einem neuen Begriffspaar „Natur- und Trendsport“ oder verwendet Trendsport gar als Synonym zu Outdoorsport wie auch Margraf et al. (1999). Wie Roth et al. (2004) ausführen, verstehen sich aber viele Natursportler selbst nicht als Trendsportler und möchten nicht als solche bezeichnet werden.
Wopp (2006), Roth et al. (2004) sowie Lamprecht und Stamm (1998) setzen sich mit dem Phänomen Trends im Sport auseinander. Wopp entwickelte ein Trendsport-Modell in Bezug auf die Wirkungsdauer und die Wirkungsbreite von Trends (vgl. Abbildung 2.7).

Abbildung 2.7: Sportarten-Trendportfolio (verändert nach Wopp, 2006, 38)
Die Wirkungsbreite wird im Modell von Wopp (2006) als sehr gross eingeschätzt, wenn viele Bereiche der Gesellschaft betroffen sind, z.B. Konsum, Technologie, Bevölkerungsgruppen, Politik, Kommunikation usw. Die genaue Trendschwelle (zum Hype oder zu Megatrends) kann nicht beziffert werden. Bei der Wirkungsdauer wird dann von einem Trend gesprochen, wenn die Dauer des Phänomens fünf Jahre überschreitet.
Für Trendsportarten formulieren Roth et al. (2004) folgende Merkmale:
- Sportaktivität muss den Bedürfnissen vieler Menschen entsprechen
- Sportaktivität muss relativ leicht erlernbar sein
- Erleben neuer körperlicher Wahrnehmungen
- Steigerungsfähigkeit der Ausübung bis zum Extremen
- Kleines Risikopotential bei normaler Ausführung
- Exklusivität
- Mit der Sportaktivität verbundener Lifestyle kann kommerzialisiert werden
- Bei der Sportaktivität sollen technische Geräte eingesetzt werden können
- Die Aktivität soll nicht an feste Gruppen gebunden und flexibel bezüglich Ort und Zeit sein
Bei der Erfindung neuer Trendsportarten kommt oftmals ein sogenanntes „Refraiming“ zum Einsatz (Wopp, 2006), beispielsweise die Entwicklung des Nordic walking aus dem Wandern. Es handelt sich dabei um eine leicht erlernbare Aktivität mit dem Einbezug der Armmuskulatur als neues Körpergefühl, einem kommerzialisierbaren Lifestyle sowie dem Einsatz neuer technischer Geräte usw.
Die Abgrenzung von den oben aufgeführten Sportkategorien zum Risikosport ist fliessend. Im Risikosport in reiner Form wird dabei die Gefahr gesucht, resp. es wird der Adrenalinschub gesucht und die Gefahr dadurch in Kauf genommen wie beispielsweise beim Base-jumping. Allerdings wird vieles unternommen, damit das Gefahrenereignis nicht eintritt (Scherrer, 2001). Prinzipiell bergen aber alle Outdoorsportarten die Möglichkeit in sich, in der Ausübung einer Extremform zu einer Risikosportart zu werden, wie z.B. vom Bergsteigen zum Free-Climbing.
Aus den obigen Ausführungen ist ersichtlich, dass sich nicht jede Sportart eindeutig einem Sporttypus zuordnen lässt (vgl. Abbildung 2.6), insbesondere wenn deren Ausdifferenzierungen einbezogen sind. Obwohl teilweise Outdoorsport und Natursport mit Trendsport gleichgesetzt werden, haftet dem Begriff Natursport ein etwas technikfeindlicher Beigeschmack an, der sich mit neueren Sportarten wie E-Mountainbiking nur noch bedingt vereinbaren lässt.
Als Basis für die vorliegende Arbeit wird in Anlehnung an Seewald et al. (1998) und Roth et al. (2004) ein neuer Begriff geprägt – der „naturorientierte Outdoorsport“:
Naturorientierte Outdoorsportarten sind anlagengebundene oder nicht anlagengebundene Sportarten, welche immer im Freien ausgeführt werden. Die Auseinandersetzung mit sich selbst in der Natur und mit der Natur sind dabei inhärente Bestandteile. Naturorientierte Outdoorsportarten werden vorwiegend ohne Motorunterstützung praktiziert, können einen hohen Einsatz von technischen Hilfsmitteln bedingen oder auch Wettkampfcharakter aufweisen.3
Im Begriff des naturorientierten Outdoorsports ist das Motiv der Natur als zentrales Element enthalten. Der Begriff bietet zudem mit dem Outdoorsport genügend Raum, um neue Entwicklungen aufzunehmen und somit als Basis für zukunftsgerichtete Planungen.
2.2.1.5 Bedeutung verschiedener Sportarten in der Schweiz
In der Schweiz wurden in den Jahren 2000 und 2008 grosse Sportstudien durchgeführt (Lamprecht und Stamm, 2000, Lamprecht et al., 2008a). In der nachfolgenden Tabelle 2.2 sind die Ergebnisse der Studie 2008 mit 10 562 Befragten zwischen 15 und 74 Jahren sowie den Veränderungen gegenüber der Befragung 2000 aufgeführt. Dabei zeigt sich, dass Aktivitäten des naturorientierten Outdoorsports wie Radfahren, Mountainbike sowie Wandern, Walking und Bergwandern von der schweizerischen Bevölkerung am häufigsten ausgeübt werden. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass in der Schweiz je ca. 2 Millionen Menschen Radfahren/Mountainbiking und Wandern in ihrer Freizeit als Sportaktivität betreiben. Die weite Verbreitung von Fahrrädern zeigen Zahlen vom Schweizerischen Bundesamt für Statistik und liefern so ein weiteres Indiz für die Outdoorsportaktivität der schweizerischen Bevölkerung. So wurden bei der letzten Erhebung im Jahr 1996 3,7 Millionen Fahrräder festgestellt, und im Jahr 2010 waren in 69 % aller Haushalte mindestens ein Fahrrad und in 47 % mindestens ein Mountainbike vorhanden. Ca. 50 % der Fahrradkilometer werden für Freizeit zurückgelegt (Bundesamt für Statistik und Bundesamt für Raumentwicklung, 2012).
Tabelle 2.2: Die 20 beliebtesten Sportarten in der Schweiz im Jahr 2008 (Auszug aus Lamprecht et al., 2008a, 16; verändert; * Naturorientierter Outdoorsport)

Aufgrund der grossen Bedeutung des Wanderns, beziehungsweise des Bergwanderns, sowie des Mountainbikings im naturorientierten Outdoorsport in der Schweiz fokussiert die vorliegende Arbeit auf die Untersuchung dieser beiden Sportarten.
2.2.2 Entwicklungen im naturorientierten Outdoorsport
2.2.2.1 Allgemeine Entwicklungen im naturorientierten Outdoorsport zwischen 1960 und 2010
Naturorientierter Outdoorsport ist für die grosse Mehrheit der Bevölkerung eine Freizeitbeschäftigung, nur wenige betreiben diese Sportarten als Berufssport, u.a. Bergführer, Mountainbike-Guides usw. Deshalb ist die Entwicklung dieser Sportarten in erster Linie im Zusammenhang mit der Freizeitentwicklung zu betrachten.
Ein Ansatz für die Ermittlung der Zeit, welche für den Freizeitsport zur Verfügung steht, liefert der negative Ansatz der Freizeitdefinition (vgl. Kapitel 2.2.1.2), bei welcher Freizeit als Restzeit festgelegt wird. Ein Rückgang der Arbeitszeit hätte also mehr Freizeit zur Folge. Dieser Rückgang der Arbeitszeit in der Schweiz kann auch festgestellt werden. 1946 betrug die mittlere wöchentliche Arbeitszeit noch 47,9 Stunden. Diese reduzierte sich bis 1985 kontinuierlich auf 43,4 Stunden pro Woche. Bis ins Jahr 1990 erfolgte ein weiterer Schritt zurück auf 42,2 Stunden pro Woche, seither war die Abnahme nur noch geringfügig auf 41,9 Stunden pro Woche im Jahr 1998 (Schweizerischer Bundesrat, 2000) und auf 41,4 Stunden im Jahr 2012 (Bundesamt für Statistik, 2013b). Allerdings sind diese einzelnen Werte nicht exakt vergleichbar, da über die Jahrzehnte die Erfassungsmethodik geändert wurde.
Seit den 1970er-Jahren führt Swiss Olympic zur Erfassung der Sportaktivitäten direkte Befragungen durch (vgl. Abbildung 2.8). Offensichtlich ist dabei der Anstieg des Anteils der Personen, welche mehrmals pro Woche Sport treiben anstelle der einmal oder weniger als einmal pro Woche sportlich aktiven Bevölkerung. Der Anteil der Nicht-Sportler blieb annähernd konstant. Bei den ausgeübten Sportarten spielten die naturorientierten Outdoorsportarten stets eine wichtige Rolle.

Abbildung2.8: Entwicklung der Sportaktivität bei der Schweizer Bevölkerung 1978–2014 (verändert nachLamprecht et al., 2014, 7)
Gemäss des Spezial-Eurobarometers „Sport und körperliche Betätigung“ (TNS Opinion & Social, 2010) nahmen die Sportaktivitäten der Bevölkerung in Europa ebenfalls zu. Zwischen den Ländern zeigten sich einige Unterschiede, insbesondere die Bevölkerung der nordeuropäischen Länder Schweden, Niederlande, Finnland, Dänemark und Irland war in der Freizeit häufig sportlich aktiv (TNS Opinion & Social, 2010).
In den USA werden seit 1960 landesweite Untersuchungen im Freizeitbereich durchgeführt (National Survey on Recreation and the Environment NSRE). Freizeit wurde stets als fundamentaler Bestandteil des Lebensstils betrachtet und es war ebenfalls ein starker Zuwachs der sportlichen Betätigung zu beobachten (Cordell et al., 2002). Die Anzahl Personen, die „Outdoor Recreation“ betreiben, erhöhte s ich zwischen 2000 und 2007 um 25 %, die Anzahl Outdoor-Tage stiegen dabei um fast 14 % (Cordell, 2008). Einige Aktivitäten, darunter Mountainbiking, verzeichneten allerdings einen Rückgang (Cordell et al., 2008). Freizeitaktivitäten, die zum naturorientieren Outdoorsport zählen, verzehnfachten sich in den US-Wilderness-Gebieten zwischen 1950 und 1990 (Cole und Landres, 1996). Egner (2000), Manning (2011) und andere Autoren zeigten ebenfalls starke Zunahmen bei den Besuchern in Nationalparks der USA auf. Seit Mitte der 1990er-Jahre stagnierte die Besucherzahl allerdings in einigen Parks (Egner, 2000, Manning, 2007).
Beim Vergleich der Veränderungen der 20 am häufigsten betriebenen Sportarten in der Schweiz zwischen den Jahren 2000 und 2008 (vgl. Tabelle 2.2) fällt auf, dass die naturorientierten Outdoorsportarten im Durchschnitt um 2,13 % zunahmen, während die restlichen Sportarten eine mittleren Abnahme von -0,32 % zu verzeichnen hatten6. Zu diesem relativ hohen Zuwachs bei den naturorientieren Outdoorsportarten trugen v.a. das Walking und das Bergwandern bei (Lamprecht et al., 2008a).
Aufgrund technischer Entwicklungen der Ausrüstungen erfuhren die Sportarten in den letzten Jahren eine enorme Ausdifferenzierung, die in teilweise recht kurzlebigen Trendsportarten mündeten (Strasdas et al., 1994). Aus dem Mountainbiking der 1980er-Jahre entwickelten sich die Sportarten Marathon-Biking, Allmountain-Biking, Freeriding, Downhill-Biking, Dirt-Biking, Trial-Biking, Heli-Biking, Uphill, Snow-Downhill (Egner, 2000, Wadenpohl und Kenny, 2011), welche andere Infrastrukturen bedürfen und Menschen mit unterschiedlichen Motiven ansprechen.
2.2.2.2 Motive im naturorientierten Outdoorsport
In der Freizeitforschung und speziell in der „outdoor-recreation“-Forschung in Nordamerika wurde die Frage nach Motiven eingehend bearbeitet (Manning, 2011). Erste Studien fanden um 1960 zum Angeln statt (Bultena und Taves, 1961), einer Outdooraktivität, die bis heute immer wieder eingehend untersucht wird (Hunt et al., 2007, Dorow et al., 2010, Hunt et al., 2010). In einer Metastudie über die Messbarkeit der Motivation für Freizeitaktivitäten untersuchten Manfredo et al. (1996) 36 Einzelstudien mit über 300 Faktoren. Für diese Studien bildeten die Motivationstheorie und später auch die „theory of planned behavior“ von Ajzen die Grundlagen (Ajzen, 1991, Ajzen und Driver, 1991). Ein Resultat dieser und anderer Vergleiche (Manning, 2011) war, dass die Motivationen bei gleicher Aktivität im gleichen Raum sehr unterschiedlich sein können. Basierend auf der „theory of planned behavior“ und auf den Motivclustern von Rheinberg (1993) führte Zeidenitz die erste Studie dieser Art für Freizeitaktivitäten im Freien in der Schweiz durch (Zeidenitz, 2005, Zeidenitz et al., 2007). Die dabei verwendeten dreizehn Motivationsfaktoren bildeten später die Grundlage für weitere Befragungen im Schweizerischen Nationalpark (Filli et al., 2007, Campell et al., 2010):
1) Alltagsflucht
2) Eigene Aktivität
3) Schönes Landschaftserlebnis
4) Allein sein
5) Naturerlebnis
6) Abenteuer, Risiko, Nervenkitzel erleben
7) Erholung und Entspannung finden
8) Zusammensein mit Freunden oder Familie
9) Zeit und Raum vergessen
10) Spass haben
11) Kosten sparen
12) Gesundheit und Fitness
13) Wildtierbeobachtung
Bei der Befragung von Zeidenitz (2005, n=1340) waren Erholung/Entspannung, schönes Landschaftserlebnis, Naturerlebnis sowie Gesundheit/Fitness die wichtigsten Motive und Abenteuer/Risiko/Nervenkitzel sowie Kosten sparen die Motive mit der geringsten Bedeutung. Im Speziellen untersuchte Zeidenitz als Kontrastbeispiele die Outdoor-Aktivitäten Variantenfahren (Ski/Snowboard, n=116) und Picknicken (n=740). Bei den meisten Motiven unterschieden sich die Beurteilungen der Wichtigkeit zwischen den beiden Gruppen nicht signifikant. Ein deutlicher Unterschied bestand allerdings im Motiv Abenteuer/Risiko/Nervenkitzel (wichtiger für Variantenfahrer) sowie in den Motiven Landschaft erleben, Naturerlebnis, Zusammensein mit Freunden oder Familie und Wildtierbeobachtung (wichtiger für Picknicker).
In Deutschland untersuchte Beier (2001) mit einer anderen Kategorisierung die Motivationen für Outdoorsport-Aktivitäten. Die drei wichtigsten der acht Anreize waren Naturerleben, Leistungsverbesserung/Kompetenzerleben und soziales Wohlbefinden, mit Abstand an letzter Stelle wurde die Leistungspräsentation eingestuft. Zwischen den sechs untersuchten Sportarten (ntotal=244) gab es markante Differenzen, sodass nicht von einem typischen Outdoorsportler gesprochen werden kann (vgl. auch Manning, 2011).
Bei verschiedenen Studien über die Besuchsmotive im Schweizerischen Nationalpark von 1993 (Lozza, 1996) bis 2007 (Camenisch, 2008, Campell et al., 2010) nahm gegenüber 1993 das Motiv der körperlichen Betätigung mit Wandern markant zu (+22 %), während der Genuss der Pflanzenwelt für Parkbesuche mit -11 % merklich an Bedeutung verlor. Allerdings unterschieden sich die Präferenzen und Motivationen für das Aufsuchen der verschiedenen Täler; so stand in der Val Trupchun die Tierbeobachtung an erster Stelle und in der Val Minger die Wanderung in der unberührten Landschaft (Lozza, 1996, Campell et al., 2010). Camenisch (2008) bestätigte obige Aussagen auf der Grundlage einer Befragung ausserhalb des Parks in der Nationalparkregion, bei welcher die Befragten das Naturerlebnis, Erholung sowie körperliche Betätigung als Hauptgründe des Besuchs im Nationalpark angaben.