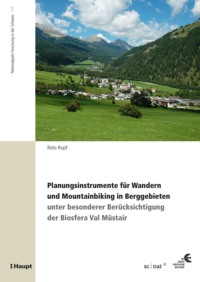Kitabı oku: «Planungsinstrumente für Wandern und Mountainbiking in Berggebieten», sayfa 5
In Deutschland verzeichnete Brämer mit den jährlich durchgeführten Allensbacher Marktanalysen (2000–2009) einen Wanderer-Anteil zwischen ca. 53 % und etwas über 60 % der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren (Brämer, 2008a). Ein Maximum wurde in den Jahren 2004 und 2005 erreicht und seither nahm die Zahl der Wanderer bis ins Jahr 2009 auf ca. 55 % ab, was immer noch etwa 36 Mio. Deutschen entspricht. Wandern ist in Deutschland v.a. in der Altersgruppe der 40–59-Jährigen beliebt, welche einen Anteil von etwa 54 % der Wanderer ausmachen (Brämer, 2008a).
Wandern in den Bergen ist auch in anderen Regionen der Welt sehr verbreitet und oft ein wichtiger Wirtschaftszweig für die lokale Bevölkerung. Im Himalaya werden immer mehr Regionen für Wanderungen und Trekkings zugelassen und bieten so für die sogenannten „Firsts“ (vgl. Kapitel 2.2.2.3) neue Erlebnismöglichkeiten und Herausforderungen (Geneletti und Dawa, 2009) und gleichzeitig willkommene Einnahmequellen für die einheimische Bevölkerung (Beispiel Great Himalaya Trail, 2014). Verschiedene Studien unterstreichen die grosse Popularität des Wanderns in Nordamerika und Australien (u.a. Ewert und Hollenhorst, 1997, Cordell, 2008, Pickering et al., 2010b, Hawkins und Smith, 2011).
2.4.2 Bedürfnisse und Gewohnheiten der Wanderer
Wandern als Freizeitbetätigung hatte seine Anfänge im frühen 18. und 19. Jahrhundert, Motive lagen oftmals in der Freude an der Natur und in der Flucht vor dem Alltag, insbesondere für junge Menschen (Schümer, 2010) – also Motive, welche auch heute noch verbreitet sind, wie nachfolgende Ausführungen aufzeigen.
In der Schweiz untersuchten Lamprecht et al. die Motive von Wanderern in zwei verschiedenen Studien, einerseits allgemein im Rahmen von „Sport Schweiz 2008“ bei 10 262 Personen (Lamprecht et al., 2008a) und andererseits mit einer schriftlichen Befragung der Wandernden vor Ort in verschiedenen Wandergebieten bei 2 225 Personen (Lamprecht et al., 2009). Aus Abbildung 2.10 geht hervor, dass sich die Sportmotive der Wanderer nur unwesentlich von denen aller Sportler unterschieden. Gesundheit, Abschalten und Einmalige Erlebnisse wurden von Wandernden leicht höher bewertet, während die Motive Spass haben, Fit und trainiert sein, Erfahren von Grenzen, Besser aussehen und Persönliche Leistungsziele von Wandernden leicht niedriger eingestuft wurden als von der Gesamtheit der Sportler (Lamprecht et al., 2009).
In der Wanderstudie von Lamprecht et al. (2009) wurde die Motivationsfrage offen gestellt, und die Wandernden mussten die Motive selber formulieren. Die Antworten wurden anschliessend kategorisiert (vgl. Abbildung 2.11). Das bei den allgemeinen Sportmotiven nicht explizit gefragte Motiv Unberührte Landschaft, Natur führte die Rangliste bei den Wanderern an, gefolgt von Körperliche Bewegung, Sport, Fitness. Letzteres nahm auch bei den allgemeinen Motiven eine wichtige Stellung ein. Am Schluss der Rangliste fanden sich Tiere beobachten und Leistung, wobei diese auch bei den allgemeinen Sportmotiven von geringer Bedeutung war.

Abbildung 2.10: Allgemeine, als sehr wichtig taxierte Sportmotive der Wanderer im Vergleich zu den anderen Sportlern (Lamprecht et al., 2009)

Abbildung 2.11: Spezifische Wandermotive (Lamprecht et al., 2009)
Brämer (2008a) verglich die Entwicklung der Rangfolge der Motive in verschiedenen in Deutschland durchgeführten Studien des Deutschen Wanderinstituts der Jahre 2003, 2006 und 2008. In all den Jahren war Natur und Landschaft geniessen mit Nennungen zwischen 83–91 % das wichtigste Motiv. Neu kam als zweitwichtigstes Motiv mit 70 % Gesundheit hinzu, hingegen verlor Fitness (Sich mal wieder richtig bewegen) an Bedeutung (52 % statt vorher 77 %). Wichtiger wurden in dieser Zeit Entlastung von Berufs- und Alltagsstress sowie das Gemeinschaftserlebnis in kleinen Gruppen mit Partner oder Familie (62 %). Aus der Studie von Pröbstl-Haider et al. (2014) resultierten ähnliche Motive.
Dichter (2004) stellte die Wandermotive in Deutschland denjenigen in der Schweiz gegenüber und unterteilte diese in zwei Achsen: „Leistung – Erholung“ sowie „Sein – Haben“ (vgl. Abbildung 2.12). Unterschiede zeigten sich insbesondere im Bereich Wellness, welcher in Deutschland verbreiteter war und im Bereich Freunde/Geselligkeit, welcher die grösste Gruppe ausmachte und in der Schweiz mit 65 % häufiger genannt wurde.

Abbildung 2.12: Vergleich von Wandermotiven in Deutschland und der Schweiz (Dichter Ernest, 2004, 3, leicht verändert)
Lamprecht et al. (2009) untersuchten, welche Störfaktoren von Wanderern wie häufig wahrgenommen wurden. Der grösste Störfaktor, von 72 % der Befragten genannt, stellte Herumliegender Abfall dar. Immerhin gaben 24 % der Personen an, häufig oder sehr häufig Abfall auf ihren Touren anzutreffen. Die zweitwichtigsten Störfaktoren bildete eine Gruppe von Lärm, Mängel an Markierungen, Motorisierter Verkehr sowie Harter Wegbelag, jeweils von ca. 40 % genannt. Dabei wurde Harter Wegbelag von ca. 20 % häufig erlebt, den anderen Faktoren begegneten die Wanderer nur maximal 10 % häufig. Als dritte nennenswerte Faktoren-Gruppe folgten Radfahrer/Mountainbiker (27 %), Hunde (26 %) und Langweilige Wegstücke (22 %). Mehr als 30 % der Wanderer gaben an, Radfahrer/Mountainbiker sowie Hunde häufig oder sehr häufig anzutreffen.
Diese Störfaktoren werden jedoch nicht von allen Wanderern gleich wahrgenommen. Insbesondere ältere Personen scheinen sich an solchen Faktoren häufiger zu stören (Trachsel und Backhaus, 2011).
Einige Autoren versuchten mit ihren Studien eine Typisierung von Wanderern vorzunehmen. Farias Torbidoni et al. (2005) leiteten in einem Schutzgebiet der Pyrenäen drei Besuchertypen her und stellten diese verschiedenen Wegetypen gegenüber: Naturschutzbesucher, Gelegenheitsbesucher (casual visitors) und Betrachtungsbesucher (contemplators). In einer Studie über Wanderer in teilweise gebirgigen Natura 2000-Schutzgebieten in Katalonien identifizierte Farias Torbidoni drei verschiedene Wanderertypen bezüglich deren Motivation: naturorientierte Wanderer, Sportwanderer und Allgemein interessierte Wanderer. Arnberger und Haider (2005) typisierten Besucher von stadtnahen Wäldern aufgrund ihrer Crowding-Wahrnehmung. Eine Vielzahl von Studien u.a. mit Wanderern und Typisierungen wurde in der Lobau bei Wien von verschiedenen Autoren verfasst (u.a. Taczanowska, 2009, Arnberger et al., 2012). Taczanowska (2009) beschrieb mittels Interviews mit Tourreports drei Besuchertypologien: Klassische Besucher, Infrastrukturgeleitete Besucher und Naturpfad-Besucher (wild-path users). Van Marwijk (2009) unterschied im Niederländischen Dwingelderveld Nationalpark vier Wanderer-Besuchertypen: Kenner, Glückliche Wanderer (happy hiker), Anspruchsvolle Wanderer und Sich gestört fühlende Wanderer (disturbed hiker).
2.4.3 Spezielle Auswirkungen des Wanderns
2.4.3.1 Beeinträchtigungen der Natur und Infrastruktur
Wandern hat vergleichbare Beeinträchtigungen der Natur und Infrastruktur zur Folge wie Mountainbiking (Gander und Ingold, 1997, Cessford, 2003, Taylor und Knight, 2003), eine Zusammenstellung findet sich in Tabelle 2.8. Im Folgenden wird auf einige Besonderheiten eingegangen.
Torn et al. (2009) verglichen die Beeinträchtigung von Wandern mit Reiten und Wintersportarten. Dabei stellte sich heraus, dass das Reiten viel grössere Beeinträchtigungen der Vegetation und der Wege nach sich zieht als Wandern, dass diese aber von der Beschaffenheit der Umgebung abhängig sind. Beispielsweise gedeihen auf den Reitwegen Pflanzen, welche sonst nicht vor Ort vorkommen.
Die Abhängigkeit der Wegschäden von der Topographie, den geologischen und mikroklimatischen Verhältnissen und die relative Unabhängigkeit von der Anzahl Wanderer bestätigt Liebing (1989) bei seinen Untersuchungen im Schweizerischen Nationalpark, wo nur Wandern zur Fortbewegung erlaubt ist. Lorch (1995) erwähnt zusätzlich das Abkürzen von Wegen (sog. Abschneiden bei Kurven), welche oft in der Falllinie verlaufen und deshalb Rinnen für die Erosion vorbereiten.
Einige Autoren untersuchten in verschiedenen Studien die Beeinträchtigungen der Grasnarbe und des Bodens (Pickering et al., 2003, Torn et al., 2009, Pickering, 2010, Pickering et al., 2010a, Pickering et al., 2010b, Pickering et al., 2011). Danach sind die Schäden verursacht durch das Wandern etwas geringer als durch Mountainbiking, allerdings nur bei hoher Frequentierung. Diese Untersuchungen wurden in der Folge auf zusätzliche Standortparameter, beispielsweise Steilheit ausgeweitet (Pickering et al., 2011).12 Entgegen den ersten Befunden (Gander und Ingold, 1997) geht Ingold (2005) aufgrund der Überraschungseffekte durch die höhere Bewegungsgeschwindigkeit ebenfalls von grösseren Beeinträchtigungen von Wildtieren durch Mountainbiking als durch Wandern aus.
Vögel, insbesondere Bodenbrüter, können durch begangene Wanderwege in ihrem Bruterfolg beeinträchtigt werden (Kangas et al., 2010). Eine Erklärung dazu liefert der Umstand, dass viele Wanderer oft von Hunden begleitet sind, welche bestimmte Vogelarten auch angeleint stören (Ingold, 2005). Auf Büschen und Bäumen, resp. in Höhlen brütende Vögel wurden durch die Erholungsnutzung jedoch kaum gestört (Kangas et al., 2010).
2.4.3.2 Konflikte zwischen Wanderern und anderen Outdoorsportlern
Nach von Janowsky und Becker (2002) werden Wanderer nur als Konfliktverursacher wahrgenommen, wenn sie mit einem Hund unterwegs sind (vgl. Kapitel 2.2.3.3). Von einem Konflikt auf niedrigem Niveau kann bei bemerkten Störfaktoren gesprochen werden. Als solche werden von den Wanderern in absteigender Reihenfolge Radfahrer/Mountainbiker (27 %), Hunde (26 %), Reiter (7 %) und Andere Wanderer (3 %) genannt. Solche Begegnungen treten mit Ausnahme von Reitern recht häufig auf. Die Wahrnehmung dieser Störungen ist nicht bei allen Wandergruppen gleich. Insbesondere nichtschweizerische und jüngere Wanderer scheinen toleranter gegenüber Störfaktoren zu sein (Trachsel und Backhaus, 2011). Dies gilt beispielsweise für die Radfahrer/Mountainbiker, welche von den älteren Personen häufiger genannt werden als von den jüngeren (Lamprecht et al., 2009).
Wyttenbach (2012) untersuchte die Störfaktoren für Wanderer auf Wegen am Üetliberg bei Zürich. Die wichtigsten Störfaktoren waren Mountainbiker, Radfahrer, Lärm und Hunde. Dabei stellte Wyttenbach fest, dass sich die Wahrnehmung der Störfaktoren Mountainbiker, Lärm und Hunde bei den Wanderern signifikant zwischen den verschiedenen Befragungsstandorten mit unterschiedlicher Wegbeschaffenheit unterscheidet. Andere Wanderer oder Jogger wurden zwischen den Befragungsstandorten nicht unterschiedlich beurteilt und höchst selten als Störfaktor wahrgenommen.
In einer Untersuchung in Neuseeland auf einem von Bikern und Wanderern benutzten Weg beobachtete Cessford (2003), dass Wanderer die Biker durchaus positiv wahrnehmen und das Zusammentreffen mit Bikern sich nicht negativ auf die Zufriedenheit der Wanderer auswirkte. Einzig die älteren Personen, die keine Mountainbiker antrafen, beurteilten die Präsenz von Bikern negativer.
So ist man auch der Schweiz bestrebt, wo möglich eine Ko-Existenz zwischen Wanderern und Mountainbikern zu belassen und nur an gewissen Stellen eine räumliche Trennung vorzunehmen (van Rooijen, 2009, Schweizer Wanderwege et al., 2010). Diese Ko-Existenz sollte mit den entsprechenden Verhaltensregeln erreicht werden, wie es die verschiedenen Vereinigungen im Bereich Wandern und Mountainbiking gemeinsam vertreten und kommunizieren (Brügger, 2006, Schweizer Wanderwege et al., 2010).
2.4.4 Präferenzen von Wanderern und Bergwanderern
2.4.4.1 Tourenpräferenzen
Lamprecht et al. (2009) erkundeten die Bedeutung diverser Toureigenschaften für Wanderer. Dabei zeigte sich, dass die durchschnittliche Tourendauer ca. 3,9 Stunden beträgt und praktisch in allen Wandergebieten ähnlich ist, mit Ausnahme des Hüttenwanderns im Tessin, wo die durchschnittliche Wanderung 4,9 Stunden dauert. Insbesondere in abgelegeneren Gebieten sind die Wanderungen länger. Boller (2007) fand bei seiner Befragung, dass die überwiegende Mehrheit der Bergwanderer im Kanton Tessin mehr als 4 Stunden unterwegs ist, in einem bestimmten Tal sogar länger als 6 Stunden. Eine Tendenz zu längeren Wanderungen im Gebirge bestätigten auch Muhar et al. (2006). In ihrer Befragung im österreichischen Alpenraum in Berghütten (n=1 189) dauerten 47,6 % der Touren zwischen 4 und 6 Stunden, 25,9 % waren kürzer und 26,5 % dauerten 7 Stunden und länger.
In der Profilstudie Wandern 2008 in Deutschland (Brämer, 2008b) gaben 32 % eine Tourdauer von weniger als 3 Stunden an, 42 % bevorzugen Wanderungen zwischen 3 und 5 Stunden und 26 % bevorzugten Touren von 6 Stunden und länger. Mehrtagestouren waren von untergeordneter Bedeutung. Die mittlere Tourenlänge gab Brämer (2008a) mit ca. 15 km an.
Brämer (2013b) stellt hingegen in Deutschland auch einen Trend zu kürzeren Wanderungen fest und nennt diese Gruppe Spazierwanderer. Diese Gruppe umfasst gemäss Brämer mit 63 % der Deutschen Wanderer eine relativ grosse Gruppe, die sich Wanderangebote zwischen 3 und 7 Kilometern Länge wünscht. Solche kürzeren Wanderungen mit Mittelwerten zwischen 5,6 km und 6,5 km für verschiedene Typen bestimmten auch van Marwijk (2009) mit GPS-Tracks im agglomerationsnahen Nationalpark Dwingelderveld in den Niederlanden. Im österreichischen Nationalpark Donau-Auen, Lobau wurde eine mittlere Tourlänge von 7 km von Taczanowska (2009) festgestellt. Diese Wanderungen sind aber nur bedingt mit den oben genannten Wanderungen vergleichbar, da es sich bei diesen Untersuchungen um Studien in Agglomerationsnähe handelte.
Zwischen den Vorlieben der Einheimischen und den Gästen können relativ grosse Differenzen bestehen. So haben die Einheimischen vermehrt das Bedürfnis, Gipfel zu besteigen, während die Gäste eher Touren im unteren und mittleren Höhenbereich der Alpen bevorzugen (Brämer, 2005, Brämer, 2013a).
Von den Tourentypen her bevorzugen die meisten Personen in Deutschland Rundwanderungen (Brämer, 2008b). Sofern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wieder an den Ausgangspunkt gelangt werden kann, sind auch Streckenwanderungen beliebt (Brämer, 2009).
Zu Präferenzen für Höhenmeter finden sich in der Literatur keine Angaben. Deshalb wird hier auf die Auswertung der 53 am qualitativ besten beschriebenen Wander- und Bergtouren (9 und 10 Punkte, max. 10) in den Kantonen Graubünden und St. Gallen zurückgegriffen. Eine mittlere Tour weist hier eine Länge von 16 km und eine Höhendifferenz von 1 002 m auf (GPS-Tour.info, 2013)13.
2.4.4.2 Wegpräferenzen
In der Schweiz werden offiziell drei verschiedene Wanderwegtypen verwendet und beschildert. Die gelb markierten Wanderwege sind meist flach angelegt und bieten keine besonderen Schwierigkeiten. Die weiss-rot-weiss markierten Bergwanderwege sind überwiegend steil, schmal und teilweise exponiert. Die Alpinwanderwege (weiss-blau-weiss) sind anspruchsvoll und führen teilweise auch über wegloses Gelände mit kurzen Kletterstellen (Hadorn, 2013).
Von den Wanderern in der Schweiz werden die rot-weiss markierten Bergwanderwege (84 %) und die gelben Wanderwege (81,4 %) am häufigsten benutzt14. Immerhin benutzten 23,6 % auch Alpinwanderwege und 15,6 % waren auch auf nicht markierten Wegen unterwegs. Es konnten kaum regionale Unterschiede beobachtet werden (Lamprecht et al., 2009).
Die wichtigsten Eigenschaften des Wanderwegnetzes für die Wanderer in der Schweiz sind abwechslungsreiche, einheitlich beschilderte und gut unterhaltene Wege (über 80 % der Befragten). Weniger als 30 % der Befragten nannten keine übermässigen Höhenunterschiede, Feuerstellen oder breite Wege. Im Mittelfeld rangierten Eigenschaften bezüglich Rastmöglichkeiten (Restaurants, Sitzbänke) oder der Verkehrsanbindung (öffentlicher Verkehr, Auto, Bergbahn) (Lamprecht et al., 2009).
Die Wanderer in der Schweiz sind im Allgemeinen mit dem Zustand des Wanderwegnetzes sehr zufrieden. Nur bei wenigen Eigenschaften (Zeitangaben, Informationstafeln, Sitzbänke und Feuerstellen) erreichte der Anteil der Zufriedenheit (sehr zufrieden und zufrieden) weniger als 75 % (Lamprecht et al., 2009).
2.4.5 Erwartete weitere Entwicklung
Wandern zählt in der Schweiz, Europa aber auch in Nordamerika zu den am meisten betriebenen Outdoorsportarten (Lamprecht und Stamm, 2000, Cordell, 2008, Lamprecht et al., 2008a, Vogt, 2009). Nach Vogt (2009) wäre es aber vermessen, von einem Hype zu sprechen, welcher eher in den Medien als in der Natur stattfinde.
Das Wandern befindet sich heute in einem Umbruch und profitiert dabei von den neueren Sportarten wie Nordic Walking, um das bisweilen etwas altmodische Image zu verlieren und weiterhin im Trend zu bleiben (Frick et al., 2010). Dichter (2004) prognostizierte Verschiebungen im Bereich der Motive. Nach seiner Einschätzung der Wanderwünsche werde in der Schweiz das Geselligkeitsmotiv an Bedeutung verlieren und die anderen Motive Wellness, Gesundheit und Herausforderungen an Bedeutung gewinnen; für Deutschland erwartete er ähnliche Verschiebungen, wenn auch in etwas geringerem Ausmass. Brämer (2013b) bestätigte einen Trend hin zu Kurzwanderungen.
Mit verschiedenen Werbekampagnen sollte in den letzten Jahren das Wandern und Bergwandern weiter gefördert werden. Im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung werden die schneeunabhängigen, naturorientierten Outdoorsportarten weiter an Bedeutung gewinnen; vor allem weil die schneefreien Gebiete zu- und die Schneebedeckungszeiten der Landschaft abnehmen. Heissere Sommer werden als Chance für die kühlen Bergregionen angesehen, welche sich auch zunehmend in dieser Thematik positionieren (Doebeli, 2003, Dichter Ernest, 2004, Kappler, 2004b, Kappler, 2004a, Frick et al., 2010, Kappler, 2011, Abegg et al., 2013). Wirth (2010) stellte fest, dass der Klimawandel mit kühlerem Bergsommer gegenüber den wärmeren Städten eine zusätzliche Anziehung der Berggebiete ausüben werde.
Die Klimaerwärmung bietet für das Wandern in Bergregionen jedoch nicht nur positive Aspekte. Instabile Hänge als Folge des auftauenden Permafrosts und Starkregen (statt Schneefälle) verursachen Erosion, Hangrutschungen, Steinschlag usw. Diese neuen Gegebenheiten stellen sowohl die Verantwortlichen für die Wanderwege als auch die Wanderer selbst vor Herausforderungen (Ritter et al., 2012, Abegg et al., 2013). Letztere könnten durch die neuen Umstände auch verängstigt werden und als Folge neue Destinationen aufsuchen (Pröbstl et al., 2011) oder ihre Wanderaktivitäten in andere Jahreszeiten verlegen (Hawkins und Smith, 2011).
2.5 Mountainbiking
2.5.1 Bedeutung des Mountainbikings
Mountainbiking ist eine recht junge Sportart, welche Mitte der 1970er-Jahre in Kalifornien von Radsportlern lanciert wurde. Im Jahr 1996 war diese Sportart bereits olympisch und avancierte zu einer der beliebtesten Outdoor-Sportarten (Penning, 1998).
In der Schweiz nennen – gemäss den grossen Sportstudien von 2008 und 2014 (Lamprecht et al., 2008c, Lamprecht et al., 2014) – etwas mehr als 6 % der Schweizer Wohnbevölkerung zwischen 15 und 74 Jahren Mountainbiking als eine von ihnen betriebene Sportart. Gemäss Gilomen (2005) stiegen die Verkaufszahlen der Mountainbikes in der Schweiz stetig bis 1997. Anschliessend hat sich der Fahrradmarkt weiter differenziert (z.B. durch E-Bikes), aber das Mountainbike hat immer noch eine herausragende Stellung, insbesondere im Bereich der Sportfahrräder. Die Zahl der verkauften Mountainbikes variierte von 2006 bis 2012 zwischen ca. 125 000 und 142 000, was einem Marktanteil zwischen 36 % und 46 % entsprach (velosuisse, 2013). Der Marktanteil scheint sich zu stabilisieren. Nach Huber (2013) beläuft sich allein der direkte Umsatz in der Radsportbranche für Mountainbikes, Bekleidung und Zubehör auf ca. 450 Mio. Franken jährlich und macht damit ca. die Hälfte des Umsatzes der Fahrradbranche aus. Die Popularität des Mountainbike-Sports zeigt sich auch in der Entwicklung der Anzahl Mountainbike-Experten15 in der Schweiz, welche stark anstieg.
Der Sportart und ihrem regionalwirtschaftlichen Effekt werden in Bergregionen, aber auch in Agglomerationsnähe, eine grosse Bedeutung zugemessen (Fachstelle Langsamverkehr, 2010, Wadenpohl und Kenny, 2011). Einige bekannte Schweizer Tourismusregionen haben in den letzten Jahren Masterpläne zur ihrer Positionierung als Mountainbike-Destination verfasst, so beispielsweise Engadin/St. Moritz (Cazin, o.J.), Lenzerheide Vaz/Obervaz (Wirth, 2012) sowie die Jungfrau-Region (Weiler, 2012) u.a.
Eine hohe Popularität des Mountainbikings ist auch auf internationaler Ebene zu beobachten, beispielsweise in Nordamerika (Cordell, 2008), Australien (Davies und Newsome, 2009), Deutschland (Heinemann, 2010) oder Österreich, speziell im Bundesland Tirol (Kornexl und Brunner, 2009).
2.5.2 Bedürfnisse und Gewohnheiten der Mountainbiker
Mountainbiker sind nicht gleich Mountainbiker – seit der Lancierung des Mountainbikings hat sich die Zahl der Sporttreibenden stark erhöht und die Sportart hat sich in diverse Untergruppen spezialisiert, was durch technische Innovationen gefördert wurde.
Manche Autoren kategorisierten nach Motiven und Bedürfnissen. So unterschied Wöhrstein (1998) Typen wie Feierabend- und Wochenendfahrer, Sportliche Feierabend- und Wochenendfahrer, Trainingstyp und Modetyp – allerdings einleitend und nicht auf der Basis empirischer Daten. Kornexl und Brunner (2009) entwickelten für Crosscountry-Mountainbiker sechs Motivklassen mittel einer Clusteranalyse: Sportliche (25 %), Gemeinschaftsfahrer ohne Selbstbestätigung (26 %), Ängstliche (20 %), Fitnessorientierte (12 %), Gruppenorientierte mit Selbstbestätigung (9 %) und Naturorientierte (9 %). Heinemann (2010) verwendete die Kategorien Action- und Funbiker, Sport- und Naturbiker sowie Ruhe- und Erholungsbiker. Cessford (1995b) unterteilte die Biker bezüglich derer Erfahrung in: Anfänger, Mittelerfahrene, Biker mit grosser Erfahrung sowie Experten.
Einen anderen Ansatz zur Typisierung verfolgten Morey et al. (2002), indem sie aus der Analyse eines Tour-Choice-Experimentes vier Mountainbiker-Typen identifizierten und beschrieben: Gelegenheitsfahrradfahrer (casual cyclists), Seriöse Mountainbiker, Strassenfahrer sowie Wochenend-Mountainbiker.
Die meisten Autoren folgten jedoch einer Kategorisierung, die stark in der Art der Gerätenutzung und der technischen Ausstattung begründet ist. Bei den Studien konnten sich die Befragten selber den verschiedenen Typen zuordnen. So spricht man hauptsächlich von folgenden Disziplinen (Hofer, 2003, Gilomen, 2005, Davies und Newsome, 2009, Deutsche Initiative Mountainbike e.V., 2010):
- Cross Country / Allmountain (z.T. Wettkämpfe)
- Touren-Biking (Freizeitbiker)
- Race/Marathon
- Freeride
- Downhill
- Dirt
- (Street-) Trial
Für diese Disziplinen wurden verschiedene Bikes entwickelt, sie unterscheiden sich in Gewicht (z.B. Carbon für leichte Bikes), Federung (Front-Federung, Full-suspension, verschiedene Federweglängen), Komfort (Rahmengeometrie), Übersetzungen und anderen Aspekten.
Die grösste Verbreitung finden Cross-Country-Biking und Tourenbiking. Die Schätzungen der Marktanteile liegen zwischen 25 % und 55 % für Cross-Country-Biking (Hofer, 2003, Gilomen, 2005, Deutsche Initiative Mountainbike e.V., 2010) und zwischen 50 % und 77,2 % beim Tourenbiking (Hofer, 2003, Gilomen, 2005, Deutsche Initiative Mountainbike e.V., 2010), abhängig von der jeweils gewählten Definition der Kategorie.
Die Anforderungen an die Weg-Infrastruktur unterscheiden sich deutlich zwischen den Bike- Disziplinen. Die nachfolgenden Präferenzen betreffen die grössten Gruppen, welche vorwiegend das bestehende Fuss- und Wanderwegnetz nutzen: Touren- und Cross-Country- Biker, in geringerem Masse noch die Freerider (Hofer, 2003). Im Weiteren werden unter dem Begriff Mountainbiking die Disziplinen Touren- und Cross-Country-Biking verstanden, Ausnahmen werden erwähnt.
Die Motive für den Mountainbike-Sport aus verschiedenen Untersuchungen sind in Tabelle 2.7 dargestellt. In allen Untersuchungen wird das Motiv Landschaft/Natur als sehr wichtig beurteilt. Ähnlich wichtig werden die Motive Fitness, Kondition sowie Ausgleich vom Alltag, Entspannung beurteilt. Nur in der grossen Studie in Deutschland der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB, 2010) wird das Motiv Abenteuer, Risiko prioritär bewertet.
Die meisten Biker betreiben ihren Sport individuell und sind nicht in Verbänden oder Vereinen organisiert (Froitzheim und Spittler, 1997). Im Weiteren nimmt die Beteiligung an Wettkämpfen mit zunehmendem Alter ab (Gilomen, 2005).
Tabelle 2.7: Mountainbike-Motive verschiedener Untersuchungen
| Motiv | Gilomen (2005), (n=2 255) | DIMB (2010), (n=9 000) | Kornexl und Brunner (2009), (n=547) | Beier (2001),(n=75, mean zw. 1 und 5)16 |
| Spass haben | 89,1 % | -17 | - | - |
| Landschaft, Natur | 88,0 % | 79 % | 94,9 % | 4,24 |
| Fitness, Kondition | 84,3 % | 40 % | 94,7 % | 4,49 |
| Gesundheit | 66,3 % | 64 % | - | 3,91 |
| Gemeinschafts-erlebnis | 34,9 % | 64 % | 77,0 % | 3,86 |
| Abenteuer, Risiko | 33,9 % | 73 % | - | 2,96 |
| Ausgleich vom Alltag, Entspannung | - | 80 % | 88,1 % | 4,04 |
| Selbstbestätigung | - | - | 72,9 % | 3,7918 |
| Gewicht, Figur | - | - | 77,1 % | 3,70 |
| Andere | 5,7 % | 3 % | - | - |
2.5.3 Auswirkungen des Mountainbikings
2.5.3.1 Beeinträchtigungen des Naturhaushalts
Entsprechend der Ausführungen in Kapitel 2.2.3.1 werden in dieser Arbeit die Beeinträchtigungen des Mountainbikings auf die Natur sowie die Konflikte zwischen Mountainbikern und anderen Outdoorsportlern (vgl. Kapitel 2.5.3.2) differenziert beleuchtet.
Die Beeinträchtigungen der Natur durch das Mountainbiking sind in Tabelle 2.8 dargestellt.
Tabelle 2.8: Direkte und indirekte Beeinträchtigungen der Natur und Infrastrukturen durch Mountainbiking

Wie verschiedene Autoren feststellten, sind entgegen der vorherrschenden Meinung die von Mountainbikem verursachten Beeinträchtigungen ähnlich denjenigen von Wanderern und Reitern einzustufen und nicht grösser – dies gilt auch für Schäden an Wegen (Wilson und Seney, 1994, Cessford, 1995a, Gander und Ingold, 1997, Wöhrstein, 1998, Thurston und Reader, 2001). Marion und Wimpey (2007) gingen sogar eher davon aus, dass Mountainbiking geringere Schäden an Wegen verursacht als Wandern. Bei intensiver Befahrung, resp. Begehung von Grasland stellten Pickering et al. (2011) das Gegenteil fest.
Ingold (2005) hingegen sprach dem Mountainbiking ein grosses Beeinträchtigungspotenzial für Wildtiere zu, dies als Folge des Querfeldeinfahrens (vgl. auch Taylor und Knight, 2003), hoher Geschwindigkeit und dem hohen Überraschungsmoment aufgrund der geräuscharmen Annäherung sowie durch die längere tageszeitliche Raumbeanspruchung (Reimoser et al., 2008). Allerdings werde das Off-trail Biking, resp. Querfeldeinfahren nur selten ausgeübt (Froitzheim und Spittler, 1997, Gilomen, 2005). Reimoser et al. (2008) kamen bei ihrer Studie im Wienerwald zu einem anderen Ergebnis. So gaben 67 % der Befragten Mountainbiker an, den Weg regelmässig zu verlassen (zum Vergleich: Jogger 67 %, Wanderer 50 % und Reiter 37 %). Als Hauptgrund für das Verlassen der offiziellen Bikewege im Wienerwald gaben die Biker an, mit dem Wegnetz nicht zufrieden zu sein und dies nicht hinnehmen zu wollen.19
Wilson und Seney (1994) führten verschiedenste Feldversuche zu Wegbeschädigungen von Outdoorsportarten durch. Sie stellten fest, dass das meiste Wegbelagsmaterial durch Reiter und durch Wanderer gelöst wurde, speziell betraf dies das Bergabgehen, resp. -reiten (Weaver und Dale, 1978, zitiert nach: Cessford, 2003)
Zusammengefasst sind die Beeinträchtigungen der Natur durch die beiden Sportarten Mountainbiking und Wandern jedoch vergleichbar (Pickering et al., 2011).
2.5.3.2 Konflikte zwischen Mountainbikern und anderen Outdoorsportlern
Einige Ursachen, wie Mountainbiker bei anderen Outdoorsportlern Konflikte auslösen können sind in Tabelle 2.9 zusammengestellt. Bei den Konflikten zwischen Mountainbikern und Wanderern spielt die Wahrnehmung eine grosse Rolle. So zeigten Wanderer, die keine Mountainbiker angetroffen haben, eine grössere negative Wahrnehmung der Mountainbiker als solche, die Mountainbikern begegnet sind. Speziell negative Gefühle hatten dabei die älteren Wanderer (Cessford, 2003). Aber generell bezeichneten über 85 % der Mountainbiker den Umgang mit anderen Naturnutzern als freundlich oder überwiegend freundlich (Deutsche Initiative Mountainbike e.V., 2010).
Die meisten Unfälle der Mountainbiker werden selbst verursacht und ohne Beteiligung von anderen Personen. Nur gerade 1,3 % der über 9 000 Befragten hatten eine Kollision mit einem Fussgänger, wobei 71 % der Unfallgegner nicht verletzt wurden (Deutsche Initiative Mountainbike e.V., 2010). Cessford (2003) bestätigte die Seltenheit solcher Ereignisse.
Tabelle 2.9: Durch Mountainbiker verursachte Konflikte mit anderen Outdoorsportlern
| Konfliktursache | Wandern, Joggen, Nordic Walking | Reiten | Jagen, Natur beobachten |
| Neuer Naturnutzer im selben Raum | Thurston und Reader (2001)Froitzheim und Spittler (1997)Chavez (1996)Lorch (1995)Moore (1994) | ||
| Kleidung, insb. Schutzkleidung | Froitzheim und Spittler (1997)Lorch (1995)Keller (1990) | ||
| Geschwindigkeitsdifferenz | Cessford (2003)Froitzheim und Spittler (1997)Chavez (1996) | ||
| Erschrecken durch plötzliches Auftauchen | Cessford (2003)Froitzheim und Spittler (1997) | Keller (1990) | |
| Kollision oder Beinahe-Kollision | Deutsche Initiative Mountainbike (2010)Davies und Newsome (2009)Chavez (1996) | ||
| Zielkonflikt | Freuler (2008)Schemel und Erbguth (2000)Lorch (1995) | ||
| Gefühl der Bikerpräsenz | Cessford (2003) | ||
| Andere soziale Gruppe / Lifestyle | Cessford (2003) | ||
| Rücksichtslosigkeit | Heer et al. (2003) |
Um die Konflikte zwischen den verschiedenen Outdoorsport-Aktivitäten zu lösen, schlagen Parkmanager folgende Massnahmen vor (Chavez, 1996): Information/Schulung (63 %), Kooperation (27 %), Einschränkungen (17 %) und Infrastrukturanpassungen (7 %). Zeitliche Einschränkungen und Wegegebot sind beispielsweise im Biosphärenpark Wienerwald in Kraft (Reimoser et al., 2008).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.