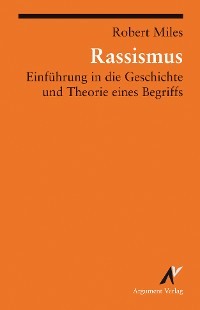Kitabı oku: «Rassismus», sayfa 4
Wie wir bereits sahen, hat der europäische Diskurs seit den frühesten Begegnungen zwischen Europäern und Afrikanern sich auf deren Hautfarbe und Nacktheit als Zeichen der Differenz bezogen. Desgleichen wurden die Afrikaner, da sie keine Christen waren, als »Heiden« dargestellt (vgl. Jordan 1968: 20f.). Auf diese Weise spiegelte der europäische Diskurs das wider, was der Afrikaner nicht war, um dadurch die Differenz zu bestätigen. Die ihn definierende Differenz lag auf der physischen und der kulturellen Ebene (Curtin 1965: 30). Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert und danach, d. h. in einem Zeitraum, als die Europäer und vor allem die Briten den Afrikaner als Sklaven kannten, wurden ihm eine Anzahl weiterer Charakterzüge zugeschrieben (Fryer 1984: 155, Walvin 1986: 80ff.).
Erstens wurde der afrikanische Mensch als mit einer potenten Sexualität ausgestattet dargestellt. Afrikanische Frauen galten als überaus sexbesessen, während den Männern ein ungewöhnlich großer Penis und eine kraftstrotzende Männlichkeit nachgesagt wurden (Jordan 1968: 151, 158f., Fryer 1984: 140, 159). Zweitens wurde dem Afrikaner – vor dem Hintergrund zeitlich früherer Darstellungsformen von Wildheit und Monstrosität – ein bestialischer Charakter zugeschrieben, und es wurde viel über den Ursprung und die Folgen der unterstellten körperlichen Ähnlichkeiten zwischen Afrikanern und Affen spekuliert, waren doch beide zur selben Zeit in einem beiden gemeinsamen geographischen Raum von den Europäern »entdeckt« worden. Bisweilen wurde gar gemutmaßt, dass es zwischen Afrikanern und Affen zum Geschlechtsverkehr komme (Jordan 1968: 28-32, 238, Fryer 1984: 138). Drittens sollte der afrikanische Charakter in besonderer Weise aus positiven und negativen Eigenschaften bestehen. Einerseits galten die Afrikaner als faul, abergläubisch, wild und feige, andererseits als höflich, edel und voller Achtung älteren Personen gegenüber (Curtin 1965: 222ff., Barker 1978: 104). Viertens wurde der alte Vorwurf des Kannibalismus während des ganzen Zeitraums vom sechzehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert noch verstärkt (Barker 1978: 129).
Durch diese Betonung physischer und animalischer Charakterzüge (jedoch kombiniert mit bestimmten kulturellen Eigenschaften) wurde der Afrikaner als ein Mensch definiert, der im Stande der Wildheit lebt und von daher auf der (europäischen) Skala des menschlichen Fortschritts weit unter dem Europäer rangiert (Curtin 1965: 63ff., Walvin 1986: 77). Da, mit anderen Worten, der Afrikaner angeblich eher wie ein wildes Tier aussah und sein Verhalten sich dem der wilden Tiere annäherte, war er weniger zivilisiert, ein Barbar (Jordan 1968: 24f., 97). Die Meinung in Europa tendierte überwiegend dahin, diesen Zustand der Barbarei und Wildheit negativ zu bewerten, doch war er für eine wichtige Minderheit namentlich im achtzehnten Jahrhundert Zeichen einer moralischen Überlegenheit, weil die Lebensweise des Afrikaners aufgrund seiner größeren Nähe zur Natur als natürlicher galt (Curtin 1965: 48ff., Fryer 1984: 145). Hier wird der Diskurs vom edlen Wilden wieder aufgenommen.
Zweifellos war der Afrikaner in den Augen der europäischen Menschen anders geartet. Aber reichte die Differenz aus, um ihn als nicht-menschlich bezeichnen zu können? Und wie war die Differenz zu erklären? Was das Erstere anlangt, so wurde vor dem späten achtzehnten Jahrhundert nur selten die Behauptung aufgestellt, die Afrikaner seien nicht eigentlich zu den Menschen zu rechnen. Obwohl sie als bestialisch und wild galten, zog der europäische Diskurs auch die Existenz anderer Eigenschaften – wie etwa der Sprache – in Betracht, die als Attribute des Allgemein-Menschlichen angesehen wurden (Curtin 1965: 35, Barker 1978: 47ff.) Gestützt wurde dies durch die zentrale Rolle des Christentums im europäischen Denken, und hier insbesondere durch die biblische Erklärung für die Erschaffung der Menschheit und ihre Anwesenheit auf der Erde (Barker 1978: 88). Im ganzen achtzehnten Jahrhundert diente die Vorstellung von der »Großen Kette der Wesen« (The Great Chain of Being, vgl. Lovejoy 1936) dazu, Natur und Gesellschaft zu ordnen. Diese Vorstellung ging im Wesentlichen davon aus, dass Gott alle lebenden Dinge geschaffen und in eine hierarchische Ordnung gefügt habe. In dieser Hierarchie nahmen die Menschen einen höheren Rang ein als die Tiere, und in dieser Hinsicht waren die (von Gott ebenfalls als Menschen geschaffenen) Afrikaner den Europäern gleichgestellt. Doch erlaubte es die mit der »Großen Kette« vermachte Vorstellung von einer Hierarchie, den verschiedenen vom europäischen Denken identifizierten Menschengruppen einen je unterschiedlichen Rang zuzuweisen. Folgerichtig war der afrikanische Mensch nicht nur vom europäischen verschieden, sondern diesem auch dem Range nach untergeordnet.
Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert bezog sich die vorherrschende Erklärung für das Anderssein des Afrikaners zumeist auf milieutheoretische Argumente (Barker 1978: 79), die ihrerseits eine lange Geschichte besaßen. Die physische Erscheinung des Afrikaners und besonders seine Hautfarbe nahm als Zeichen der Differenz an Bedeutung zu (Jordan 1968: 216f., 512) und damit auch die Diskussion um Ursprung und Zweck seines Daseins. Der christliche Glaube an einen allen Menschen gemeinsamen Ursprung lief auf die Annahme hinaus, die Afrikaner hätten ihre Hautfarbe erst nach der Erschaffung des Menschengeschlechts angenommen. Aber im späten achtzehnten Jahrhundert hielt man es nicht mehr für befriedigend, die schwarze Hautfarbe auf den Fluch Gottes zurückzuführen und ging mehr und mehr dazu über, dem Klima eine Schlüsselrolle zuzuweisen (ebd.: 525). Insbesondere nahm man an, dass die Sonne in tropischen Regionen die Haut verbrenne oder, zum Schutz gegen die Hitze, ihre farbliche Veränderung bewirke. Darüber hinaus wurde hier und da vermutet, dass nach dem abgeschlossenen Prozess dieser Veränderung die Schwärze der Haut eine vererbbare Eigenschaft geworden sei (Curtin 1965: 40f., Jordan 1968: 11, Barker 1978: 85).
Aber nicht nur für phänotypische, sondern auch für kulturelle Eigenschaften der Afrikaner sollte das Klima eine determinierende Kraft besitzen. So wurde auch die ihnen unterstellte Faulheit durch Verweis auf die Sonnenhitze erklärt. Jedoch war das Klima nicht der einzige Milieufaktor, der in Erwägung gezogen wurde. 1787 veröffentlichte der amerikanische Gelehrte Samuel Stanhope Smith einen Essay, in dem er das Argument vertrat, die menschliche Gattung sei in einer »zivilisierten« Form in Asien entstanden, wobei spätere Migrationsbewegungen eine »Entartung« zur Wildheit und stufenweise Veränderungen der körperlichen Erscheinung nach sich gezogen hätten. Als Ursachen für diese Veränderungen nannte Smith das Klima, den Zustand der Gesellschaft, und die Lebensgewohnheiten, wobei er den beiden letzten Faktoren ein erhebliches Gewicht beimaß. Dieses milieutheoretische Argument beherrschte den euroamerikanischen Diskurs des späten achtzehnten Jahrhunderts (Jordan 1968: 487, 513ff., desgl. Popkin 1974: 139, Barker 1978: 52, 79).
Milieutheoretische Argumente ließen die Schlussfolgerung zu, dass die den Afrikanern zugeschriebenen Charakterzüge im Prinzip veränderbar waren. Waren sie auch Wilde, so stellte dies doch eine der Verbesserung fähige menschliche Daseinsweise dar (Barker 1978: 99, desgl. Curtin 1965: 66). So war zum Beispiel Stanhope Smith der Ansicht, dass in Amerika beheimatete Afrikaner sich eher unterrichten ließen und dass auch ihre körperliche Erscheinung sich verändern würde (Jordan 1968: 515f.). Von daher unterstützte die Milieutheorie Strategien, mittels derer der Afrikaner »zivilisiert« werden sollte: Heidentum und Wildheit waren die Folge von Umständen, die durch äußere Eingriffe – zum Beispiel missionarische Tätigkeit und die Einrichtung von Plantagen – verändert werden konnten (vgl. etwa Curtin 1965: 123-39, 259-86). Die Idee der »zivilisatorischen Mission« war während der kolonialen Ausdehnung Europas im neunzehnten Jahrhundert, insbesondere was Afrika betrifft, von erheblicher Bedeutung (Kiernan 1972: 24).
Die Vorherrschaft dieses Diskurses über afrikanische Charaktereigenschaften und ihre Determinanten wirkte sich auf die ökonomische Rolle aus, die viele Afrikaner in Nord- und Südamerika zu übernehmen gezwungen waren. Die unter Bedingungen der Sklaverei stattfindende Aneignung und Ausbeutung afrikanischer Arbeitskraft wurde zum einen durch die Behauptung gerechtfertigt, dass Afrikaner im Gegensatz zu Europäern für die Arbeit in tropischen Klimaverhältnissen besonders geeignet seien (Curtin 1961: 104, 1965: 116, Barker 1978: 61). Zwar besagte die Logik der Milieutheorie, dass diese Fähigkeit erworben werden könne, doch schienen die Europäer wenig geneigt, solche Hypothesen auch auf sich selbst anzuwenden. Von daher war die Milieutheorie als Erklärung für die angenommenen Unterschiede zwischen europäischen und afrikanischen Menschen hinsichtlich ihrer Konsistenz von einer gewissen Zweideutigkeit gekennzeichnet, die mit der Entstehung des »Rassen«-Diskurses im neunzehnten Jahrhundert teilweise eliminiert wurde. Zum anderen wurde die Sklavenarbeit mit dem Argument gerechtfertigt, dass die Afrikaner dem Stande der Wildheit entrinnen könnten, wenn sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellten. Der Eintritt in die Sklaverei bot ihnen also die Möglichkeit, auf der Straße des »Fortschritts« einen Schritt in Richtung »Zivilisation« zu tun, wodurch sie zunächst in eine Situation gebracht wurden, die sie mit den Armen in Europa vergleichbar machte (Kiernan 1972: 242, Barker 1978: 68, 151f., 160, 198, vgl. auch Kap. 4).
Zusammenfassend können wir sagen, dass bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts die vorherrschenden europäischen Darstellungsformen des afrikanischen Menschen explizit oder implizit einräumten, dass die Unterschiede, die an ihm sich ablesen ließen, keine stabilen und ein für alle Mal festgelegten Eigenschaften bezeichneten. Demgemäß wurde auch die Sklavenarbeit nur selten mit biologischen Argumenten gerechtfertigt, die im späten achtzehnten Jahrhundert ohnehin noch von sekundärer Bedeutung sind (Barker 1978: 52, vgl. aber Walvin 1986: 73-79). Wiewohl nun die vorherrschende Ansicht dahin ging, dass der Afrikaner ein menschliches Wesen, ein Teil von Gottes Schöpfung sei und milieubedingte Charakterzüge trage, galt er dennoch als menschliches Wesen minderen Ranges. Die Darstellung des Afrikaners als des Anderen bezeichnete phänotypische und kulturelle Eigenschaften als Beweis für diese Minderwertigkeit, und die den Afrikanern zugeschriebene Daseinsweise bildete dergestalt einen Maßstab für die europäische Fortschrittlichkeit und Zivilisation. Das Gefühl für die Andersartigkeit des Afrikaners wurde in zunehmendem Maße mit der Hautfarbe verknüpft (Curtin 1965: 39, Jordan 1968: 7) und durch die Zuweisung einer Reihe anderer negativ bewerteter Eigenschaften festgeschrieben.
Die Bedeutung der Wissenschaft
In der Geschichtswissenschaft besteht weitgehende Übereinstimmung darin, dass die Säkularisierung der Kultur wie auch das Wachstum (und die zunehmende Hegemonie) der Wissenschaft zu einer tief greifenden Umwandlung der europäischen Darstellungsformen des Anderen führte. Diese Entwicklungen verbanden sich mit der Entstehung der »Rassen«-Idee im europäischen Denken, die von der wissenschaftlichen Forschung aufgenommen und in zunehmendem Maße mit einer begrenzten und präzisen Bedeutung versehen wurde. Dieser Prozess begann im späten achtzehnten Jahrhundert. Im Ergebnis wurde die in den europäischen Darstellungsformen des Anderen verkörperte Differenz als Unterschied von »Rassen« interpretiert, d. h. als eine in erster Linie biologische und naturgebundene Differenz, die angeboren und unveränderlich war und die darüber hinaus als wissenschaftliche (also objektive) Tatsache hingestellt wurde. Obwohl dieser »Rassen«-Diskurs das Produkt »wissenschaftlicher« Tätigkeit war, verbreitete er sich im neunzehnten Jahrhundert in ganz Europa, in Nordamerika und in den europäischen Kolonien. Er wurde, unter anderem, ein Bestandteil des Alltagsdiskurses auf allen Ebenen der Klassenstruktur und eine grundlegende Komponente imperialistischer Ideologien (vgl. etwa Biddiss 1979b, MacKenzie 1984).
Die genauere zeitliche Einordnung dieser Transformation von Darstellungsformen ist allerdings umstritten. So behauptet Fryer (1984: 134) etwa, dass diese pseudowissenschaftliche Ideologie als oraler Diskurs im siebzehnten Jahrhundert entstand und sich im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts in schriftlicher Form niederschlug. Dabei legt er viel Gewicht auf die Schriften von Edward Long, dessen History of Jamaica 1774 veröffentlicht wurde. Baker zufolge richtete sich das Buch gegen den damals herrschenden Zeitgeist, denn die »Rassen«-Idee, wie Long sie propagierte, wurde während der Epoche des Sklavenhandels nur selten verwendet (Barker 1978: 42, 52, 164). Jordan (1968: 352) ist der Ansicht, dass die milieutheoretische Erklärungsweise des Anderen im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts an Popularität einbüßte, während Curtin (1965: 29) davon ausgeht, dass die »Rassen«-Idee samt ihrer Begründung durch die Wissenschaft ihre Vorherrschaft nicht vor 1840 erlangte. Für unsere Zwecke ist die Tatsache, dass die Transformation stattfand, wichtiger als der genaue Zeitpunkt, zu dem sie vor sich ging.
Die »Rassen«-Idee entstand in der englischen Sprache im frühen sechzehnten Jahrhundert (Banton 1987: 1) und wurde anfänglich vor allem dazu verwendet, die europäische Geschichte und die Herausbildung von Nationen zu erklären. So wie die »Rassen«-Idee in der historischen Literatur auftaucht, bezieht sie sich auf jene unterschiedlichen Gruppen, die in ihrer Gesamtheit die Bevölkerung sich herausbildender Nationalstaaten wie England oder Frankreich ausmachen. Die ihnen dabei zugeschriebenen Eigenschaften wurden in der Folge zu nationalen Symbolen umgeformt. Von daher spielte der »Rassen«-Diskurs eine zentrale Rolle bei der Konstruktion nationaler Ursprungsmythen (Barzun 1938: 28-50, Poliakov 1974: 18), deren Bedeutung wir im dritten Kapitel nachgehen werden. So wurden etwa, was England betrifft, die Angelsachsen als eine »Rasse« definiert, die seit sehr früher Zeit einen wichtigen Teil der englischen Bevölkerung gebildet hätten, deren politische Überlegenheit aber durch die normannische Eroberung im Jahre 1066 stark zurückgegangen wäre. Demzufolge konnte der englische Bürgerkrieg Mitte des siebzehnten Jahrhunderts als Kampf der angelsächsischen »Rasse« um die Wiederherstellung ihrer freiheitlichen und demokratischen Traditionen gegen die Vorherrschaft einer normannischen Monarchie verstanden werden (Poliakov 1974: 37-53, Horsman 1981: 9-24, MacDougall 1982). In dieser Verwendung bedeutete »Rasse« so viel wie Abstammung oder gemeinsame Herkunft und identifizierte eine Bevölkerung mit ihrem Ursprung und ihrer Geschichte, ohne ihr indes einen festgelegten biologischen Charakter zuzuschreiben (Banton 1977: 16f., desgl. 1980: 24ff., 1987: 1-27, Guillaumin 1980: 46).
Als vom späten achtzehnten Jahrhundert an die Wissenschaft sich entwickelte und auf die Natur wie auch später im engeren Sinne auf die Gesellschaft angewendet wurde, nahm die »Rassen«-Idee eine neue Bedeutung an. »Rasse« bezog sich nun in zunehmendem Maße auf einen biologischen Menschentypus, und die Wissenschaft gab vor, nicht nur die Anzahl und jeweiligen Charakterzüge der Rassen, sondern auch eine hierarchische Beziehung zwischen ihnen nachweisen zu können. So wurde behauptet, dass alle Menschen und von daher jedes einzelne Individuum entweder einer »Rasse« angehörten oder das Produkt verschiedener »Rassen« seien und mithin die Charakterzüge jener »Rasse« oder »Rassen« trügen. Darüber hinaus glaubte die Wissenschaft nachweisen zu können, dass die biologischen Charakterzüge jeder »Rasse« Bestimmungsmomente einer ganzen Reihe psychologischer und sozialer Fähigkeiten jeder Gruppe darstellten, aufgrund derer sie in eine Rangordnung gebracht werden könnten.
So bezeichnete »Rasse« in ihrer extremsten Form eine Determinationsweise ökonomischer und kultureller Eigenschaften und Entwicklungen (vgl. Barzun 1938: 19ff., Banton 1977: 47). Ein solcher »Rassen«-Diskurs kann als Beispiel eines biologischen Determinismus beschrieben werden (vgl. Gould 1984: 20, Rose u. a. 1984: 3-15). In ihm wurde der Andere als eine biologisch distinkte Einheit, als eine »Rasse« für sich dargestellt, deren Fähigkeiten und Errungenschaften durch natürliche und unveränderliche Bedingungen, die der kollektiven Gemeinschaft insgesamt zukamen, festgelegt waren. Über die ideologische Karriere der »Rassen«-Idee gibt es mittlerweile eine umfangreiche Literatur (wie etwa Gossett 1965, Banton 1977, 1987, Stepan 1982), und ich möchte hier die Aufmerksamkeit nur auf jene Aspekte lenken, die für diesen allgemeinen Überblick über Darstellungsformen des Anderen und den folgenden Argumentationsgang wichtig sind.
Erstens führte die wissenschaftliche Behauptung der Existenz verschiedener biologisch konstituierter »Rassen« im Endeffekt zu einem Zusammenprall mit religiösen Epistemologien und Diskursen über Wesen und Entwicklung der Welt und des Menschengeschlechts. Wie wir sahen, ging die biblische Interpretation davon aus, dass die menschliche Gattung eine Schöpfung Gottes war und dass alle Menschen in Vergangenheit und Gegenwart von Adam und Eva abstammten, woraus sich letzten Endes die Homogenität der menschlichen Gattung herleitete. Eine Methode, um dieses Problem zu lösen, ohne die Legitimität der biblischen Erklärung in Frage zu stellen, bestand in der Behauptung, Gott habe die menschliche Sündhaftigkeit durch Verdammnis bestraft, wobei die Abkömmlinge der Verdammten auf bestimmte Weise (zum Beispiel durch schwarze Haut) gekennzeichnet worden seien. Eine weitere Methode, mit einem ähnlich langen Stammbaum, legte weniger Gewicht auf den göttlichen Eingriff, sondern hielt dafür, dass Umweltfaktoren (wie etwa der Einfluss des Sonnenlichts) die durch Adam und Eva repräsentierte ursprüngliche und einzige biologische Form abgewandelt hätten. Dabei sei eine Reihe unterschiedlicher Typen entstanden, die sich in der Folge durch Vererbung dauerhaft etabliert hätten. Mit diesem Argument konnten viele der »Rassen«-Idee verpflichtete Wissenschaftler im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert behaupten, dass ihre Erklärung für die Existenz von »Rassen« mit der christlichen Theologie vereinbar sei.
Doch am Ende des achtzehnten Jahrhunderts wurde durch die wissenschaftliche Analyse ein Einwand wiederbelebt, der im späten sechzehnten Jahrhundert in Hakluyts Sammlung von Reiseberichten seinen Ausdruck gefunden hatte (vgl. Sanders 1978: 223f.). Die Gegenbehauptung verwies darauf, dass die als Beweis für die Existenz von »Rassen« bezeichneten phänotypischen Charakteristika sich nicht veränderten, wenn Angehörige von »Rassen« in ein anderes geographisches Umfeld gelangten und anderen Umweltbedingungen ausgesetzt wurden. Zur Stützung dieser Ansicht wurde oft auf die zwangsweise in die Vereinigten Staaten verbrachten und dort versklavten Afrikaner verwiesen, ebenso auf die Erfahrung der in den tropischen Kolonien ansässigen Europäer. Diese Beispiele wurden auf eine Weise interpretiert, die den Schluss zuließ, Umweltfaktoren (mit Einschluss des Klimas) wären nicht dazu in der Lage, die physischen Merkmale der jeweiligen »Rasse« zu verändern. So folgerte man denn, dass unterschiedliche Menschenrassen« immer existiert hätten und dass mithin die Hierarchie von Höher- und Minderwertigkeit naturgegeben, unvermeidlich und unveränderlich sei. Dieser Angriff auf die Milieutheorie führte zu einem sehr viel grundsätzlicheren Konflikt mit der christlichen Theologie (Stanton 1960: 69, Haller 1971: 69-79, Stepan 1982: 36-46). Die daraus erwachsenden Schlussfolgerungen gewannen umso mehr an legitimatorischer Aura als die Wissenschaft gegenüber der Theologie in unaufhaltsamem Aufstieg begriffen war. In der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hatte diese polygenetische Theorie die Vorherrschaft erlangt und viele ihrer grundsätzlichen Annahmen lebten in der nach-darwinianischen Epoche fort (Stocking 1968: 39, 45f.,55).
Zweitens ersetzten die wissenschaftlichen »Rassen«-Diskurse nicht die früheren Darstellungsformen des Anderen. Der Raum, den die »Rassen«-Idee einnahm, wurde durch Vorstellungen von Wildheit, Barbarei und Zivilisation bereits vorgeformt, und diese später dann zu neuem Leben erweckt. Dergestalt wurde, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe (Miles 1982: 111f.), die bestehende Bildwelt in der Darstellungsform der »Rasse« prismatisch gebrochen, was zu dem Ergebnis führte, dass die Milieutheorie als Erklärungsfaktor an Bedeutung verlor. So entstand, um ein Beispiel zu geben, die Idee der Zivilisation in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Darunter verstand man zunächst eine Fähigkeit oder Errungenschaft, die von allen Menschen, auch den wildesten, erlangt werden konnte, wenn Zeit und Hilfe in ausreichendem Maße zur Verfügung standen. Die dem zu Grunde liegende Annahme einer Bild- und Beeinflussbarkeit menschlicher Charakterzüge wurde im späten neunzehnten Jahrhundert durch die wissenschaftliche Vorstellung in Frage gestellt, dass die menschliche Gattung in dauerhafte und voneinander abgegrenzte biologische Gruppen aufgespalten sei. Demzufolge wurde Wildheit ein festgelegter Zustand des »Negers« oder der »afrikanischen Rasse«, das Produkt eines kleinen Gehirns, während im Gegenzug die »Zivilisation« zur Eigenschaft »weißer«, mit einem großen Gehirn ausgestatteter Menschen geriet (Stocking 1968: 35ff., 121f.).
Drittens war die Entstehung und Verbreitung der »Rassen«-Idee ein europäisches und nordamerikanisches Phänomen (vgl. etwa Gossett 1965), zu dem viele wissenschaftliche Autoren durch Diskussion und gegenseitige Kritik beitrugen. Sie suchten nach neuen Methoden, um den Menschen zu vermessen und nach Lösungen für entstehende Anomalien. Die Schriften der britischen Theoretiker Lord Kames und Charles White wurden in den Vereinigten Staaten kritisch besprochen in einem 1787 veröffentlichten Buch von Samuel Stanhope Smith, Essay on the Causes of the Variety of Complexion and Figure in the Human Species (Frederickson 1972: 72). Die Phrenologie (wissenschaftliche Schädelkunde) wurde in Deutschland durch Johann Kaspar Spurzheim und Franz Joseph Gall begründet und von George Combe in Schottland weiterentwickelt (Gossett 1965: 71f.). Combe seinerseits war ein Freund des Amerikaners Samuel George Morton, der 1839 das Buch Crania Americana und 1844 Crania Aegyptiaca veröffentlichte (Gould 1984: 50-69). Der Schwede Anders Retzius führte den Schädelindex ein (eine Vermessungsmethode, bei der u. a. die Länge des Schädels durch die Breite geteilt wurde; Gossett 1965: 76), und beeinflusste damit in erheblichem Maße die (großenteils kritischen) Arbeiten von Paul Broca in Paris (Gould 1984: 98ff.).
Der deutsche Anatom Friedrich Tiedemann vermaß Gehirne, um Unterschiede zwischen »Rassen« festzustellen, wobei seine Ergebnisse eine kritische Entgegnung seitens des US-Amerikaners Josiah Clark Nott erfuhren (Gossett 1965: 77). Der von dem französischen Anatomen Georges Cuvier beeinflusste Schweizer Naturforscher Louis Agassiz wanderte 1846 in die Vereinigten Staaten aus, wo er mit Josiah Nott und George Gliddon zusammenarbeitete (Stanton 1960). Diese beiden übten mit ihrem zuerst 1854 erschienenen Buch Types of Mankind einen großen Einfluss auf die »Rassen«-Theorie aus. Das Werk erfuhr bis zum Ende des Jahrhunderts wenigstens neun weitere Auflagen (Gossett 1965: 65, Banton 1977: 50ff.). Auf diese Weise verdeutlichte der »Rassen«-Diskurs den zunehmend internationalen Charakter des wissenschaftlichen Unternehmens, der zugleich seine Formulierung erleichterte. Die Folge war, dass die »Rassen«-Idee als Klassifikationsschema weit verbreitet wurde, und dass alle ihre Befürworter unterschiedliche Andere (Afrikaner, nordamerikanische Indianer, Inder) als Beispiele für minderwertige »Rassen« darstellten.
Viertens blieb zwar die Verbindung von biologischem Typus und hierarchischer Ordnung ein konstantes Merkmal des »Rassen«-Diskurses, doch veränderten sich mit der Zeit die Klassifikationsschemata wie auch der konkrete Inhalt der Determinationsformen und zugeschriebenen Charaktereigenschaften. Um die Wende vom achtzehnten zum neunzehnten Jahrhundert basierte die Klassifikation von »Rassen« zumeist auf den phänotypischen Eigenschaften der Hautfarbe, der Beschaffenheit des Haares und der Form der Nase, doch wurde in zunehmendem Maße Gewicht auf die Schädelform gelegt (Benedikt 1983: 22), vor allem was die Forschungen seit dem frühen neunzehnten Jahrhundert betrifft (Curtin 1965: 366). Man unternahm beträchtliche Anstrengungen, um zum Beispiel den Schädelumfang, den Gesichtsprofilwinkel und den Schädelindex zu taxieren, und es gab viele Auseinandersetzungen über die jeweilige Gültigkeit dieser verschiedenen Messeinheiten. Dergestalt wurde die »Rassen«-Wissenschaft auf vielschichtige Weise weiterentwickelt, wobei die Ursache dieser Vielschichtigkeit zum Teil darin lag, dass die ganze Idee ein grundsätzlicher Irrtum war. Als jeder Klassifikationsversuch unter dem Gewicht logischer Inkonsistenz und empirischer Beweise zusammenbrach, wurde eine neue Klassifikation formuliert. Doch hing sie auch mit der zunehmenden Verfeinerung der Messmethoden zusammen (Stocking 1968: 57).
So behauptete etwa der Deutsche Peter Camper im späten achtzehnten Jahrhundert, man könne »Rassen« aufgrund des Gesichtsprofilwinkels unterscheiden. Dieser Winkel wird von zwei Linien gebildet, deren eine vom Kinn zum oberen Teil der Stirn gezogen wird, während die andere horizontal zum unteren Teil des Kinns verläuft. Den schärfsten Gegensatz sah Camper, als er den Gesichtsprofilwinkel der »Griechen« mit dem der »Neger« verglich (Gossett 1965: 69f.). Etwas anders gelagerte Argumente, die jedoch zu den gleichen Schlussfolgerungen führten, wurden von der Phrenologie vorgetragen, die sich als Wissenschaft der geistigen Tätigkeit verstand. Ihre zentrale Behauptung ging dahin, dass das Gehirn in eine Anzahl von Sektoren unterteilt war, deren jede die Grundlage für eine bestimmte Fähigkeit abgab. Die Unterschiede zwischen den »Rassen« sollten sich demzufolge aus unterschiedlichen Variationen hinsichtlich der Größe und des internen Verhältnisses dieser Sektoren zueinander ergeben und nicht nur durch die Größe des Gehirns oder des Schädelvolumens bedingt sein (Stepan 1982: 21-28). So behauptete Combe:
Die Hindus weisen einen bemerkenswerten Mangel an Charakterstärke auf. […] Die Stärke der geistigen Äußerungsformen entspricht proportional der Größe der zentralen Organe, und der Kopf des Hindus ist klein, der des Europäers aber groß, was mit den unterschiedlichen geistigen Charakteren präzise übereinstimmt. […] Das Gehirn des Hindus lässt einen deutlichen Mangel in den für die Kampf- und Zerstörungskraft zuständigen Organen erkennen, wohingegen diese Teile im Gehirn des Europäers gut entwickelt sind. Der Hindu ist verschlagen, ängstlich und stolz, und im Vergleich zu den eben erwähnten Organen sind bei ihm die der Heimlichkeit, Vorsichtigkeit und Selbstachtung proportional umfangreicher entwickelt. (Combe 1830: 605f.)
Wie Fryer (1984: 171) so treffend bemerkt, war auf dieser Grundlage »die Phrenologie die Rechtfertigung für den Ausbau des Empires«.
Samuel Morton versuchte einen Maßstab für »Rassen«-Unterschiede zu finden, indem er Schädel mit Senfsamen oder Schrot füllte und daraus ein Maß für das Schädelvolumen ableitete. Anhand dessen behauptete er, signifikante Unterschiede zwischen fünf verschiedenen »Rassen« (kaukasischen, mongolischen, malaiischen, amerikanischen, äthiopischen) nachweisen zu können, wobei er allerdings diese »Rassen« letzten Endes wieder in »Familien« unterteilte (vgl. Gould 1984: 54f.). Durch Mortons Kraniometrie wurden Nott und Gliddon stark beeinflusst (vgl. Stanton 1960, Gould 1984: 30-72). Sie gingen davon aus, dass zwischen dem zunehmenden Gehirnvolumen und einem höheren Grad von angeborener Intelligenz ein enger Zusammenhang bestand. Louis Gratiolet suchte zu beweisen, dass sich die oberen Schädelnähte bei verschiedenen »Rassen« zu verschiedenen Zeiten schließen, wobei dieser Vorgang das Wachstum des Gehirns beendet. Der Zeitpunkt dafür würde, so folgerte er, bei »Negern« früher liegen als bei »Weißen« (Gossett 1965: 75, Gould 1984: 98). Am offenkundigsten treten diese Probleme in der Kompliziertheit der von Paul Broca entwickelten Messsysteme zutage, mit Hilfe derer er ein phänotypisches Merkmal aufzufinden suchte, das die Existenz einer »Rassen-Hierarchie systematisch und folgerichtig nachweisen sollte (Gossett 1965: 76, Gould 1984: 82-107).
Fünftens fand der wissenschaftliche »Rassen«-Begriff universelle Anwendung. Nicht nur betrachteten sich diejenigen, welche die Idee formulierten, als Angehörige einer »Rasse«, sondern sie arbeiteten auch eine »Rassen«-Hierarchie für Europa aus. So gab es zum Beispiel im späten neunzehnten Jahrhundert Bestrebungen, die verschiedenen »Rassen« zu identifizieren, aus denen die britische Bevölkerung sich zusammensetzte, wobei man sich auf Haut- und Augenfarbe sowie auf Schädelmessungen bezog (Beddoe 1885). Europa insgesamt betreffend wurden verschiedene Klassifikationen lanciert, von denen die verbreitetste zwischen teutonischen (oder nordischen), mediterranen und alpinen »Rassen« unterschied (Ripley 1900: 103-30). In den USA verband sich diese Klassifikation mit der Auffassung, die menschliche Intelligenz sei eine festgelegte und ererbte Eigenschaft, wodurch man, wie wir noch sehen werden, eine hierarchische Abstufung zwischen erwünschten und unerwünschten Einwanderern festlegen konnte (Kamin 1977: 30-51, Gould 1984: 146-233).
In Europa konzentrierten sich Darstellungsformen des Anderen als Angehörigen einer minderwertigen »Rasse« unter anderem auf die Iren (Curtis 1968, 1971) und die Juden (Mosse 1978). Dies wurde zum Teil durch die Behauptung unterstützt, die nordische »Rasse« sei anderen biologisch überlegen. Der deutsche »Rassen«-Forscher H.F.K. Günther bot in einem 1929 (in dritter Auflage) erschienenen Buch mit dem Titel Rassenkunde Europas eine Interpretation der europäischen Geschichte, in der er die wissenschaftliche »Rassen«-Idee verwendete, um Menschengruppen mit unterschiedlichen und messbaren physischen und geistigen Eigenschaften zu bezeichnen. Dabei war für ihn die nordische »Rasse« durch besondere Kreativität ausgewiesen, besaß ein Bedürfnis nach Eroberungen, eine besondere Begabung für die Militärwissenschaft und eine niedrige Kriminalitätsrate. Wenn, so fürchtete er, »das Blut der nordischen Rasse austrocknet«, sei der gesellschaftliche Zerfall in Europa nicht aufzuhalten. In unheilsschwangerem Ton verkündete er: »Die Frage, die sich uns stellt, ist die, ob wir genügend Mut aufbringen, um künftigen Generationen eine Welt zu bereiten, die sich rassisch und eugenisch zu reinigen in der Lage ist.« Günther war nur einer von vielen deutschen (und anderen europäischen) Gelehrten (und politisch Aktiven), die den wissenschaftlichen »Rassen«-Diskurs benutzten, um zugleich die Überlegenheit der nordischen »Rasse« und die Minderwertigkeit der Juden zu erweisen (Mosse 1978: 77-93, 113-27).
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.