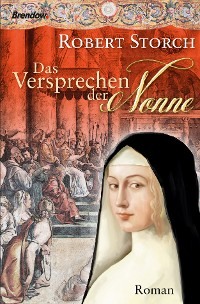Kitabı oku: «Das Versprechen der Nonne», sayfa 4
Nach der Messe schritt, nachdem das einfache Volk die Kirche verlassen hatte, Wulfhardt Seite an Seite mit Goumerad zum Portal. Sie traten hinaus in die Nacht vor dem Portal, da erhob sich hinter ihnen Walburgas Stimme. Sie klang viel zu befehlsgewohnt für eine Frau, auf die das Feuer wartete: „Prior Goumerad, Ihr habt die Kerze vergessen, die unser Dormitorium erleuchten soll.“
Goumerad wandte sich zu ihr um, sah sie jedoch nicht an, sondern hob das Kinn. „Wo Sünder schlafen, soll das Licht Gottes nicht brennen!“
Das Volk vor der Kirche grummelte, jemand rief: „Unsere Äbtissin ist keine Sünderin!“
Walburga erwiderte: „Jesus hat mit Sündern gespeist!“
Ein Mönch trat vor. Sein Doppelkinn bedeckten Bartstoppeln, sie endeten knapp über dem Ausschnitt der Kutte. „Verehrter Prior“, sagte er zu Goumerad. „Ich könnte zum Frieden aller das Licht zu den Nonnen tragen.“
„Schweig!“, schnappte Goumerad.
Walburga seufzte schicksalsergeben. „So will ich vor dem Altar wachen und beten. Möge der Herr uns sein Licht senden.“ Sie ging zurück in die Kirche. Die Nonnen folgten ihr, suchten ihre Nähe, warfen sich verzweifelte Blicke zu, während Walburga in ihrer Mitte betete. Die Menschen Heidenheims drängten an Wulfhardt vorbei zurück in die Kirche, um ihrer Äbtissin beizustehen.
„Das war dumm von dir!“, zischte Wulfhardt Goumerad an. Zur Antwort drehte der Prior beleidigt den Kopf zur Seite.
Wulfhardt schritt an das Feuer, schnitt sich ein Stück Rindfleisch ab und ließ sich Wein einschenken. Nur seine Waffenknechte und die Mönche begleiteten ihn. Wulfhardt hob feierlich den Becher und trank auf seine Familie. Die Waffenknechte prosteten ihm zu, Hroutland stiegen ob des Gedenkens an Wulfhardts Bruder Tränen in die Augen. Auch die Mönche ließen sich einschenken. Schweigend nippten sie an ihren Bechern, ein Gespräch wollte nicht entstehen.
Da rief ein Waffenknecht: „Ein Licht! Ein magisches Licht!“
Wulfhardt fuhr herum. Tatsächlich: Lichtschein flackerte durch die Tür des Nonnenklosters. Der Ruf des Waffenknechts lockte einige Bauern aus der Kirche. Sie sahen das Licht und fielen auf die Knie. Immer mehr Menschen strömten aus der Kirche, liefen bis an den Holzzaun heran, der die Nonnenklausur begrenzte. „Der Glanz Gottes!“, riefen sie. „Der Herr hat sie erhört! Walburga bat ihn um Licht, der Herr hat’s geschickt!“ Sie warfen sich vor dem Lichtschein in den Staub, auch einige von Wulfhardts Waffenknechten wurden vom Zauber ergriffen.
Wulfhardt war wie gelähmt. Erst der Donnerschlag auf der Lichtung. Jetzt das Licht im Nonnenkloster. Wieder schickten die Götter ein Zeichen, wieder begünstigten sie die Nonnen.
Oder war es der Christengott, der diese Zeichen schickte?
Zum ersten Mal ahnte Wulfhardt, dass der Gott der Christen tatsächlich existieren könnte. War Jesus tatsächlich sein Sohn? Bisher hatte Wulfhardt ihn verachtet, weil er in einem Stall geboren und wie ein Verräter ans Kreuz geschlagen worden war.
Wulfhardt bekreuzigte sich und küsste das silberne Kreuz auf der Brust.
Die Nonnen kamen nun heran, Walburga an der Spitze. Nur die Nonne mit dem Kopftuch entdeckte Wulfhardt nicht. Walburga kniete sich vor die erleuchtete Tür. Als sie die Stimme erhob, schwiegen alle und falteten die Hände. „Du, o Herr, hast Dich gewürdigt, mich Unwürdige mit dem Troste Deines Lichtes heimzusuchen und die Seelen Deiner Dienerinnen, die mir in Anhänglichkeit folgen, aufzurichten. Du hast die undurchdringliche Finsternis mit ihrem düsteren Schrecken durch die Strahlen Deines Erbarmens aufgelöst. Und das darf man nicht meinen Verdiensten, vielmehr dem selbstlosen Großmut deiner Liebe und den Bitten meines Bruders Wynnebald, deines frommen Dieners, zuschreiben. Dir, o Herr, sage ich Dank, dem ich als demütige Magd von Jugend an diene. Amen.“
Das Licht leuchtete bis zur Laudes am nächsten Morgen. Die Nachricht vom Lichtwunder zu Heidenheim sprang von Mund zu Mund und von Dorf zu Dorf, Menschen strömten herbei: Gesunde, die etwas von Gottes Gnade, die auf Walburga herabgeschienen war, auf sich lenken wollten, ebenso wie Kranke, die um Heilung ihrer Gebrechen baten. Walburga geleitete die Kranken in das Krankenlager neben dem Nonnenkloster, betete für sie und verabreichte ihnen Trünke aus den Kräutern des Gartens.
Wulfhardt verkündete am Tag nach dem Wunder, der Herr habe mit diesem Zeichen den Vorwürfen des Priors Goumerad gegen Walburga widersprochen, weshalb die Anklage gegen Walburga entkräftet sei. Auch ihn schien das Licht ergriffen zu haben. Oder heuchelte er, weil die Verehrung Walburgas durch seine Waffenknechte ihm keine Wahl ließ?
Michal wusste: Der Teufel ist ein Meister der Verstellung.
Dennoch fühlte sich Michal wie von schwerer Last befreit. Nur Walburgas Tadel, sie sei des Schleiers unwürdig, drückte sie noch nieder. Alles tat sie, um den Unterweisungen Walburgas zu entsprechen: Kein unnötiges Wort verließ ihren Mund, gänzlich widmete sie sich dem Gebet, der Arbeit in der Schreibstube und dem Unterricht. Jede Regung von Walburgas Gesichtsmuskeln registrierte sie. Hier und da schlich sich ein Lächeln über die Lippen, auch in ihre Richtung. Doch über den Schleier verlor sie kein Wort.
Grübelnd verbrachte Michal die meiste Zeit in der Schreibstube. Dort fiel ihr beim Ordnen der Manuskripte die unbeschreiblichste Geschichte in die Hände, die ihr je unter die Augen gekommen war: die pietas silvestri. Auch Wynnebald hatte die Geschichte einst so fasziniert, dass er sie den langen Weg von Rom bis nach Heidenheim mitgeführt hatte. Konstantin, ein Kaiser des alten Römerreiches, ward vom Aussatz befallen, doch anstatt die Hilfe der heidnischen Priester anzunehmen, ließ er Papst Silvester holen. Jener heilte ihn durch die Taufe. Sodann wollte Konstantin den Papst überhäufen mit Titeln, Würden und Ansprüchen. Silvester jedoch lehnte ab, denn die Kirche sei nicht interessiert an irdischen Gütern und irdischer Macht, sondern allein auf die kommende Gottesherrschaft ausgerichtet. Michal erkannte die Parabel auf ihr Leben: Sie hatte sich aus der Welt in das Kloster zurückgezogen, allen irdischen Prunk verschmähend, um nach Gottes Gesetzen zu leben. Und hatte nicht auch Jesus bei der dritten Versuchung durch den Teufel alle Reiche der Welt ausgeschlagen?
„Welch heilige Männer in Rom gewirkt haben!“, seufzte Michal und dachte dabei an Papst Silvester. Petrus und Paulus hatten dort den Märtyrertod erlitten, Willibald und Wynnebald waren dorthin gepilgert. Alle heiligen Männer zog es nach Rom! In ihr keimte der Wunsch auf, ebenfalls in die Heilige Stadt zu pilgern, doch schnell schalt sie sich eine Torin: Als gebrechliche Frau konnte sie sich nicht durch den Einsatz großer Kräfte hervortun. War es nicht dieses anmaßende Verhalten, dessentwegen ihr der heilige Schleier vorenthalten blieb?
Drei Tage nach dem Lichtwunder erschien Bischof Willibald in Heidenheim, nur begleitet von zwei Diakonen und dem Heiden von der Lichtung. Im Angesicht jenes heiligmäßigen Mannes fühlte sich Michal nicht wie dessen Nichte, sondern wie eine Unwürdige, die seinem Stamm allenfalls an den äußersten Enden des Astwerks entsprungen war. Während er den Marktplatz überquerte, wo die Menschen zusammengelaufen waren, schlug er nach allen Seiten das Kreuzeszeichen. Von seinem Bischofsstab strömte, im Gegensatz zu Wulfhardts Stab, keine Bedrohung aus, vielmehr erschien er wie der Stab eines guten Hirten, der seine Herde schützt. Der Stab war gleichsam das einzige Insigne, welches die erhabene Stellung verriet, denn er trug ansonsten nur eine braune Mönchskutte aus einfachem Wollstoff, nichts bedeckte die grauen Haare. Doch sein gütiger Blick flößte jedem Menschen auf dem Marktplatz mehr Bewunderung ein, als es eine Krone vermocht hätte. Welch würdiger Bischof der römischen Kirche! Welche Verderbtheit hatte sie dagegen in Wulfhardts Antlitz erblickt, dem Bischof der fränkischen Kirche.
Seine Schwester Walburga erwartete Willibald an der Klosterpforte. Sie verneigte sich vor ihm, er umarmte sie. Alsdann zog er sich in das Mönchskloster zurück, um zu speisen und ein wenig zu ruhen. Gerade war er im Klosterhof verschwunden, da sagte Walburga: „Heute ist ein besonderer Tag, Schwester Michal. Mein Herz jubelt, weil ich meinen Bruder, den Bischof, endlich wiedersehe, noch dazu gesegnet mit guter Gesundheit in seinem zweiundsechzigsten Lebensjahr. Doch auch dein Herz soll jubeln: Ich werde unseren Bischof bitten, dir heute den heiligen Schleier zu verleihen.“
Michal zuckte zusammen, so unerwartet traf sie die Nachricht. Sie schlug die zusammengepressten Hände vor den Mund, sodass die Fingerspitzen die Nase berührten. „Oh danke! Ich danke dir, meine gute Tante!“
„Nein“, wehrte die Äbtissin ab. „Danke mir nicht. Du hast den Schleier wahrlich verdient.“ Sie neigte ihren Mund etwas näher an Michals Ohr. „Danke, dass du das Licht in das Kloster gebracht hast. Deine beherzte Tat rettete mich vor der Anklage Wulfhardts.“
„Gott entzündete dieses Licht.“ Michals Mund verzog sich zu einem Lächeln.
„Wahrlich, Gott hat in dir eine tapfere Streiterin. Und nun begebe dich in die Schreibstube, bis der Bischof uns ruft.“
Michal tat, wie ihr geheißen, doch war ihre Hand zu zittrig, um Buchstaben auf Pergament zu bannen, und als Willibald sie zum Gottesdienst rief, fühlte sie sich schwach wie noch nie in ihren achtzehn Jahren und hätte sich am liebsten auf dem Dachboden verkrochen. Doch Aebbe fasste sie am Arm. „Du bist ja ganz blass, Schwester Michal. Na komm, gehen wir ein wenig nach draußen, da geht’s dir gleich besser.“
„Ich weiß nicht …“, protestierte Michal, doch da hatte ihre Freundin sie schon vor die Tür gezogen.
Sie folgten Walburga. Sie führte Willibald zum Wynnebaldsbrunnen, der umrahmt wurde von zwei uralten Eichen und einem Tempel aus römischer Zeit; in ihm hatte Wynnebald ein Kreuz aufgerichtet, über dem bronzenen Basrelief, das die Fratzen heidnischer Götter zeigte: Welch hervorragendes Sinnbild für den Sieg des Christentums!
Willibald predigte den Heiden, mit der Taufe, die sie nun empfingen, sage Gott „Ja“ zu ihnen. Dieses „Ja“ sei endgültig: Er nehme sie in seinen gütigen Schoß und werde sie ewiglich beschützen. Dann taufte er sie.
Michal gelang es währenddessen, sich zu sammeln. Mönche, Nonnen und die frisch Getauften folgten dem Bischof nach der Taufe in die Kirche. Kerzen wurden entzündet, durch die hohen Fenster fiel wenig Licht, dafür umso schärferer Herbstwind, von dem die Kerzenflammen zitterten während der Heiligen Messe.
Da trat Willibald vom Altar herab und schritt auf die Holzschranke zu, hinter der die Nonnen standen. Vor Michal blieb er stehen.
Sie starrte den ehrwürdigen Bischof an, bis sie merkte, wie unziemlich dies war. Hastig senkte sie das Haupt.
Willibald sprach: „Hugeburc, genannt Michal, aus dem Sachsenstamme, du bist wie ich von den Gestaden der Heimat aufgebrochen, bist über das stürmische Meer gereist, um in diesem Land das Licht des Evangeliums zu verbreiten. Allein mit diesem Wagnis hast du deine Eignung für ein Leben im Lichte Christi bewiesen. Und hätte der Herr sein Licht zu Walburga geschickt, wenn er mit einer ihrer Mägde haderte?“
Michals Knie gaben nach, kniend presste sie die Handflächen aneinander.
Walburga überreichte Willibald einen schwarzen Schleier mit weißem Rand.
Willibald fuhr fort: „Dieser heilige Schleier soll von nun an dein Haupt bedecken, denn der heilige Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther: Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt. Gelobst du, Michal, die Evangelischen Räte der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams zu befolgen?“
Eine Pause trat ein, bis Michal merkte, dass sie antworten musste. Sie haspelte: „Ich gelobe es, bei Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und bei Jesus Christus, seinem Sohn.“
„Gelobst du, wahrhaft Gott zu suchen, dich um die tägliche Umkehr zu bemühen und ein Leben zu führen nach der Regel des heiligen Benedikts?“
„Ich gelobe es!“
„Gelobst du, Christus nichts vorzuziehen?“
„Ich gelobe es!“
Und er breitete den Schleier über ihr Kopftuch und segnete sie. „So bitten wir dich, Herr, unser Gott: Schau gütig auf unsere Schwester. Das Versprechen der Jungfräulichkeit legt sie in deine Hand und weiht dir ihr ganzes Leben; denn du selbst hast dazu ihr Herz bewegt. Ohne dich kann kein Sterblicher dem Gesetz der Natur entgehen, die Freiheit zum Bösen bewältigen, die Macht der Gewohnheit brechen, die Leidenschaft der Sinne überwinden.“
Aebbe drückte ihre Hand, tränenüberströmt blickte Michal auf das Holzkreuz, das auf dem steinernen Altartisch thronte.
„Ich sage zum Herrn: Du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Ich neige mein Herz, zu tun deine Gebote immer und ewiglich.“
So vollkommen war dieser Augenblick, so festgewebt das Band zwischen Jesus Christus und ihr, dass − dessen war sie gewiss − niemals irgendetwas es wieder lösen könnte.
Winter
3. KAPITEL
Mit jedem Baum, den Gerold auf dem Weg zum Grafenhof passierte, schlug sein Herz schneller. Er senkte den Blick, legte die Hände aneinander und murmelte Worte der Kirchensprache. Er verstand sie nicht, jedoch hoffte er, sie würden ihm bei dieser Prüfung helfen. „Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum.“ Gerold sah auf. Hundert Schritte vor ihm erblickte er das Licht am Ende des Waldes. „Adva…“ Er holte tief Luft. „Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua …“ Unter seinem linken Fuß knackte es. Er zuckte zusammen. Es war nur ein Zweig, beruhigte er sich. Nur ein Zweig. Er legte die zittrigen Hände aneinander. Er wollte die Kirchenformel weitersprechen, doch ihm fielen keine Worte mehr ein.
Angst.
Gerold schämte sich. Bevor Wulfhardt den Grafenhof heimgesucht hatte, hatte er nicht gewusst, was Angst war. Dann hatte Wulfhardt ihn in das Verlies gesperrt, ein Krug abgestandenes Wasser war seine einzige Gesellschaft gewesen. Die Schreie der Menschen, die im Großen Saal verbrannten, hatten ihm in den Ohren geklungen. Er hatte Adelheids hohes Kreischen gehört. Auch sie, seine Angebetete, hatte er im Stich gelassen.
Er hatte dort unten gesessen, hatte aber nichts tun können. Das war am schlimmsten gewesen. Aber dann − vielleicht nach zwei Tagen – bemerkte er, dass an einer Stelle durch die hölzerne Falltür ein kräftiger Lichtstrahl drang. Er kniff die Augen zusammen: Das Holz war dort ein wenig abgesplittert. Er kratzte Erde von den Wänden, baute damit einen Hügel und stellte den Krug darauf. Auf dem Krug hin- und herbalancierend, bekam er immer wieder das Holz der Falltür zu fassen, ab und an riss er einen Holzsplitter aus der Falltür heraus. Selbst als es dunkel wurde, machte er weiter. Als es wieder hell wurde, passte sein Arm durch das Loch. Mit der einen Hand zog er sich an der Falltür nach oben, mit der anderen griff er nach draußen. Ganz lang musste er seinen Arm machen, bis er endlich den Riegel zu fassen bekam und ihn zurückschieben konnte. Er hob die Falltür an und traute seinen Augen nicht: Vor ihm stand ein weißes Reh. Rote Augen, gekrönt von weißen Wimpern, sahen ihn ruhig an. Gerold war, als hätte das Reh die ganze Zeit dort oben gewartet. Mit einer Stange seines Geweihs schob das Reh ihm das Seil hin. Dann trabte es davon.
Ich träume, dachte er. Oder bin ich im Himmel?
Er stieß die Falltür auf, fasste das Seil und zog sich hinaus.
Hätte er gewusst, welcher Anblick ihn dort oben erwartete, er wäre im Verlies geblieben: seine Mutter, die Haare versengt, die Haut verbrannt, nur zu erkennen an der silbern funkelnden Halskette. Sein Vater, den Pfeil in der Brust, das Blut getrocknet, darüber süßer Geruch. Wulfhardt hatte jeden ausgelöscht, mit dem Gerold seine Jugend verbracht hatte, all die Menschen, die ihn bewundert und in ihm den zukünftigen Grafen gesehen hatten. Gerold musste sich hinknien und würgen. Er gewahrte den Siegelring seines Vaters, aus Kupfer geschmiedet, auf der Platte ein Eber eingraviert, das Wappentier der Familie.
Plötzlich hörte er es, das Donnern von Hufen − wie beim Überfall. Er schreckte hoch, entdeckte seine Franziska, drei Schritte vor ihm, ergriff sie. Sein Blick, auf der Suche nach Reitern, huschte bis zum Waldrand, fand aber keine, nur das Donnern in seinen Ohren wurde lauter. Er rannte davon, in den Wald, Baumstämme flogen an ihm vorbei, immer weiter, bis er, von hohen Buchen umstanden, auf den Waldboden sank.
Als er aufwachte, wusste er nicht, wo er war und wie er dorthin gekommen war. Dann fiel es ihm wieder ein, das Donnern der Hufe. War es Wirklichkeit oder Einbildung gewesen? Am Ringfinger steckte Vaters Siegelring. Er musste ihn mitgenommen haben bei seiner Flucht.
Jetzt starrte Gerold auf den Siegelring und begann wieder mit der Kirchenformel: „Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum.“ Er blieb stehen, den Blick gesenkt, und atmete zweimal tief ein. Einen Fuß setzte er vor den anderen. „Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.“ Er hielt an, Stück für Stück hob er den Kopf. Zwischen den Baumstämmen hindurch, hinter dem Waldrand, erspähte er das mit Holzschindeln gedeckte Dach des Wohnhauses der Grafenfamilie. Seiner Familie.
„Sie sind tot. Alle sind sie tot!“
Es kribbelte in Gesicht und Händen. Er öffnete den Mund, doch es gelang ihm nicht, die Luft einzusaugen. Die Baumstämme vor ihm setzten sich in Bewegung, sie drehten sich um ihn herum.
Hufgetrappel. Leise, wie aus weiter Ferne. Es schwoll an. Die donnernden Hufe dröhnten in den Ohren.
Gerold schrie. Er wirbelte herum und rannte.
Er wusste nicht wohin. Tag um Tag streifte er durch den Wald, mal hierhin, mal dorthin. Ab und zu erblickte er das geheimnisvolle weiße Reh. Doch hielt es Abstand von ihm, so wie er Abstand hielt von den Menschen. Immer, wenn er den Waldrand erreichte, wenn er in einigen hundert Schritten Entfernung ein Weizenfeld erahnte, begann sein Herz zu rasen.
Die Nächte waren noch schlimmer: Er lag auf dem Waldboden, die Hand am Griff der Franziska, seine Finger und Zehen froren ein, Blätter legten sich auf ihn wie auf sterbende Maiglöckchen und Farne, begleitet vom dumpfen Ruf des Uhus.
Woche um Woche wurden die Nächte kälter.
Eines Tages kam der Hunger. Viel zu lange hatte er sich nicht ums Essen gekümmert, hatte nur hier und da eine Beere gepflückt oder eine am Boden liegende Nuss aufgelesen. Doch jetzt, mit einem Mal, fühlte er sich schwach wie nach einem Fieber. Er durchpflügte das Unterholz und stopfte alles Essbare in sich hinein. Schließlich erlegte er einen Keiler mit seiner Franziska. Sein Fleisch stillte Gerolds Hunger.
Je kürzer die Tage wurden, umso mehr Blätter verloren die Bäume. Er wusste, dass er den Tod seiner Familie rächen musste, dass er um seine Grafschaft kämpfen musste. Doch allein der Gedanke daran ließ die schaurigen Bilder vom Überfall wieder in ihm aufsteigen. Er war unfähig, an seine Pflichten zu denken. Vor jeder Siedlung schreckte Gerold zurück, der Wald hielt ihn gefangen. Er konnte hier leben, denn er hatte früher viele Tage im Wald verbracht, hatte Hunger ertragen und Kälte getrotzt. Ein Griff an sein Wehrgehänge verriet ihm, dass er alles hatte, was er hier brauchte: Schwert und Dolch steckten in den Scheiden, die Franziska in der Schlaufe. Die Franziska hatte er einst von der Wand des Großen Saales geschnappt, wo sie als Erinnerungsstück gehangen hatte. Obwohl Vater ihm hatte ausreden wollen, mit dieser altmodischen Waffe umzugehen, hatte er tagaus, tagein geübt. Als er mit ihr aus zwanzig Schritten einen Ast vom Baum hatte schlagen können, war auch Vater beeindruckt gewesen.
Irgendwann begann die Einsamkeit ihn zu quälen. Er legte die Wange an die Rinde einer Eiche. Die Rinde war rau und kalt, doch meinte er, auch Wärme zu spüren, die aus dem Inneren des Stammes nach außen drang. Er umarmte den Stamm und erzählte der Eiche von seiner Schwester: wie er sie gefüttert hatte, wie er ihr die ersten Schritte beigebracht hatte, wie sie seine größte Bewunderin gewesen war, wenn er sich in einem Zweikampf geschlagen hatte. Der Eiche schienen seine Worte egal zu sein. Eine Böe rauschte durch ihre Krone und riss gelbe Blätter von den Ästen. Sie rieselten auf ihn herab, begleitet von der immer gleichen Melodie eines Waldlaubsängers. Langsam setzten die hohen, spitzen Töne ein. Sie verschnellerten sich rasch, um dann wieder abzufallen.
Plötzlich sprang das weiße Reh an ihm vorbei. Fast gleichzeitig berührten seine Vorder- und Hinterläufe den Boden, mit einem Sprung schaffte es vier Schritte.
Ein Wolf jagte ihm hinterher.
Gerold nahm die Verfolgung auf, zog die Franziska aus der Schlaufe und schleuderte sie. Am Abend briet Gerold Wolfsfleisch über seinem Feuer.
Von nun an folgte das weiße Reh − dem er den Namen „Flocke“ gab − seinen Spuren durch den Wald, wahrscheinlich fühlte es sich sicherer in seiner Nähe. Und abends, wenn Gerold sich am Stamm einer Buche niederlegte, rollte es sich neben ihm ein, und er erzählte Flocke von früher.
Er erzählte von den Honigplätzchen, die er oft aus der Küche des Grafenhofes stibitzt hatte. Und er erzählte von der Tafel am Abend im Großen Saal, dem Höhepunkt eines jeden Tages. Er hatte an der Stirnseite zwischen seinen Eltern sitzen dürfen, nachdem Mutter ihm den Schmutz aus dem Gesicht gewischt hatte. Eines Abends, als er noch keine zehn Jahre gezählt hatte, war ein fahrender Sänger zu Gast gewesen. Er hatte, begleitet von einer Fidel, das Epos von den Nibelungen vorgetragen, eine Geschichte aus alter Zeit. Viele Abende hatte Gerold an seinen Lippen gehangen, sich jedes Wort gemerkt und bald selbst Geschichten erfunden, natürlich mit sich selbst in der Rolle des Helden, der nie einen Kampf verlor, die Schwachen beschützte − und Adelheids Herz eroberte.
Auf dem Pfad zu ihrem Herzen war er damals tatsächlich weit vorangeschritten: Er pflückte den süß duftenden Goldwurz, verzierte ihn mit einigen Kuckucksblumen und umband sie mit einer roten Schleife. Des Nachts schlich er zu ihrer Kammer, überreichte ihr den Strauß und gestand sogleich, sie habe die schönsten Augen, in die er jemals geblickt habe. Ihre Wangen färbten sich rot, sie hielt die Hand vor den Mund und kicherte. Obgleich sie nur „danke“ hauchte und die Tür verschloss, wähnte Gerold den Augenblick nicht mehr fern, an dem sie ihm die Gunst eines Kusses gewähren würde.
Doch ein Tag hatte alles geändert.
Wulfhardt hatte alles geändert.
Gerold sprang auf. Längst war die Sonne untergegangen, der Buchenstamm vor ihm nur ein Schatten. Er schrie den Stamm an: „Warum meine Familie?“
Flocke sprang auf und davon.
Kurz vor Wulfhardts Überfall war Gerold selbst sterbenskrank darniedergelegen. Hat Walburga ihn nur geheilt, damit er das miterlebte? Er hackte mit der Franziska in den Stamm, immer wieder. Alle Strafen, die ihm in den Sinn kamen, beschwor er auf Wulfhardt herab, bis sein Arm schmerzte. Keuchend ließ er sich nieder.
Wulfhardt.
Fast nichts wusste er über ihn, obwohl er am Grafenhof gewohnt und an der Abendtafel wenige Stühle von ihm entfernt gegessen hatte. Ab und an hatte er sich am Tischgespräch beteiligt, doch an kein einziges seiner Worte konnte er sich erinnern. Wahrscheinlich, so erkannte Gerold, hatte er ihn einfach nicht beachtet. Schon jener missmutige Gesichtsausdruck, mit dem er für gewöhnlich über den Grafenhof gestiefelt war, hatte ihn abgestoßen. Wie viel schöner da die Erinnerungen waren an Vater, an die liebe Mutter, an seine wunderbare Schwester, an die schöne Adelheid, ja selbst an den Priester, der ihm mit viel Geduld die Kirchensprache beigebracht hatte. Mit jedem anderen Knecht am Grafenhof hatte er seine Zeit lieber verbracht als mit Wulfhardt.
Was hatte Wulfhardt dazu getrieben, seine Familie zu morden? Ja, da waren die Stockschläge nach einer Schlacht gegen die Baiern gewesen, ein alter Waffenknecht hatte ihm davon berichtet: Es war Wulfhardts erste Schlacht gewesen, und deshalb hatte ihm sein Vater befohlen, sich am Rande zu halten. Doch übereifrig hatte Wulfhardt sich ins Getümmel geworfen und alsbald von feindlichen Kämpfern umringt gesehen. Schließlich hatte ihn sein Bruder − Gerolds Vater − aus höchster Not gerettet. Vielleicht trug er seitdem Groll in sich? Er musste ein guter Mime sein, dass er den Hass all die Jahre vor seinem Bruder verborgen gehalten hatte, während es in ihm gebrodelt hatte wie in einem Kessel, randvoll gefüllt mit siedend heißem Wasser. Nur einmal war diesem Kessel heißer Wasserdampf entwichen − es war wenige Tage vor dem Überfall gewesen: Nach Gerolds Heilung durch Walburga hatte Graf Gebhard in seiner Grafschaft die Oberhoheit des Papstes anerkennen wollen. Dies hatte Wulfhardt abgelehnt, vor allem, weil er von seinen Pfründen nichts nach Rom abgeben wollte. Bei einem Abendgelage hatten sich die Brüder über diese Angelegenheit ereifert, bis Wulfhardt mit gotteslästerlichen Flüchen auf den Lippen aus dem Saal gestürmt war. Zwei Tage später hatte er den Grafenhof verlassen, um, wie er behauptet hatte, Pfarreien in der Grafschaft zu besuchen. Mit bewaffneten Reitern war er zurückgekehrt.
Als Schnee den Waldboden bestäubte, fand Gerold eine Höhle. Genauer: Flocke fand sie. Das Reh ging hinter ein Gebüsch und verschwand plötzlich, hatte sich durch den Spalt eines mit Moos bewachsenen Felsens in die Höhle gezwängt, ein niedriges Gewölbe, in dem Gerold nur gebückt gehen konnte. Aber hier war es warm, wenn er ein Feuer schürte, während draußen die jungen Fichten unter Schneebergen verschwanden und in den Bächen Eisplatten trieben. Nur zum Wasserholen und zum Wasserlassen ging er hinaus.
Dann, gegen Ende des überlangen Winters, kam der Hunger. Das Wolfs- und Eberfleisch war aufgebraucht, die Beeren sowieso, und unter dem Schnee fand er nichts Essbares mehr. Immer weiter trieb es ihn von der Höhle weg auf der Suche nach Beute. Nur einmal hatte er Glück: Eine Spur im Schnee führte ihn und seine Franziska zu einem Hasen. Doch von seinem Fleisch konnte er nur einige Tage zehren. Rastlos streunte er durch den Wald, es fiel immer mehr Schnee, das Wild schien sich vor ihm verkrochen zu haben.
Gerold merkte: Er hatte seine Kräfte überschätzt. Und er hatte vergessen, ausreichend Vorräte für den Winter anzulegen.
Er trottete zu seinem liebsten Ort im Wald: Aus sieben Quellen, die in einem Halbkreis angeordnet waren, sprudelte Wasser aus dem Waldboden hervor und sammelte sich in einem Teich, der selbst jetzt, im tiefsten Winter, nicht zufror. Er sah in verschneite Baumkronen, neben sich entdeckte er einen Abdruck im Schnee. Er stemmte die Hände auf die Knie und sah genauer hin: Neuschnee hatte die einst tiefen Spuren fast verdeckt, doch es waren eindeutig Spuren von riesigen Pfoten. Gerold starrte sie an. Ein Bär, erkannte er. Ein Bär, der aus der Winterruhe erwacht war. Tage musste es her sein, dass er hier gewesen war, aber Gerold wusste: Der Bär blieb hier in seinem Revier, er musste nur auf ihn warten.
Der Schnee schmolz, und Leberblümchen kündigten den Frühling an, bis es eines Morgens passierte: frische Spuren! Während Gerold sich, vom Hunger gepeinigt, in der Höhle hin- und hergewälzt hatte, war der Bär um die Höhle gestreunt. Er griff den Speer, den er aus Buchenholz geschnitzt hatte, steckte die Franziska, Schwert und Dolch in das Wehrgehänge und folgte den tiefen Spuren, bis er eine Lichtung erreichte, wo der Bär die Rinde vom Stamm einer Eiche kratzte.
Der Frühnebel stieg vom feuchten Boden auf und verfing sich in den Baumkronen. Die ersten Sonnenstrahlen, die auf der Lichtung durch den Nebel drangen, ließen den Frühling erahnen. Gerold legte die Handkante an die Stirn: Der Bär hatte braunes Fell, der Rücken war breit wie ein Heuwagen.
Dafür ist er nicht so wendig, redete Gerold sich ein. Er musste sich nur an ihn heranschleichen. Wie um ihn zur Eile zu drängen, grummelte sein Magen.
Er brauchte das Bärenfleisch. Jetzt.
Er setzte Fuß vor Fuß. Jetzt nur nicht auf einen Ast treten.
Er stand zehn Schritte hinter ihm, da stellte der Bär die halbrunden Ohren auf. Schwerfällig tapste er auf mächtigen Pranken zu ihm herum, schnaubte, eine weiße Atemwolke dampfte aus dem Maul, er fixierte Gerold mit schwarzen Äuglein.
Ein eisiger Finger legte sich auf Gerolds Halswirbel, wie damals, mit vierzehn Jahren, als er seinen ersten Auerochsen erlegt hatte. Und doch war jetzt alles anders: Heute kämpfte er ums Überleben, damals hatte er Ansehen errungen, zur Belohnung das erste Schwert aus den Händen seines Vaters erhalten.
Sie standen sich gegenüber, keiner bewegte sich. Der Bär legte die Ohren zurück, er zog die Lefzen hoch, die Eckzähne funkelten Gerold entgegen. Ein Muskelberg türmte sich auf den Schultern. Gerolds leerer Magen gab das Signal zum Angriff: Er schleuderte die Franziska. Im letzten Augenblick zuckte der Kopf des Bären aus der Flugbahn, das Beil grub sich hinter ihm in den Waldboden, der Bär stieß wütendes Gebrüll aus.
Gerold sprang auf ihn zu, den Speer voran.
Der Bär stellte sich auf die Hinterbeine, er knurrte tief und zeigte ihm die fingerlangen Krallen, die aus den behaarten Ballen hervorblitzten. Er überragte Gerold um mehrere Köpfe, doch für die Flucht war es zu spät. Gerold flog auf ihn zu. Er zielte mit der Speerspitze nach oben, er musste den Bären in die Gurgel treffen.
Mit den Vorderpranken schlug der Bär den Speer weg, als würde eine lästige Fliege vor seinem Gesicht schwirren.
Die Wucht warf Gerold auf den feuchten Boden, er rollte zur Seite, überall klebten feuchte Blätter am löchrigen Hemd, das Herz schlug ihm bis zum Hals. Er rappelte sich auf, schützend hielt er den Speer vor das Gesicht.
Wer war der Jäger, wer der Gejagte?
Der Bär stürmte, nein, er rollte auf Gerold zu wie ein riesiges Gebirge. Die Zähne zielten auf seinen Hals.