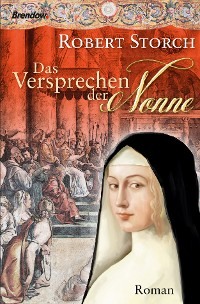Kitabı oku: «Das Versprechen der Nonne», sayfa 5
Im letzten Augenblick sprang Gerold zur Seite, der Bär stürmte ins Leere. Mit einem Satz stand Gerold hinter ihm und rammte den Speer in das zottelige Fell auf dem Rücken.
Der Bär brüllte, riss sich los und rannte davon. Gerold blieb zurück, in der Hand den Speer, besudelt mit Bärenblut. Er verfolgte den Bären, der Waldboden raste unter ihm hinweg, Baumwurzeln brachen aus ihm heraus. Sein ausgemergelter Körper ächzte, Schweiß tropfte ihm von der Stirn, dann – endlich – wurden die Schritte des Bären träger. Die Vorderpranken knickten ein, das Blut quoll aus dem Rücken, rann an der Seite hinab, tropfte auf den Boden.
Vorsicht, dachte Gerold. So sind sie am gefährlichsten!
Mit seinen letzten Bärenkräften stürzte sich das Tier auf Gerold.
Gerold sprang weg, der Bär schlug mit den Tatzen nach ihm. Gerold spürte den Windhauch im Gesicht. Blind stach er mit dem Speer zur Seite, er hatte Glück: Wieder bohrte er sich ins Bärenfleisch, wieder brüllte der Bär, dieses Mal brachte er die Äste zum Zittern. Dann wurde das Brüllen zu einem Röcheln, er fiel auf die Seite. Ein letzter Stich in die Gurgel, und seine Zuckungen erstarben.
Gerold ließ sich auf den Waldboden sinken, langsam beruhigte sich sein Atem.
Mit seinen letzten Kräften zog er den Bär zur Höhle, schürte ein Feuer, schnitt mit dem Dolch ein mächtiges Stück von der Schulter ab, briet es und schlang es herunter. Er schlief. Als er aufwachte, fühlte er sich wie neugeboren. „Ich habe einen Bären erlegt!“, rief er, zwischen den Baumstämmen tanzend. „Ich habe ihn besiegt! Einen Bären, groß wie zwei Ochsen!“
Er schlenderte durch den Wald zu seinem Lieblingsplatz: Vor ihm gluckerte das Wasser von sieben Quellen aus dem Waldboden hervor und floss zu dem in der Sonne glitzernden Teich zusammen. Von dort strudelte es leise plätschernd den Hang hinab, bis es hinter einer Biegung verschwand. Über ihm zwitscherte ein Buchfink.
Gerold trat an den Teich, sodass er sein Gesicht darin sehen konnte. Die blonde Strähne strahlte wie eh und je zwischen seinen braunen Haaren hervor, doch das Gesicht darunter hatte sich verändert in den letzten Monaten: Hager war es geworden, und ernster. Vielleicht trauriger. Der Überfall hatte ihn verändert. Seither hatte er nur Trauer, Wut und Verzweiflung gespürt. Und Hoffnungslosigkeit. Und Angst. Doch jetzt, mit gefülltem Magen, der Euphorie über seinen Sieg gegen den Bären in den Gliedern und den Sonnenstrahlen auf der Haut − da keimte in ihm zum ersten Mal wieder Hoffnung auf. Zum ersten Mal seit dem Überfall schlich sich der Gedanke in seinen Kopf, dass es wieder werden könnte wie früher. Dass er nicht machtlos war, sondern stark. Konnte jemand, der einen Bären erlegte, es nicht mit jedem aufnehmen?
Gerold starrte auf sein Ebenbild im Teich, doch vor seinem inneren Auge lief der Überfall ab: der Pfeil in der Brust seines Vaters, der Reiter hinter seiner Schwester, seine Machtlosigkeit im Verlies. Bisher hatten diese Erinnerungen ihn traurig und wütend werden lassen, jetzt spornten sie ihn an. Entschlossen verjagte er die Erinnerungen und krallte die Hand fest um den Griff der Franziska. Er würde seine Familie rächen, würde den Mörder seiner Familie zur Strecke bringen. Und er würde Graf sein, wie es seine Bestimmung war. Noch heute würde er das Werk beginnen, nahm er sich vor. Er würde an den Grafenhof zurückkehren. Er hielt inne. Nein, unmöglich! Allein der Gedanke an eine Rückkehr zum Grafenhof ließ sein Herz vor Panik schneller schlagen.
Ein Glitzern an seinem Finger lenkte den Blick auf den Siegelring, den einst sein Vater getragen hatte. Er fragte sich, was Vater sagen würde, sähe er ihn jetzt. Wie er sich seit einem halben Jahr im Wald versteckte. Würden seine Augen immer noch voller Stolz auf ihm ruhen? Er hielt den Siegelring in die Sonne. Nein, er konnte sich nicht länger verstecken. Er musste sein Erbe einfordern. Das wäre Vaters Wille.
Er zog den Dolch aus der Scheide und wanderte, gemächlich einen Fuß vor den anderen setzend, zum Waldrand, auf den Grafenhof zu, vor dem er in den letzten Monaten immer geflohen war. War der Grafenhof noch verwaist, nachdem alle Bewohner ermordet worden waren? Oder waren wieder Menschen in die Wirtschaftsgebäude eingezogen, vielleicht sogar in das Wohnhaus der Grafenfamilie? Auf einer Anhöhe endete der Wald, mit dem Rücken zum Grafenhof lehnte er sich gegen den Stamm einer Birke, das Herz raste. Flocke trabte heran.
„Soll ich es tun?“, fragte Gerold ihn.
Der Wind trug aufgeregte Stimmen vom Grafenhof zu ihm herauf.
Flocke entdeckte ein Hexenkraut und trabte dorthin.
Tief schnaufte Gerold durch. Er klemmte den Dolch zwischen die Zähne, fasste den Birkenast über sich und zog sich hoch, dann weiter zum nächsten Ast und wieder zum nächsten, bis er sich, zehn Schritte über dem Boden, setzte. Sich mit beiden Händen an den Ast klammernd, drehte er die Augen zum Grafenhof. Auf einem schwarzen Pferd ritt ein Mann hinein. Er trug einen schwarzen Mantel, der von einer goldenen Spange geschlossen wurde. Die Waffenknechte und Bediensteten verneigten sich vor ihm.
Vor ihm wurde die goldene Lanze des Grafen hergetragen.
Wulfhardt!
Für einen Augenblick wich jede Spannung aus Gerolds Muskeln, der Dolch rutschte aus dem Mund, die Hände lösten sich vom Ast. Hastig versuchte er, den Ast wieder zu fassen − zu spät: Der Waldboden flog auf ihn zu. Das Letzte, was Gerold wahrnahm, war sein eigener spitzer Schrei.
Süßes Erwachen
4. KAPITEL
Gestern war Michal bereits mit ihren Mädchen in den Wald gezogen. Sie hatte mithilfe eines Steins einen kurzen, angespitzten Stecken schräg von unten in die weiße Birkenrinde geschlagen. Sofort war der Saft herausgeronnen, der jedes Jahr im Frühling zwei Wochen lang durch die Birkenstämme floss. Sie hatte einen kleinen Eimer um den Zapfhahn gebunden, um ihn aufzufangen. Die Schülerinnen hatten jeden ihrer Handgriffe verfolgt, denn diese Methode, eine der köstlichsten Gaben Gottes zu empfangen, war in Heidenheim unbekannt gewesen. Bis zur Non hatte jedes Mädchen seinen eigenen Eimer aufgestellt, in den der Birkensaft tröpfelte.
Heute war Michal bereits nach der Prim in den Frühlingswald gezogen. Jetzt freute sich die junge Meute über den süßlichen Saft, der sich in den Eimern angesammelt hatte.
Michal ermahnte sie, nicht mehr als die Hälfte ihrer Ernte zu trinken, denn sie wollten die Früchte ihrer Arbeit mit den Mönchen teilen, die seit Tagen hart arbeiteten.
Von widerwilligem Gemurmel begleitet setzten die Mädchen ab und folgten Michal den Abhang hinunter durch den Wald, sprangen über einen Bach und standen neben der Lichtung, auf der die Mönche schaufelten, Eimer schleppten, schwitzten und fluchten, während sie den ersten Fischweiher des Klosters aushoben. Nur Goumerad stand im Schatten, auf dem schmalen Streifen zwischen Grube und Bach, durch den der Zufluss zum Fischweiher gelegt werden sollte. Seit dem Lichtwunder hatte der Prior jeden Gottesdienst pflichtschuldig gehalten und die Nonnen in ihrer ausdauernden Arbeit auf dem Acker Gottes nicht aufgehalten. Sogar als Walburga die Mönche angewiesen hatte, den Fischweiher auszuheben, hatte er kein Widerwort erhoben. So lebten Mönche und Nonnen friedlich nebeneinander, wie es sich für eine klösterliche Gemeinschaft geziemte. Auch um diese Gemeinschaft zu stärken, war Michal jetzt hier.
Goumerads Blick streifte die Nonne kurz, dann sah er über sie hinweg auf die Mädchen und grummelte abschätzig: „Was tut ihr hier?“
„Wir bringen den erfrischenden Saft der Birke sowie einige Brote für Euch und eure Männer. So möchten meine Schülerinnen und ich uns bedanken für die harte Arbeit, die ihr für unser Kloster verrichtet.“
„So, so.“
Die Mönche tranken dankbar den Birkensaft und schnitten sich dicke Stücke von den Broten ab. Michal sorgte dafür, dass jeder seinen Teil bekam. Nach allen Seiten blickte sie sich um, doch wann immer sie sich in eine Richtung drehte, wandten die Mönche schnell den Blick von ihr ab. Bald meinte Michal, sie werde von allen Seiten angestarrt. Was war an ihr so besonders? Sie gewahrte, dass sie seit ihrer Kindheit Männern nie mehr so nahe gewesen war wie jetzt, mit Ausnahme ihres Vaters. Vielleicht war es doch eine gute Idee von Mutter gewesen, sie vor den Männern zu schützen. Denn sie waren ihr unheimlich.
Sie bekreuzigte sich unwillkürlich, als die Mönche ihr Mahl beendet hatten und wieder in die Grube kletterten. Dabei wechselten sie leise Worte, plötzlich lachten sie laut heraus. Michal spürte ihre Ohren heiß werden, denn irgendetwas sagte ihr, dass sie es war, über die die Mönche lachten. Sie fand es ungehörig, dass sie ihr nicht sagten, was sie falsch gemacht hatte. Dabei hatte sie ihnen mit dem Birkensaft nur eine Freude bereiten wollen! Sie sprang über den Bach und stapfte die Anhöhe hinauf, bis die Mädchen quengelten, sie sei zu schnell.
In Heidenheim wurde schon zur Terz gerufen. Nach dem Gebet wurden die Mädchen von Walburga in die Heilige Schrift eingewiesen, zuvor jedoch schickte Walburga Michal und fünf weitere gottgeweihte Jungfrauen zum ehemaligen Heidendorf auf der Lichtung, nicht ohne sie zu ermahnen, bis zur Sext wieder zurück zu sein, weil das Gebet die wichtigste Aufgabe einer gottgeweihten Jungfrau sei. „Es tut mir leid, Schwester Michal“, sagte Walburga, „dass du nicht öfter in der Schreibstube die Feder führen kannst, denn der Herr hat dich gesegnet mit einer feinen Schrift und einem guten Verständnis der Texte. Doch der Herr hat uns wenigen Nonnen viele Aufgaben anvertraut.“
Michal versicherte, sie erfülle jede Aufgabe mit Freude, und machte sich zusammen mit ihren Gefährtinnen auf den Weg durch den Wald.
Auf der Lichtung trafen sie auf eine zahnlose, beinahe blinde Frau. Als einzige Bewohnerin hatte sie die Lichtung nicht verlassen, weil sie nirgendwo anders sterben wollte als dort, wo sie ihr ganzes Leben zugebracht hatte, auch wenn die Hütten verfielen und eine im Winter gar unter der Schneelast zusammengebrochen war. Die Nonnen beteten mit ihr.
Michal hielt im Gebet inne, ihr Kopf, eben noch demütig gesenkt, zuckte nach oben, der Blick huschte zum Wald, der jene Lichtung umsäumte, auf der sie einst auf Wulfhardt getroffen war.
Sie hatte einen Schrei gehört. Kurz zwar, aber spitz.
Doch die fünf gottgeweihten Jungfrauen, die Walburga mit ihr zur Lichtung geschickt hatte, beteten weiter, also fiel auch sie hastig wieder ein in das Pater noster, bis das „Amen“ erklungen war.
Michal fragte: „Habt ihr das gehört?“
„Was?“, rief Rosweidis mit hoher Stimme, die Augen weit aufgerissen. Sie war vierzehn Jahre lang auf dieser Lichtung aufgewachsen, war zusammen mit den anderen Heiden von Willibald, dem tapferen Streiter des gütigen Gottes getauft worden und anschließend in das Kloster eingetreten.
„Wenn ich mich recht entsinne“, sagte Michal, „dann hat jemand geschrien, irgendwo dort im Wald, der uns vom Grafenhof trennt.“
Ihre Schwestern beteuerten, nichts gehört zu haben.
Michal lauschte, doch sie hörte nur einen Spatz, der über ihnen mit wilden Flügelschlägen gen Sonne flatterte und ein Frühlingslied tschilpte. „Wahrscheinlich habe ich mich verhört“, sagte sie. Vielleicht war nur das kurze Bellen eines Hirsches oder eines Wolfswelpen an ihre Ohren gedrungen.
Sie nahm das Brot aus dem Beutel, tunkte es in Wasser und gab es der Frau in den Mund. Nachdem diese das Brot gemümmelt hatte, reichte Aebbe ihr mit Schlehenblüten aufgegossenes Wasser, dem Walburga noch den Saft der Anemone zugesetzt hatte, um das Augenleiden zu lindern.
„Seht!“, rief Eadburga und deutete zum Waldrand, gerade als die Sonne über die hohen Buchen gestiegen war und auch den letzten Winkel der Lichtung beschien. Ein Tier brach aus dem Wald hervor, machte vier große Sätze in ihre Richtung, sprang zwei Mal auf der Stelle, kehrte um und blieb am Waldrand stehen. Michal glaubte ihren Augen nicht: Gott hatte dieses Tier zwar in der Form eines Rehs erschaffen, jedoch mit weißem Fell überzogen.
Erst der Schrei, jetzt dieses weiße Reh. „Das Tier will uns etwas zeigen! Wir sollten ihm folgen.“
Frideswide und Aebbe, betreten zu Boden blickend, fürchteten sich davor, in den Wald einzudringen. Aebbe hatte sich schon auf dem Weg zur Lichtung immerzu umgesehen wie ein Igel, der jederzeit damit rechnet, sich zu einer Kugel zusammenrollen zu müssen. Michal fragte sich, warum ihre Freundin so wenig auf die schützende Hand Gottes vertraute, so wie damals, als er sie durch den schweren Sturm hindurch über das Meer geleitet hatte.
Eadburga und Hilda, unschlüssig zum weißen Reh blickend, schienen zu erforschen, was es ihnen zeigen wollte. Michal nahm sich vor, auf das Urteil der beiden Nonnen zu vertrauen, denn sie folgten Walburga schon viel länger als sie selbst.
Rosweidis, ängstlich in den Wald blickend, rief: „Wir müssen bis zur Sext zurück sein. Und Walburga hat uns nicht erlaubt, weiter zu gehen als bis zu dieser Lichtung. Und dort, wo das Reh hin will, liegt der Grafenhof!“
Michal verstand Rosweidis’ Angst, war doch einst Wulfhardt aus jener Richtung gekommen, um ihr Dorf zu überfallen. Sie sagte: „Liebe Schwestern, vertrauen wir in Gott! Jesus könnte uns in Gestalt dieses wundersamen Rehs begegnen. Was, wenn wir ihm jetzt nicht folgen?“
Der Spatz hörte auf zu tschilpen.
Eadburga ergriff das Wort: „Wir können Gottes Wege nicht ergründen. Aber da war dieser Schrei, den Michals Gehör vernahm, und jetzt das Reh. Mir scheint, als erfordere dort im Wald etwas unsere Aufmerksamkeit.“
Hilda hatte längst die Stirn in Falten gelegt, wie immer unglücklich, wenn die Schwestern nicht einer Meinung waren. „Dann soll Rosweidis hier auf dieser Lichtung warten und die Frau, die uns zur Pflege anvertraut ist, waschen, wie Walburga es uns aufgetragen hat. Und wir anderen sehen nach, was uns das weiße Reh zeigen will.“
Eadburga und Michal nickten. „So sei es.“
Frideswide und Aebbe erhoben keinen Widerspruch, mit einigen Schritten Abstand folgten sie den drei Nonnen zum Waldrand. Das weiße Reh führte sie durch Brombeergestrüpp und über verstreute Felder von Schlüsselblumen, die ihre gelben Blüten geöffnet hatten, weiter in den Wald hinein. Schließlich erspähte Michal Licht am Ende des Waldes, dahinter lag vermutlich der Grafenhof. Hatte das Reh sie in die Irre geführt, in eine Falle gar? Wartete dort Wulfhardt mit seinen Schlächtern? Michal zögerte, auch die anderen Nonnen hielten inne.
Das Reh erreichte den Waldrand. Mit seiner rosa Stupsnase schnupperte es am Boden.
„Da liegt etwas!“, rief Michal und marschierte voran, bis sie sah, was das Reh beschnupperte: einen Knaben.
Er lag auf der Seite, das bleiche Gesicht nach oben gedreht, die Augen geschlossen, aus dem Mund hing die Zunge heraus. Die anderen Nonnen erschraken und traten einen Schritt zurück, Michal beugte sich zu ihm hinunter. Ein magerer Knabe, doch die breiten Schultern zeugten davon, dass er einmal kräftiger gewesen war. Sein Rock endete an den Knien in einem Saum und war aus feinem Wollstoff gewebt, inzwischen jedoch arg zerschlissen, Blätter klebten daran. Am Ringfinger prangte ein Ring mit eingraviertem Eber. Die Haare fielen vom Mittelscheitel zu beiden Seiten hinunter, anfangs glatt, ab den Ohren in kleinen Wellen, und am Ende, über den Schultern, kringelten sie sich zu Locken. Michal strich ihm eine blonde Strähne aus der Stirn, die sich mitten unter seine hellbraunen Haare geschmuggelt hatte.
Sie tastete seinen Hals ab und fand den Herzschlag. „Er lebt. Bringen wir ihn ins Kloster.“
Frideswide blickte auf den Jüngling herab, als betrachtete sie eine Erdkröte. „Es ist uns verboten, einen Mann zu berühren. Außerdem werden wir schwerlich Heidenheim zur Sext erreichen, wenn wir ihn tragen. Sollen die Mönche ihn holen.“
„Wir können ihn doch hier nicht liegen lassen!“, brauste Michal auf, die geziemende Ruhe vergessend. „Ein wildes Tier könnte ihn töten. Die Rettung eines Menschen ist ein gottgefälliges Werk, schließlich hat Gott diesen Knaben erschaffen. Also lasst uns Gottes Schöpfung retten!“
Eadburga, Hilda und Aebbe stimmten ihr zu, und gemeinsam hoben sie ihn hoch. Dabei löste sich etwas aus seinem Gürtel und fiel hinunter: ein Beil, die Oberkante des Blattes s-förmig geschwungen, die Unterkante einen einfachen Bogen beschreibend, die Schneide rot gefärbt. Michal erschrak, schnell steckte sie das Beil in ihren Beutel.
Wulfhardts Waffenknechte trugen in ihrer Mitte das Reh, das er gerade erlegt hatte, an den Seiten hechelten die Jagdhunde. Eine erfolgreiche Jagd, auf der er seine Albträume vergessen hatte. Doch heute Nacht würden sie zurückkehren: Seit der Ermordung seines Bruders, nachdem das erste Triumphgefühl verflogen war, raubten sie ihm beinahe jede Nacht den Schlaf. Oft erschien sein Bruder als Untoter, den Pfeil noch in der Brust, mit den Armen nach ihm greifend. Einmal hatte er mitten in der Nacht an die Tür des Schlafgemachs geklopft. Wulfhardt war kopfüber aus dem Fenster gestürzt, kurz darauf hatte es im Schlafgemach gerumpelt. An die Hauswand gekauert, hatte er bis zum Sonnenaufgang ausgeharrt. Mehr denn je trieb ihn seitdem die Angst um, für den Brudermord bestraft zu werden. Vielleicht durch Gerolds Hände? Wahrscheinlich hatte Gebhards Geist Gerold aus dem Verlies befreit, um seinen Tod zu rächen. Doch warum verstrich Tag um Tag, ohne dass er etwas von Gerold sah oder hörte?
Er gelangte auf einen Pfad, der sich drei Meilen lang durch den Wald bis zum Grafenhof schlängelte. Er schlug seinem treuen Ross auf den Hals, auch heute hatte es ihm aufs Wort gehorcht und zum Erfolg der Jagd beigetragen. Er überlegte, dass diese Eigenschaft ein Pferd wesentlich von einem Weib unterschied. Ein Weib gehorchte nicht, es hatte nur seine eigenen Wünsche im Sinn, dies wusste er seit der Schmach, die Hildegard ihm zugefügt hatte. Nein, ein Weib vermisste er seither ganz und gar nicht. Er schob die mühseligen Gedanken von sich und genoss für den Rest des Weges seinen Jagderfolg.
Plötzlich fiel sein Blick auf etwas Schimmerndes. Er zügelte den Hengst. Der Wald endete hier auf dieser Anhöhe, von der aus er seinen Machtsitz erspähen konnte. Er stieg ab und beugte sich, die Hände auf die Knie gestützt, zu dem schimmernden Ding hinunter. Es war ein Dolch. Während er ihn aufhob, erkannte er Spuren im Boden, die zurück in den Wald führten. „Siehst du die Spuren?“, fragte er Hroutland.
„Ja, Herr. Sind schon etwas verwittert, wahrscheinlich ein, zwei Tage alt. Müssen mehrere gewesen sein, mindestens drei. Haben Holzschuhe getragen, ziemlich kleine, wahrscheinlich Frauen.“
Wulfhardt kratzte sich mit dem Dolch hinter der Ohrmuschel. Was machten Frauen so nah an seinem Machtsitz mit einem Dolch? „Wir folgen den Spuren“, entschied er und stieg auf, die Pfunde verfluchend, die er den ausgiebigen Gelagen der letzten Monate verdankte.
Mit jedem Schritt, den der Hengst durch den Wald trat, verfestigte sich ein Verdacht, und als er den Hengst zügelte, nickte er: Vor ihm, im vom Gießbach durchflossenen Tal, lag Heidenheim. Es wurde zum Gebet gerufen. Von Norden trotteten die Mönche vom Klosterhof aus Richtung Kirche, südlich der Kirche traten die verschleierten Jungfrauen aus dem Kloster, der Äbtissin folgend, aufgereiht wie Küken hinter der Henne. Wulfhardt bedeutete dem schmächtigsten Waffenknecht, seine Rüstung abzulegen und den Spuren nach Heidenheim zu folgen.
Als dieser zurückkehrte, meldete er: „Die Spuren führen zum Nonnenkloster, Herr.“
In Wulfhardt keimte der Wunsch auf, das Kloster niederzubrennen. Was suchten die Nonnen in der Nähe seines Machtsitzes? Warum hatten sie einen Dolch dabei? Am liebsten wäre er mit gezücktem Schwert in die Kirche gestürmt und hätte Walburga zur Rede gestellt. Doch Walburga stand nach dem Lichtwunder überall in hohem Ansehen, auch bei seinen Waffenknechten. Er kehrte um, darüber grübelnd, wie er Walburga zur Strecke bringen könnte.
Zurück am Grafenhof wartete sein Haushofmeister Drogo mit einer Nachricht: „Herr, der Sohn des Kochs ist am Fieber gestorben.“ Drogo verkündete dies im gleichen Tonfall, mit dem er seinem Herrn mitteilte, einem Dorf zwei Wagenladungen Weizen weniger als im letzten Jahr abgepresst zu haben. Wulfhardt schätzte es, dass sein Haushofmeister sich nicht von Gefühlsduselei leiten ließ. Wer sich von Gefühlen leiten ließ, der machte Fehler − das wusste er nur zu gut seit der Schmach mit Hildegard. Deshalb war er überzeugt, dass Drogo ein guter Verwalter war. Trotzdem musste er ihn regelmäßig kontrollieren, denn er vertraute grundsätzlich niemandem. Denn wie jeder Mensch, so hatte auch Drogo Schwächen. In seinem Fall war dies sein zwölfjähriger Sohn − der einzige Mensch, der ihm etwas zu bedeuten schien. Er stand auch jetzt an seiner Seite und blickte ihn aus eng beieinanderliegenden Augen an. Wie bei seinem Vater schienen die Augen auf die Nasenspitze zu schielen.
„Lass uns das im Großen Saal bereden“, brummte Wulfhardt. Er stapfte voran. Nach dem Brand hatte er ihn, getreu dem Vorbild des Vorgängerbaus, neu errichten lassen: Der an einer Querstange hängende Kessel über der Feuerstelle wurde durch die Dachöffnung hindurch von der Sonne beschienen. Die Plätze am Tisch, zu denen sich Wulfhardt, Drogo und dessen Sohn begaben, mussten jedoch von Öllampen erhellt werden. Wulfhardt setzte sich an die Stirnseite des Tisches. „Dem Müller, der mich bestohlen hat, lässt du die rechte Hand abhacken“, beschied er. „Diese Hand wird mich nicht mehr bestehlen.“
„Ja, Herr.“ Drogo räusperte sich. „Heute Morgen kam Walburga hierher.“
Wulfhardt fuhr hoch. „Was?“
„Sie wollte die kranken Kinder sehen. Hat behauptet, dass sie ihnen helfen will. Ich habe sie fortgeschickt.“
„Gut gemacht“, murmelte Wulfhardt, während er sich wieder setzte und dabei die Hände zu Fäusten ballte, um das leichte Zittern in seinen Fingern zu verbergen.
Erst die Spuren im Wald, die zum Nonnenkloster führten, jetzt kam Walburga sogar am hellichten Tag zu seinem Machtsitz spaziert. Was führte sie immerzu hierher? Er spürte ein Drücken in den Eingeweiden. Walburga machte ihm Angst. Niemals hätte er es zugegeben, aber es war so. Jeder hatte beim Lichtwunder gesehen, dass sie in der Gunst des mächtigen Christengottes stand. Diese Frau hatte man besser nicht zur Feindin. Und sie hatte allen Grund, ihn zu verfluchen.
Wulfhardt versuchte, mit ruhiger Hand Wein in den Trinkpokal zu schenken. Er setzte ihn an und ließ den Wein langsam in seine Kehle laufen. Als er ihn absetzte, fühlte er sich besser. „Und die anderen Kinder sind noch krank?“
„Ja, Herr.“
„Hm“, brummte Wulfhardt. Seit einigen Wochen griff die Krankheit um sich. Kinder bekamen Bauchfluss mit Blut und Schleim, gefolgt von Fieber und Bauchschmerzen. Bisher hatte er sich darüber nicht den Kopf zerbrochen. Kinder wurden nun mal oft krank und starben. Doch wenn nun ein Kind an dieser Krankheit gestorben war, konnten bald weitere Kinder folgen. Und dies, gewahrte er jetzt, könnte sich zu einem Problem für ihn auswachsen: Die Menschen würden munkeln, dass es so etwas früher in der Grafschaft nicht gegeben habe, geschweige denn am Machtsitz des Grafen. Er sog die Luft durch die Nasenlöcher ein und vernahm den Geruch der Urinbottiche, die hinter dem Großen Saal standen, gut gefüllt von den Zechern der letzten Tage. Er setzte den Trinkpokal an die Lippen und stellte ihn erst nach drei tiefen Zügen wieder ab. Was ist jetzt anders als früher am Grafenhof?, überlegte er. Ihm fiel nichts ein. Nein, die Krankheit musste durch Mächte verbreitet worden sein, die er nicht bemerkte. Mächte, über die Walburga verfügte.
Wulfhardt kramte den Dolch hervor, den er im Wald gefunden hatte, und bohrte die Spitze der Klinge vor sich in den Tisch. Seit er das Licht im Nonnenkloster gesehen hatte, wusste er um die Macht des Christengottes. Seitdem hatte er vieles getan, um die Gunst dieses Gottes zu erlangen: Zweimal am Tag zelebrierte er die Heilige Messe, für den Altar in der Kapelle des Grafenhofs hatte er einen goldenen Kelch aus einem Römergrab gestiftet. Er zog den Dolch aus dem Tisch, hob den Arm über die Schulter und warf den Dolch hinunter. Er drehte sich einmal in der Luft, dann schlug die Spitze im Tisch ein. Zürnte ihm der Christengott immer noch? Oder hatte Walburga die Krankheit heraufbeschworen mit ihren Zauberkräften? Er legte die Hand um den Dolchgriff, als er die Gravur auf der Klinge bemerkte: ein Eber.
Das Zeichen der Grafenfamilie!
Wulfhardts Hand zuckte vom Dolch weg, als hätte er an glühendes Eisen gefasst. Ein Schrei entfuhr ihm, er sprang auf.
Gerold!
Der Dolch konnte nur von Gerold sein!
„Herr?“ Drogos Stimme schien aus weiter Ferne an seine Ohren zu dringen. „Geht es Euch nicht gut?“
„Nein, nein“, stammelte Wulfhardt, die Hände um das Kreuz seiner Halskette gekrallt, als wollte er es mit bloßen Händen zermalmen. Er sank auf den Stuhl und blickte über den Dolch hinweg.
Er wusste nicht, wie lange er da gesessen hatte, bis Drogos Räuspern ihn aus der Erstarrung riss.
Wulfhardt fragte: „Starb der Sohn des Kochs nach ihrem Besuch?“
„Ja, Herr.“
„Dachte ich mir.“ Er nickte, seine eigene Stimme erschien ihm fremd. „Es fügt sich alles zusammen. Gerold, er steckt mit den Nonnen unter einer Decke. Sie waren es, die ihn aus dem Verlies befreiten. Und Walburga hat im Namen des Christengottes die Krankheit heraufbeschworen. Sie will mir schaden, um Gerold auf den Grafenthron zu helfen. Deshalb kommt sie an meinen Machtsitz: So wirkt ihr verderblicher Zauber am besten. Darum ist kurz nach ihrem Besuch der Sohn des Kochs gestorben.“
Eine Hitzewelle stieg ihm von den Gedärmen bis zur Kehle. Gerold! Dieser Angeber! Schon als Kind hatte er in allem der Beste sein wollen, wie sein Vater. Ausgerechnet an der Seite der wundertätigen Walburga!
„Drogo!“, rief Wulfhardt. Seine Stimme klang gefestigter, als er sich fühlte. „Instruiere Goumerad: Er soll nach einem jungen Mann Ausschau halten, der sich in Heidenheim versteckt. Er erkennt ihn an einer blonden Strähne inmitten seiner braunen Haare.“
„Ja, Herr.“ Drogo und sein Sohn erhoben sich zeitgleich.
Wulfhardt griff zum Beutel mit den Eibennadeln an seinem Gürtel. Am liebsten hätte er jetzt gleich Gerold das Gift eingeflößt und zugesehen, wie er mit gelähmten Gliedern und vom Brechreiz gepeinigt das Leben aushauchte.
Alles fühlte sich bleischwer an, als Gerold erwachte: die Beine, die Arme, die Augenlider. In seinem Kopf hämmerte ein Schmied und verwendete dabei die Schädeldecke als Amboss. Er fürchtete, der Schmied würde stärker hämmern, wenn er die Augen öffnete, also hielt er sie geschlossen. Irgendetwas Feuchtes umwickelte seinen Fuß.
Gerold versuchte, sich zu erinnern − und sah Wulfhardt: wie er in den Grafenhof einritt, in den Händen die goldene Lanze des Grafen. Danach wusste er nichts mehr. War er vom Baum gefallen, von dem aus er Wulfhardt beobachtet hatte? Wahrscheinlich. Danach hatte jemand seinen Fuß behandelt. Aber wer? Wo war er? Die einzig mögliche Antwort raubte ihm die Luft zum Atmen: am Grafenhof.
Gerold hörte einen Riegel, der zur Seite geschoben wurde, und eine Tür öffnete sich. Er hielt die Augen geschlossen und versuchte, trotz seines rasenden Herzschlags ruhig und gleichmäßig zu atmen.
Schritte näherten sich.
Er war wehrlos − wie beim Überfall.
Die Schritte verstummten neben ihm. Eine Mädchenstimme erhob sich. Sie murmelte in der Kirchensprache, wiederholte stets die gleiche Formel, abgeschlossen mit einem „Amen“, wie einst Walburga während seines Fiebers neben dem Bett. Doch es war nicht Walburgas Stimme, diese Stimme klang wie die seiner Schwester.
Gerold nahm sich vor, nur zu blinzeln. So, dass sie es nicht bemerkte. Er hob das schwere, rechte Augenlid. Was er sah, ließ ihn auch das linke Auge aufreißen.
Seine Schwester! Sie stand neben ihm.
Die kindlichen Pausbacken. Und die vollen Lippen, darunter eine Einkerbung.
Alle Schmerzen verschwanden. Alles − vom Überfall bis zum Sturz vom Baum – war nur ein böser Traum.
„Schwesterherz“, sagte er und lächelte.
Da bemerkte er den schwarzen Schleier, der die hohe Stirn zur Hälfte bedeckte und von dort zu den Schultern herabfiel, wo er in einem weißen Rand endete; unter dem Schleier umschloss eine weiße Haube Hals und Ohren. Eine Tunika aus grobem Wollstoff wurde an den Hüften von einem Gürtel umschlossen, an ihm hing ein Wachstäfelchen mit Griffel.
Seine Schwester konnte nicht schreiben. Und sie trug keinen Schleier. Außerdem ragte ihr Philtrum nicht so weit in die Oberlippe hinein wie bei diesem Mädchen; auch meinte er jetzt, dass sie einige Jahre älter sein musste als seine Schwester.
Alles krampfte sich in ihm zusammen. Ohne es zu wollen, entfuhr ihm ein Schrei, mit der rechten Faust schlug er neben sich auf das Strohbett. Schmerz zuckte durch die rechte Seite, der Schmied im Kopf hämmerte kräftiger.
Sie hielt ihm eine Schale Wasser unter den Mund.
Er drehte sich weg.
Sie umgriff seinen rechten Arm und sagte etwas, doch es dauerte, bis ihre Worte zu ihm drangen. „… Name?“, verstand er.
Er schwieg. Er konnte seinen Namen nicht preisgeben, ohne zu verraten, dass er der Sohn des Grafen ist. Und wenn das Wulfhardt zu Ohren bekäme …
„Woher kommst du?“, fragte die Nonne weiter. Ihr Akzent erinnerte an Walburga. Am Grafenhof sprach niemand so. War er doch nicht am Grafenhof? Oder waren die Nonnen aus Heidenheim an den Grafenhof gekommen? Aber Wulfhardt betrachtete sie, die Vertreter der römischen Kirche, doch als Feinde! Er ließ den Blick durch den Raum kreisen. Neben seinem Bett standen zwei weitere Betten, in einem davon döste ein Mann, dessen graue Haare eine Tonsur formten. Über den Betten fiel ein wenig Licht durch schmale Fenster in den kleinen Raum. Er kannte diesen Raum nicht. Vielleicht hatte Wulfhardt ihn nach dem Brand errichtet, denn er schien neu zu sein: Der frische Geruch nach Eichenholz erinnerte ihn an den Wald, die Blockbohlen waren noch hell, in keiner Ecke entdeckte er Spinnweben, kein Staubkorn bedeckte sein Laken.