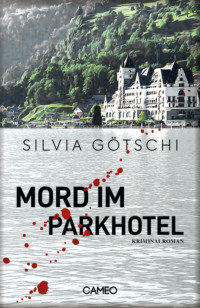Kitabı oku: «Mord im Parkhotel», sayfa 5
„Sie hat neue Kleider getragen“, sagte Daniel, „aus denen die Etiketten herausgetrennt sind.“ Er schob Nina gleichzeitig einen Berg Fotos über den Tisch. „Auf der Handtasche sind verschiedene Fingerabdrücke sichtbar gemacht worden.“
„Damit können wir wenig anfangen“, sagte Willy, was mich dagegen beruhigte. „Eine solche Tasche kann durch mehrere Hände gegangen sein. Stützen wir uns auf das Wesentliche.“
Daniel zählte die Utensilien auf, die er in der Tasche gefunden hatte. Ich erinnerte mich an die Schlüssel, die Korner bereits konfisziert hatte. Nina legte die Bilder nebeneinander und betrachtete sie eingehend. Ich nahm mir vor, die Bilder anzusehen. Hätte ich sagen sollen, dass Salomé gar nicht geraucht hatte? Ich überlegte mir, ob ich mich auch als ermittelnder Polizist strafbar machte, wenn ich nicht mit der ganzen Wahrheit herausrückte.
„Ich möchte den Fall baldmöglichst abschliessen“, sagte Conradin und warf mir einen abschätzenden Blick zu. „Ich appelliere an deinen Scharfsinn.“
Ich wusste nicht, wen er damit angesprochen hatte. Und da wir sowieso nichts anderes zu tun hatten... das behielt ich aber für mich.
„Hast du etwas dagegen, Andy?“, fragte Conradin. Er kannte meine Körperhaltung und was sie aussagte. „Ich rekonstruiere also“, sagte er und schniefte. „Eine Frau wird im Sempacherpark tot aufgefunden. Nach dem Stand der Dinge wissen wir heute, dass sie ausserhalb des Fundortes umgebracht worden ist. Das Motiv ist noch nicht bekannt. Es könnte aber durchaus sein, dass es hier um ein Eifersuchtsdelikt geht. Die Agenda mit den eingetragenen Männernamen...“, Conradin warf mir schnell einen Blick zu, „oder zumindest die Übernamen derjenigen, beweisen ganz offensichtlich, dass es einen oder mehrere Liebhaber im Leben der Toten gegeben hat. Wir wissen auch, dass der Ehemann der Toten zur Tatzeit in Afrika weilte. Fahren wir also fort: Roduit, Sie kümmern sich um die Eltern der Ermordeten und allenfalls um diesen Mahler, sobald er zurück ist. Meier, Sie suchen nach weiteren Zeugen im Umfeld der Toten.“ Er blickte Juliens schmächtigen Kollegen an, der erst seit vier Wochen in unserer Abteilung arbeitete. „Eventuell Hausmitbewohner, Sie wissen ja, was zu tun ist. Ich möchte über jeden Schritt umgehend Bescheid bekommen.“
Conradin blickte dabei mich kritisch an. Die Bilder bei Nina vergass ich.
Später auf dem Korridor stellte ich mich Julien in den Weg. „Wie zum Teufel bist du an diese Informationen gekommen?“
„Du meinst wegen Mahler?“ Julien grinste mich frech an. „Köpfchen, mein Lieber. Ich rief die Versicherung an, in der er arbeitet. Ich habe da Beziehungen. Wochenende hin oder her. Diese Versicherung ist in der Regel immer präsent. Hat mich allerdings einen halben Tag gekostet.“
„Wie kommt es, dass du hinter meinem Rücken recherchierst? Ich habe dich das halbe Wochenende gesucht, und jetzt getraust du dich, mir mitzuteilen, dass du auf eigene Faust losgezogen bist.“
Julien klopfte mir auf die Schultern. „Ich weiss, dass du mir dafür dankbar bist. Ich merke doch, dass du neben den Schuhen stehst.“
„Ich spendiere dir einen Drink nach Feierabend“, sagte ich zynisch. Warum sollte er mein Befinden kennen? „Ich werde mir Mahler vornehmen.“
Sie kannten mich wohl alle auf der Abteilung. Sie spürten meine Veränderung. Mein Dilemma. Wollten sie auf mich Rücksicht nehmen? Ahnten sie etwas? Oder wussten sie es?
„Er wird heute Abend wieder in Luzern sein. Ich überlasse ihn dir gern“, sagte Julien. „Du hast da das bessere Gespür als ich.“
„Seit wann sagst du mir, was ich zu tun habe?“ Ich war perplex.
„Okay“, sagte Julien. „Conradin rief mich im Verlaufe des Samstags an und teilte mir mit, dass er dich nicht erreichen könne. Ich sollte mich mal um diesen Mahler kümmern. Also tat ich es, obwohl ich keinen Bereitschaftsdienst hatte. Entschuldige, es wird nicht wieder vorkommen.“
Ich wusste darauf nichts zu erwidern.
Ich kehrte ins Büro zurück, um die Post durchzusehen. Um neun Uhr hätte der Clochard aus dem Vögeligarten bei mir eintreffen sollen. Ich wartete bis halb zehn und gab es dann auf. Ich hatte mir auch nicht sonderlich viel von diesem Gespräch erhofft. Endlich konnte ich einen Kaffee trinken und die Zigarette rauchen.
Pünktlich um zehn meldete sich Dante Ripiosi aus dem Hotel beim Park. Er kam in Jeans und T-Shirt daher, was mich sehr verwunderte. Ich bat ihn, Platz zu nehmen. Er war heute viel gesprächiger und zugänglicher als vorgestern und bereit, mir ausnahmslos alles zu berichten, was vorgefallen war. Es machte den Anschein, als hätte er sich auf das Treffen mit mir präzise vorbereitet und sich seine Formulierungen genau ausgedacht. Wohl befürchtete er einen weiteren Tadel meinerseits und wollte dem geschickt ausweichen. Ich installierte das Aufnahmegerät und setzte es in Betrieb.
Ripiosi hatte tatsächlich die Polizei angerufen, nachdem ihm der Clochard von der Frau auf der Parkbank berichtet hatte.
„Ich habe die Türe um fünf vor halb sechs zum Hotel geöffnet“, sagte er. „Etwas Verdächtiges ist mir nicht aufgefallen. Da es immer viel Zeit in Anspruch nimmt, mich umzuziehen, weiss ich nicht, was sich vor dem Hotel abgespielt hat.“
Das konnte ich mir vorstellen: Bis der sich in seine Yuppiekleider gezwängt und die halbe Parfumflasche über sich gegossen hatte, musste eine geraume Zeit vergangen sein.
„Der Clochard hat um etwa zwanzig vor sechs an der Türe gestanden. Ich habe ihm aufgemacht und bin zu ihm auf die Strasse getreten“, sagte Ripiosi.
Er betonte, dass es ihm zuwider gewesen sei, den Zigeuner ins Hotel zu lassen. Die Polizei sei aber kurz vor sechs Uhr schon beim Park angekommen. Dies stimmte denn auch mit meiner zeitlichen Berechnung überein.
„Haben Sie bei Ihrer Ankunft nichts bemerkt?“
„Nein.“
„Hat Ihnen der Clochard erzählt, dass er etwas Verdächtiges gesehen hat?“
Ripiosi verneinte wieder. „Die Tote liege einfach da, sagte er mir. Wie eine schlafende Elfe. Mir war es nicht geheuer, weil sich im Park nie so gut gekleidete Frauen zum Schlafen legen.“
„Dann haben Sie sich zuerst vergewissert, ob die Aussage des Mannes stimmt?“
„Nein, ich glaubte ihm und rief die Stadtpolizei an. Was hätte ich denn anderes tun sollen?“
Diese Frage schien mir überflüssig. Ich legte Ripiosi ein Bild der Toten vor die Nase. „Haben Sie diese Frau jemals gesehen?“
Er schaute die Fotografie eingehend an und lehnte sich dann zurück. Er schlug die Beine übereinander. Mir fielen seine kräftigen Oberschenkel auf.
„Ja“, sagte er, „die war mehrmals in unserem Restaurant. Ich weiss es so genau, weil sie immer mit einem sehr viel älteren Herrn hier war. Sie war eine aussergewöhnlich hübsche Frau, hat überhaupt nicht zu ihm gepasst. Die Kellner haben denn auch Scherze über die beiden gemacht.“ Er hüstelte, ohne mich dabei anzusehen. „Was ich natürlich nicht tolerierte.“
Salomé mit einem ältern Herrn. Das Bild hatte in meinem Kopf keinen Platz. „Wissen Sie, wie der Mann heisst?“
„Nein, da müsste ich den Oberkellner fragen“, antwortete Ripiosi, „aber der ist im Moment im Urlaub.“
„Der Name ist nicht zufällig bei der Reservation notiert?“
„Nein, die haben sich nie angemeldet, sind einfach so hereinspaziert. Aber sehr gesittet.“
„Wann kommt Ihr Mitarbeiter wieder zurück?“
„Erst in einer Woche.“
Ich notierte mir die Anschrift des Kellners und liess den Empfangschef wieder gehen.
Mittags lag bereits der Hausdurchsuchungsbeschluss für die Wohnung Mahler auf dem Tisch.
Wider Erwarten war Sophie Mahler zu Hause, als ich sie anrief und meinen Besuch anmeldete. Sie hatte auch nichts dagegen, dass ich gleich bei ihr vorbeischaute. Ob sie den Computer manipuliert hatte? Was wusste sie über ihre Mutter? Ich wurde nicht schlau aus dieser Frau. Sie war intelligenter, als sie sich gab, heimtückischer und berechnender. Sie faszinierte mich. Sie provozierte mich. Sie besass etwas, was mich schon bei Salomé angezogen hatte.
Ich unterliess es, Gaby anzurufen, obwohl sie mich gebeten hatte, es zu tun, falls ich nochmals bei Mahlers vorbeischauen sollte. Ich wollte allein sein. Bevor ich ging, versuchte ich, den Kellner aus dem Hotel in seinem Feriendomizil zu erreichen, musste aber nach mehreren Versuchen feststellen, dass ich absolut keine Chance hatte, eine Verbindung mit Italien herzustellen. Vielleicht streikten sie.
***
Sophie trug einen langen schmalen Rock. Sie war barfuss, was sie kleiner erscheinen liess. Sie wirkte heute ausgesprochen feminin und hatte sich sogar geschminkt. Sie wartete an der Türe, bis ich eingetreten war. Anschliessend öffnete sie mir die Türe zu Salomés Schlafzimmer. „Ich habe nichts angerührt“, sagte sie spitz und schob mir den Bürostuhl zu. Ob sie ihr schlechtes Gewissen plagte?
„Wollen Sie den Durchsuchungsbefehl nicht sehen?“
Sophie schüttelte den Kopf. „Machen Sie schon.“
Ich war schnell im Programm. Ich schaute mir die Seite mit den Mails an. Posteingang, Postausgang. Sogar die gelöschten Objekte. Aber nichts deutete darauf hin, dass Salomé mit irgendwelchen Männern oder Frauen korrespondiert hatte. Das war sonderbar. Kein einziger Eintrag. Die Seiten gähnten mir leer entgegen. Ich wandte mich Sophie zu. „Haben Sie irgendwelche Sachen vernichtet?“
„Ich kenne ja nicht einmal ihren Code“, sagte sie.
„Lügen Sie mich nicht an!“
„Ich schwöre, dass ich nichts angerührt habe.“ Sophie setzte sich vor mir neben den Computer. „Ich will doch auch, dass man den Mörder meiner Mutter findet.“ Ihre Stimme klang wie ein leises Wispern. Entweder spielte sie ein perfektes Theater oder sie meinte es wirklich ernst.
„Und Ihr Freund, war der am Computer?“
„Ich weiss nicht, was Sie meinen“, sagte sie leise und nachdenklich, als versuchte sie, sich daran zu erinnern, ob nicht doch Dürrenmatt den Computer manipuliert hatte.
„Was hätte Ihre Mutter Ihrer Meinung nach noch mit dem Computer anstellen können?“
„Spiele oder Zeichnungen“, antwortete Sophie eine Spur zu schnell.
„Was würden Sie ausser arbeiten am Computer machen?“
Sie lachte nervös. „Ich gehe oft ins Netz. Aber das muss ich von der Schule aus. Wir arbeiten auch da über das Internet.“
„Und was suchen Sie da?“ Ich drehte den Bürostuhl. Meine Beine berührten ihre unbeabsichtigt. Ich schreckte zurück, ohne dass sie es merkte.
„Das Internet ersetzt mir den Gang zur Bibliothek“, sagte sie, was einleuchtend klang.
Ich widmete mich wieder dem Bildschirm und der Tastatur vor mir. Ich suchte nach registrierten Einträgen unter world wide web. Aber auch da war alles gelöscht. „Ich muss den Computer leider beschlagnahmen“, sagte ich zu Sophie. „Ich werde ihn abholen lassen.“
„Tun Sie, was Sie nicht lassen können“, sagte sie selbstsicher.
„Und Sie geben mir Ihr Ehrenwort, dass Sie nichts verändert haben?“
Sie hob ehrfurchtsvoll drei Finger ihrer rechten Hand. „Ich sagte es doch schon.“
Ich war sicher, dass sie log. Ich öffnete noch einmal den Schrank rechts der Türe und sah mir Salomés Kleider an. Aber nichts, das mir bekannt vorgekommen wäre. Sonderbar war es schon. Sie musste ein perfekt durchdachtes Doppelleben geführt haben. „Existiert eigentlich eine Zweitwohnung oder ein Ferienhaus in Ihrer Familie?“
Sophie lachte laut heraus, mit einem bitteren Unterton, der mir nicht entging. „Was glauben Sie eigentlich? Wir sind keine Millionäre. Mein Vater verdient nicht so viel, wie es vielleicht den Anschein macht. Und meine Mutter hat das Geld gleich wieder ausgegeben. Für ihre dämlichen Fitnessclubs und Kosmetiksalons. Wir konnten uns nicht einmal Urlaub leisten, mein Vater und ich, weil meine Mutter alles verpulverte.“
„Ihr Vater war eine knappe Woche in Nairobi“, sagte ich und sah, wie sich Sophies Blick verfinsterte.
„Er muss oft beruflich verreisen. Es gibt sehr delikate Versicherungsfälle im Ausland. Jetzt, wo Sie es sagen, erinnere ich mich wieder. Mein Vater musste wegen zwei Todesfällen auf einer Safari nach Kenia fliegen.“
Das klang nicht sehr glaubwürdig. „Jetzt hören Sie einmal gut zu“, sagte ich, meine Beherrschung allmählich verlierend. „Ihre Mutter hatte eine ganze Zeile von Liebhabern. Sie wussten es.“
„Das ist nicht wahr!“ Sophies Stimme überschlug sich. „Ich kenne ja nicht einmal ihre Freundinnen. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe meine eigenen Probleme.“
Manchmal beschlich mich das seltsame Gefühl, dass ich meine Energien unnötig einsetzte. Instinktiv spürte ich, dass mich Sophie bewusst ablenken wollte. Sie wollte Zeit gewinnen, wo die Zeit mir davonlief. Und ich stellte fest, dass ich keinen Schritt weiterkam. Warum bringt man eine Catherine Mahler um, wenn nicht aus Motiven der Eifersucht? Hätte Sophie einen Grund gehabt, ihre Mutter zu töten? Konnte sie die Art, wie ihre Mutter den Vater behandelte, nicht mehr länger ertragen? Oder hatte ihr Mann sie umgebracht, weil er gewusst hatte, dass sie einen Liebhaber hatte? Und was geschah, wenn Mahler wusste, dass ich der Geliebte seiner Frau gewesen war? Würde ich sein nächstes Opfer sein? Irgendwie schien mir diese Lösung doch zu hypothetisch. Ich entschloss mich, unten in der Imbissstube einen Hamburger zu essen und auf Hans Mahler zu warten. Ich verabschiedete mich von Sophie und versicherte ihr, dass ich bei der Ankunft ihres Vaters an Ort und Stelle sein würde. Sie drückte mir wider Erwarten die Hand.
Sie waren wie eine verrückte Horde, diese Kinder, die laut schreiend in den Imbiss-Corner drangen. Wie ein ausser Rand und Band geratener Schwarm Ungeziefer. Vielleicht mussten sie schreien, um beachtet zu werden. Die Begleiterin konnte sie kaum bändigen. Ich sass draussen an einem der kleinen runden Tische, verschlang den Hamburger, der nach nichts schmeckte, und versuchte, die rote Sauce in Schach zu halten, damit sie mir nicht über meine Hose tropfte.
Die Leute huschten wie Marionetten an mir vorbei. Während ich meinen Blick geradeaus richtete, fluteten die Farben ihrer Kleider durch mein geistiges Auge. Ein Wirrwarr von blauen, gelben und roten Tönen, die sich wie in einer rotierenden Röhre in einen zersplitterten Farbklecks verwandelten. Ein Kaleidoskop des Wahnsinns. Die Hitze in der Stadt setzte mir sehr zu. Ich kämpfte gegen meinen inneren Feind, der mich zu vernichten drohte. Ich hatte Mühe mit dem Atmen. Salomé war es gewesen, die mir riet, deswegen einen Arzt aufzusuchen. Ein starkes Gefühl, wie sehr sie sich um mich gesorgt hatte, trotz ihrer Widersprüchlichkeit. Ich würde keinen Arzt aufsuchen. Jetzt nicht mehr. Und das stete Stechen auf meiner Lunge würde ich einfach ignorieren.
Ich griff zur Zigarette und schaute mir die Fotos im gegenüberliegenden Fenster an. Porträts von Frauen. Eine Frau auf dem Fauteuil. Sie trug nichts, aber man sah ihre Blösse trotzdem nicht. Geschickt hatte der Fotograf ihre Brüste und die Scham im Schatten verborgen. Sie schaute mit halb geöffneten Augen in die Kamera. Daneben ein Bild von einer anderen, jüngeren Frau in einem züchtig hochgeschlossenen Kleid. Sie wirkte dennoch sehr erotisch.
Die Horde Kinder stürmte wieder aus dem Restaurant. Sie trugen bunte Plüschtiere mit sich und Ballone. Ich zündete die Zigarette an und rief Julien an, damit er veranlasste, Franz Notz loszuschicken, um den Computer aus Mahlers Wohnung zu holen. Ich verspürte eine gewisse Genugtuung.
Dann wartete ich. Zwei Stunden lang. Ich hatte meinen zweiten Hamburger vertilgt und mir die Luzerner Zeitung geschnappt. Daniela Schneider hatte der Toten eine halbe Seite gewidmet, was ihr ähnlich sah. Sie hatte ein ganz besonderes Talent, über Dinge zu berichten, von denen sie nur halb so viel wusste, wie sie schrieb. Sie recherchierte, philosophierte und fantasierte. Dauernd verfiel sie euphorisch irgendwelchen Spekulationen, auch wenn sie immer wieder betonte, dass sie diese Art von Journalismus nicht betreibe. Ich rechnete es ihr allerdings hoch an, dass sie die Ermittlungen der Polizei heute nicht anprangerte.
Gegen halb sieben, kurz bevor die Läden schlossen, rief mich Sophie auf meinem Mobiltelefon an. Ihr Vater sei in der Zwischenzeit angekommen. Ich machte mich auf den Weg zu ihnen.
Sophie liess mich gleich in die Wohnung und führte mich in die Küche, wo Hans Mahler sass. Sein Oberkörper war über den Tisch gebeugt; das Gesicht konnte ich vorerst nicht sehen. Sophie musste es ihm erzählt haben. Ich begrüsste ihn mit Zurückhaltung. Jetzt blickte er mich an. Ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt als den Mann, der sich vor mir aufrichtete. Er war eindeutig kleiner als ich, hatte schütteres Haar und trug eine Nickelbrille, durch die mich zusammengekniffene hellgraue Augen beobachteten. Er schien kurzsichtig zu sein, was durch seinen Blick noch unterstrichen wurde.
„Ich weiss“, begann er monoton, „was Sie mir sagen wollen. Ich habe die Nachricht bei meiner Ankunft auf dem Bahnhof schon gelesen. Eine elegante Art, so etwas zu überbringen. Wenn nur alle immer so schnell wären wie die Presse.“
Es klang traurig. Ich überlegte mir, dass ich deswegen keine Verantwortung trug. Ich bekundete ihm mein Mitgefühl und kam zur Sache. „Können Sie sich erklären, warum man Ihre Frau umgebracht hat?“
„Tut mir leid, das entzieht sich meiner Kenntnis.“
Seine Antwort irritierte mich. Mahler bat Sophie um den kalt gestellten Wein im Kühlschrank. Er war vollkommen ruhig. Keine Regung in seinem blassen Gesicht. „Trinken Sie mit?“
Ich fand das eher unangebracht und verneinte.
„Sie staunen sicher, dass ich nicht in Tränen ausbreche“, sagte Mahler und goss sich den Wein ins Glas, das Sophie ihm hingestellt hatte. „Aber um ehrlich zu sein, so etwas habe ich kommen sehen.“ Er stellte die Flasche auf den Tisch zurück.
„Können Sie sich genauer ausdrücken?“
„Nun ja“, Mahler führte das Glas zum Mund. Langsam liess er den Wein in sich fliessen. Er zog, schlürfte, degustierte, ohne seine Ruhe zu verlieren. „Meine Frau war sehr unvorsichtig in ihrem Leben. Ich habe sie oft davor gewarnt, dass sie sich nicht mit jedermann einlassen soll.“ Bevor ich etwas erwidern konnte, fuhr er monoton weiter: „Die Welt ist voll von schlechten Dingen. Stellen Sie sich vor, ich komme gerade von Kenia zurück. Vor drei Monaten sind dort zwei Luzernerinnen umgekommen. Sie hat es erwischt, als sie mit ihrem Wagen durch ein Flussbett fuhren. Es gab ein Gewitter und der Fluss schwoll innerhalb weniger Minuten zu einem reissenden Strom an. Sie konnten nichts mehr tun. Sie ertranken, zusammen mit einheimischen Begleitern. Ich musste die versicherungstechnischen Hintergründe eruieren. Ob die Reiseveranstalter die Verantwortung tragen müssen, weil sie ja damit rechnen mussten, dass in dieser Zeit in Kenia Regenzeit herrscht. Jetzt habe ich herausgefunden, dass die beiden Frauen auf eigenes Risiko gefahren sind. Ihre Begleiter, es waren ihre kenianischen Liebhaber, rissen sie dadurch in den Tod. Und zu Hause liessen sie ihre Ehemänner mit ihren kleinen Kindern zurück. Wissen sie, was ich damit sagen will?“ Mahler machte eine kurze Pause und kratzte sich an der Stirn. „Oft werden die schlechten Taten ohne eigenes Zutun gerächt.“
Ich erwartete, dass er irgendwann biblische Abschnitte zitieren würde.
„Ich nehme an, dass Ihre Versicherung in diesem Fall auch nicht zahlen wird“, stellte ich infrage und sah, wie sich sein Gesicht ein wenig rötete.
„Sie haben nicht begriffen, worum es hier geht“, sagte Mahler und blinzelte mich an. „Der Versicherungsfall ist Nebensache. Ich habe meine Arbeit getan. Was mir bleibt, ist das Wissen darum, dass es noch etwas Höheres gibt. Das Gute wird immer über das Böse siegen.“
Sophie, die an der Kombination stand, sah mich mit gläsernen Augen an. Ich versuchte, ihrem Blick auszuweichen. War es das, was sie mir hatte sagen wollen? Hatte Catherine Mahler ihren Mann so weit gebracht, dass er einem religiösen Wahn verfiel? Hatte sie ihn psychisch fertiggemacht? Mich schauderte. Oder führte man mich absichtlich auf die falsche Fährte?
„Wo waren Sie in der Nacht von Freitag auf Samstag?“
Ich versuchte, meine Ratlosigkeit mit einer formellen Frage zu überspielen, in der Hoffnung, dass Mahler wieder auf den Boden der Realität zurückkehrte.
„Auf dem Flughafen in Mombasa“, antwortete Mahler ohne mit der Wimper zu zucken. „Ich weiss es so genau, weil ich nämlich meinen Anschlussflug nach Nairobi verpasst habe. Ich musste die ganze Nacht eingepfercht zwischen schwitzenden Afrikanern auf dem Flughafengelände verharren. Können Sie sich vorstellen, wie das ist?“
Ich hätte ihn gern gefragt, ob es in Mombasa um diese Jahreszeit heisser sei als momentan in Luzern. „Haben Sie Ihre Frau umgebracht?“
Mahler schaute mich verdattert an. Er griff wieder zum Weinglas. Sophie räusperte sich. Ich sah, wie blass sie geworden war.
„Ist das nun eine ernste Frage?“
Ich nickte.
„Ich habe sie tausendmal umgebracht“, sagte Mahler. „Ich habe sie erschlagen, erschossen, erdrosselt und aufgehängt. Tausendmal in meinem Kopf. Aber ich hätte es nie wirklich tun können. Glauben Sie mir. Zudem war ich ja zur Mordzeit in Afrika.“
Warum betonte er dies? Führte er mich bewusst in die Irre oder war er einfach nur clever? Gebrauchte er seine eigenen Argumente als Absicherung seines Alibis? „Haben Sie zum Mord angestiftet?“
Langes Schweigen. Dann kam mir Sophie in die Quere. „Jetzt reicht es aber“, sagte sie. „Lassen Sie meinen Vater in Ruhe! Er hat schon genug gelitten.“
Daran zweifelte ich allerdings.
„Lass gut sein, Sophie“, schlichtete Mahler und trank den Wein aus. „Er tut nur seinen Job.“ Dann schaute er mich an. „Ich habe meine Frau nicht getötet. Ich habe sie geliebt, aber nicht verstanden. Ich weiss nicht, was seit drei Jahren in sie gefahren ist. Sie hat sich sehr verändert. Auf meine Fragen hin hat sie nie geantwortet. Wir sahen uns sehr selten. Ich war auch oft unterwegs, aber wenn ich nach Hause kam, war Catherine nicht da. Sie blieb manchmal ganze Nächte einfach weg.“
„Ihre Tochter hat mir gesagt, dass Sie sich in Ihrer Ehe auseinandergelebt haben.“
„Ja, wer tut das nicht nach so vielen Jahren.“ Mahlers Stimme klang resigniert. „Aber bei allem Respekt und Anstand, wenn man unter demselben Dach lebt, so sollte man wenigstens die elementarsten Dinge voneinander wissen.“
„Ihre Tochter ist da anderer Ansicht“, sagte ich und schaute Sophie an, die schweigend an der Kombination stand. Sie würdigte mich keines Blickes, kaute aber an ihren Fingernägeln. In Anwesenheit ihres Vaters war sie wieder zum kleinen Mädchen geworden.
„Ich weiss“, sagte Mahler, „die heutige Jugend hat andere Denkweisen, was eine Beziehung angeht.“
Ich fragte mich, ob er Gewissheit hatte über den Umgang seiner Tochter. Ob er Roger Dürrenmatt kannte. „Haben Sie gewusst, dass Ihre Frau einen Liebhaber hatte?“ Im Augenblick der Frage wurde mir bewusst, dass ich mich damit selbst exponierte. Ich konzentrierte mich auf Mahlers Gesichtsausdruck. Er blieb regungslos. Nicht ein leises Zucken. Nichts.
„Meine Frau ist tot“, sagte er betont langsam. „Ich kann nichts dafür.“
„Dann wussten Sie es?“ Ich gab nicht auf.
„Ändert das etwas an der Tatsache?“ Mahler nahm wieder sein Weinglas zur Hand. Führte es zum Mund. Trank. Als er es zurückstellte, sagte er gelassen: „Wenn ich Ihnen sage, dass ich es gewusst habe, mache ich mich verdächtig. Wenn ich es abstreite, fällt der Verdacht genauso auf mich, weil es unglaubwürdig klingt. Also, was wollen Sie hören?“
„Die Wahrheit.“
„Die Wahrheit ist, dass ich Catherine geliebt habe. Mit all ihren Vorzügen und Nachteilen. Ich habe sie so geliebt, dass ich ihr auch ihre Eskapaden verziehen habe – unter dem Vorwand, was ich nicht genau weiss, lässt mich kalt.“
Genauso schätzte ich ihn ein. Und das Wort Liebe schien bei ihm eine Floskel zu sein. Ein komischer Kauz war er.
„Hat es Sie geärgert, dass sich Ihre Frau mit Ihrem Geld ihre Annehmlichkeiten finanziert hat?“
„Welche Annehmlichkeiten?“ Mahler sah mich betroffen an. Der Schatten, der kurz über sein Gesicht huschte, verschwand schnell wieder. „Das Finanzielle war nie ein Thema zwischen uns. Das regelten wir schon im Vornherein“, sagte er.
Ich fand nicht heraus, was er damit meinte, und beliess es, diesbezüglich weitere Fragen zu stellen. „Ich muss Sie leider noch um einen unangenehmen Gefallen bitten“, sagte ich abschliessend, bedacht darauf, das Thema in andere Bahnen zu lenken. „Sie werden nicht darum herumkommen, Ihre Frau in der Gerichtsmedizin in Zürich zu identifizieren. Erst danach können wir sie für die Bestattung freigeben.“ Das würde auch meine Zweifel endgültig beseitigen oder aber ihnen neuen Nährboden bieten.
Mahler erhob sich. Er schien sehr gefasst. „Natürlich. Sophie wird mich begleiten.“ Er sagte dies, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Mahler warf Sophie einen ernsten Blick zu. Sie getraute sich nicht, ihm zu widersprechen. Ich verabschiedete mich von den beiden, drückte Mahler meine Visitenkarte in die Hand. „Falls Ihnen noch etwas zum Tod ihrer Frau einfallen sollte, so erreichen Sie mich auf meinem Handy oder im Büro.“
„Ich werde mit dem zuständigen Pfarrer die Bestattung besprechen und die Möglichkeit für ein Begräbnis am Mittwochmorgen“, sagte Mahler. Er schien völlig emotionslos. „Werden Sie auch kommen?“
Warum fragte er? „Ich werde da sein“, sagte ich. Ich wollte da auf jeden Fall hingehen, auch wenn mich Mahler nicht danach gefragt hätte.
Ich hatte Lust, die Wohnung möglichst schnell zu verlassen. Die beiden Hamburger lagen mir im Magen. Draussen zündete ich eine Zigarette an und ging schnellen Schrittes durch die Altstadt. Die Hitze schlug mir brutal entgegen. Der Asphalt unter meinen Füssen kochte. Ich verstand die Leute nicht, die es in diesem Glühofen an der Sonne aushielten. Es war sieben Uhr am Abend und noch immer über dreissig Grad. Und die Wetteraussichten für die kommenden Tage versprachen keine Änderung.
Ich roch sie. Salomé. Ich fühlte sie auf meiner Haut. Ihre Hitze, die aus ihren Poren strömte, wenn ich in ihr war. Ich spürte ihre Fingernägel auf meinem Rücken, wenn sie in Tränen ausbrach oder in dieses exzessive Lachen während ihrer Orgasmen. Ich konnte mir Salomé nicht mit Mahler vorstellen.
Ich überquerte die Alpenstrasse und ging Richtung See. Ich brannte. Ich verbrannte. Ich lechzte nach intensiver Abkühlung. Innen.
***
Das Stadtbad hatte von seinem Charme aus längst vergessenen Tagen kaum etwas eingebüsst. Die Noblesse vor der Kulisse der Luxushotels Palace und Casino war geblieben, verändert hatten sich nur die Besucher. Waren diese Art von Bäder einst der feinen Gesellschaft vorbehalten gewesen, traf sich hier heute Jung und Alt zum Abschalten, Abkühlen und Erfrischen auf der Terrasse über dem See. Die Umziehkabinen erinnerten an die Badehäuschen der Côte d’Azur. Nur die Liegestühle fehlten.
Die Badeanstalt war voll besetzt, und ich wunderte mich, wie viel Nähe die Menschen ertrugen und sie trotzdem allesamt in bester Laune hielt. Weiss gekleidete Kellner trugen Tabletts mit Erfrischungsgetränken. Die Damen präsentierten nach Büro- und Ladenschluss ihre modischen Bikinis, die Herren ihre durchtrainierten Körper. Sie muteten seltsam unwirklich an. Wie geklonte Frauen und Männer. Sie ähnelten einander immer mehr. Katalogisierte Individualität. Kultur des 21. Jahrhunderts. Ich fühlte mich wie ein zwangsneurotischer Aussenseiter.
Den Köpfler beherrschte ich immer noch. Das Wasser prickelte auf meiner Haut. Ich kam prustend hoch. Liess mich rückwärts treiben. Der blaue Bogen über mir war mit Zuckerwattebäuschchen übersät. Der Kondensstreifen eines Linienjets, der den Himmel entzweite. Eine Welle überflutete mein Gesicht, von dem Raddampfer verursacht, beim Einlaufen in den heimatlichen Hafen. Neben mir ein fremdes Gesicht. Lachend. Prustend. Braun gebrannt. Mit dem selbstvergessenen Blick des Glückseligen, des Was-soll-mir-die-Welt-schon-anhaben-Gebarens – des Ignoranten.
Conradin hatte den Pessimisten in mir schon längst erkannt. Ich sei zwar ein natürlicher Ausgleich zu den notorischen Positivdenkern unserer Gesellschaft, aber auch die intellektuelle Ausgeburt als Gegenpol der Schönfärberei, ein Mensch, der seine Gedanken auf der Schattenseite gebiert. Vielleicht mochte er recht haben. Ich hatte mir darüber nie den Kopf zerbrochen, welches Bild ich von mir selbst den anderen vermittelte. Ich nahm mich nicht so wichtig. Ich war nur zwangsläufig ein Mitläufer in dieser hochstilisierten, elektronisierten, maroden und aufgeblähten Welt, wie sie sich manchmal um mich herum definierte. Ich hatte zu viel mitbekommen in meiner zehnjährigen Tätigkeit bei der Kantonspolizei. Ich hatte hinter die Fassaden des schönen Scheins gesehen, hatte die Machenschaften einiger Giganten erkannt, mit denen sie die Kleinen, ihre eigenen Wasserträger, auffrassen. Sie, die vor nichts zurückschreckten, auch nicht vor Mord, wenn es letztendlich um ihre Profitmaximierung ging. Sie waren selbst wie Mutanten in einer sich grotesk verändernden Welt. Geld und Macht regierten, Gier, Egozentrik und die, die über Leichen gingen. Die Entwicklung in diese Richtung machte mir Angst. Was nicht erduldet wurde in der Gesellschaft, wurde ausgelöscht, verworfen, wegrationalisiert. Ethik und Moral waren auf ein Minimum zurückgesunken. Es wurde täglich dagegen propagiert.
Was mochte den Mörder von Salomé veranlasst haben, sie aus dem Leben zu reissen? Welcher Teufel musste ihn geritten haben, sich das Recht herauszunehmen, über Leben und Tod zu bestimmen?
Sie standen nicht mehr auf, die niedergestochenen Opfer, die erschossenen und erdrosselten. Sie blieben liegen und starben, anders als in den unzählig brutalen Filmen, die uns Hollywood lieferte oder die virtuellen Kriegsmaschinen, die Playstations in den Kinderzimmern. Die Realität verwischte. Vielleicht waren wir gar nicht mehr fähig, zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu unterscheiden.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.