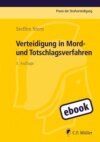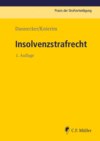Kitabı oku: «Verteidigung in Mord- und Totschlagsverfahren», sayfa 11
f) Kindestötung als Straf- oder Vergeltungsaktion
65
Zu unterscheiden hiervon sind Konstellationen, in denen der Täter (Vater oder Mutter) dem Tatopfer gegenüber destruktiv eingestellt ist[186] oder mit dem Tod eines Kindes den anderen (überlebenden) Elternteil abstrafen will. Beispielhaft kann für diese Fallgruppe die Tötung zweier schlafender Kinder durch Messerstiche in die Brust durch den suizidalen Familienvater angeführt werden, der die Trennungsentscheidung seiner Ehefrau nicht verkraften konnte. Das Mordmerkmal der „niedrigen Beweggründe“ war nur deshalb nicht erfüllt, weil die Absicht des Angeklagten, seine Ehefrau zu bestrafen oder sich an ihr zu rächen, nicht dominant, sondern nur eines von mehreren Motiven innerhalb eines ganzen Bündels war[187]. Verworfen hat der BGH die Revision eines wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilten Vaters, der, um sich an seiner Frau zu rächen, die gemeinsame Tochter aus dem Fenster im 2. Stock eines Wohnhauses geworfen hatte. Das Kleinkind überlebte den Sturz schwer verletzt[188].
g) Eltern, die ihre Kinder verhungern oder verdursten lassen
66
Erschreckend lang ist die Liste der Kinder, die an Unterernährung gestorben oder verdurstet sind, weil die Eltern ihnen Essen und Trinken vorenthalten haben[189]. Und manch ein Kind konnte erst in letzter Minute vor dem sicheren Hungerstod bewahrt werden. Typisch ist der folgende Fall: Die Angeklagte, die mit ihren 2 und 4 Jahre alten Söhnen zusammenlebte, plante, zu Weihnachten einen weit entfernten Freund zu besuchen, über Nacht zu bleiben und anderentags wieder zurückzureisen. Sie reiste mit dem 4-jährigen Jungen ab und ließ den 2-Jährigen in seinem Gitterbett mit einer Babytrinkflasche mit 280 ml Flüssigkeit und einigen Butterkeksen zurück. Dieser Junge kränkelte seit Tagen, hatte in kurzer Zeit stark an Gewicht verloren und nahm auch kaum noch Nahrung und Flüssigkeit zu sich. Um eine Betreuung hatte sich die Angeklagte vergeblich bemüht. Sie entschloss sich dann, einen Tag länger als geplant bei ihrem Freund zu bleiben. Diesem spiegelte sie vor, dass zu Hause die betreuende Freundin weiterhin auf das Kind aufpassen würde. Als die Angeklagte verspätet zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Kekse und die Trinkflasche, deren Inhalt möglicherweise verschüttet war, neben dem Bett lagen. Sie sah, dass es dem Jungen sehr schlecht ging. In den nächsten Stunden aß er nichts und trank kaum noch. Die Angeklagte holte keinen Arzt, da sie „fürchtete, dass dieser das Jugendamt verständigt hätte. Sie dachte, sie könne das Kind allein gesund pflegen“. 2 Tage später verstarb der Junge infolge Nahrungs- und Flüssigkeitsmangels. Das Kind wies zum Todeszeitpunkt deutliches Untergewicht auf. Am Abreisetag der Angeklagten hätte der Junge bei intensiv-medizinischer Behandlung noch gerettet werden können. Für den Zeitpunkt der Rückkehr der Angeklagten konnte dies nicht sicher festgestellt werden[190].
67
Am Anfang steht die Frage nach der eigentlichen Todesursache, eng verknüpft damit die Frage der Todeskausalität der Untätigkeit der Angeklagten sowie der Vorhersehbarkeit und der Vermeidbarkeit des Todeserfolges. Hier sind zunächst die Gerichtsmediziner gefragt. Der Sachverhalt ließ schon bei der Kindesmutter einen psychischen Defekt vermuten. Wie der hinzugezogene Psychiater herausfand, litt sie an einer Borderline-Störung. Problematisch, wie immer in diesen Fällen, war die Frage nach der Bewusstseinslage der Angeklagten zum Zeitpunkt der Abreise und zum Zeitpunkt der Rückkehr. Tatbestände? Mord, Misshandlung Schutzbefohlener, Aussetzung mit Todesfolge?
6. Angriffe alkoholisierter Gewalttäter
68
Drei von zehn aufgeklärte Gewaltdelikte wurden 2010 von Tatverdächtigen unter Alkoholeinfluss begangen. Sogar 40 % betrug der Anteil bei den aufgeklärten Totschlagsdelikten (einschl. Tötung auf Verlangen)[191]. Unter den 834 Mordverdächtigen fanden sich immerhin noch 131 Personen, die bei Begehung der Tat unter Alkoholeinfluss standen (15,7 %)[192]. Bei Mord im Zusammenhang mit Raub war sogar noch bei 19,0 % der Tatverdächtigen Alkohol im Spiel[193].
a) „Sinnlose“ Gewalt durch alkoholisierte Schläger
69
Wir alle haben erschreckende Beispiele vor Augen: Im September 2009 wurde in einer beispiellosen Gewaltorgie auf Dominik Brunner, dem S-Bahn-Held von Solln, eingeschlagen und eingetreten. Brunner hatte sich in der Münchener S-Bahn schützend vor eine Schülergruppe gestellt, die von zwei Schlägern bedroht worden war. Die herbeigerufenen Notärzte konnten ihn nicht wiederbeleben. Die Pathologen zählten 22 sehr schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper, dazu weitere 20 Abschürfungen, Kratzer, Prellungen. Aber keine der Verletzungen war alleine tödlich. Auch Hirnblutung, Herzinfarkt oder Schädelbruch wurden als Ursache ausgeschlossen[194]. Die beiden Schläger wurden zu hohen Strafen verurteilt, der Haupttäter, der zur Tatzeit über 2 ‰ Alkohol im Blut hatte, wegen Mordes aus Rachsucht, sein Mittäter wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Brunner starb nach Feststellung des LG München I nicht an den Verletzungen, sondern an einem Herzstillstand. Unmittelbare Todesursache war ein Kammerflimmern seines vorgeschädigten Herzens infolge der Schläge[195].
70
Im April 2011 haben mitten in Berlin, im zentralen U-Bahnhof Friedrichstraße, zwei Jugendliche einen 29-Jährigen vor laufenden Überwachungskameras fast totgetreten. Zu sehen ist, wie der Täter dem 29-jährigen Opfer mit voller Wucht auf den Kopf springt[196]. Auf einigen Aufnahmen der Überwachungskamera ist deutlich zu erkennen, dass die Täter Bierflaschen in der Hand halten und kaum noch geradeaus gehen können.
b) Gewalthandlungen unter Zechbrüdern
71
Schwurgerichtsvorsitzende müssten der vielen Totschlagsanklagen gegen Gewohnheitstrinker, allen voran die Tatverdächtigen aus dem Penner- und Stadtstreichermilieu, längst überdrüssig sein. Erst zechen die Trunkenbolde miteinander bis zur Besinnungslosigkeit, dann bringen sie sich im Gezänk über Belanglosigkeiten um. Nicht selten ist auch das Opfer sturzbetrunken. Was die Alkoholisierung und die Gewaltbereitschaft angeht, gleicht ein Fall dem anderen: Da erschlägt eine trinkgewohnte Angeklagte ihren Lebensgefährten im Verlauf eines Zechgelages aus nichtigem Anlass mit einem Hammer; Tatzeit-BAK deutlich über 3 ‰[197]. Im Streit um eine unberechtigte Geldforderung misshandelt ein volltrunkener „Alkoholiker mit pathologischer Intelligenzminderung“ (maximale BAK „um 3 ‰“; IQ: 55) seinen ihm körperlich unterlegenen Zechkumpanen, „mit dem er häufig gemeinsam Alkohol trank“, durch Schläge und Tritte, an deren Folgen dieser verstirbt. Schon einmal war der Täter wegen einer im Alkoholrausch (BAK 2,5 bis 3 ‰) begangenen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden[198].
72
Und erst jetzt wieder eine tödlich verlaufene Auseinandersetzung im „sogenannten Trinkermilieu am Berliner Ost-Bahnhof“. Der Täter 27 Jahre alt, aus Polen stammend, Alkoholiker; das Opfer, ein 59 Jahre alter Alkoholkranker. Beim gemeinsamen Zechen gab es plötzlich Streit um eine Schachtel Zigaretten. Nach großem Hin und Her versetzte der Täter dem auf einer niedrigen Mauer sitzenden Geschädigten schließlich einen kräftigen Tritt seitlich gegen den Kopf, sodass dieser nach hinten in eine Rabatte fiel und dort zunächst einige Stunden unbeachtet liegen blieb. Er verstarb wenig später im Krankenhaus an Gehirnblutungen[199].
73
Der hohe Anteil dieser Fallgruppe spiegelt sich auch in der Zahl weiterer einschlägiger BGH-Entscheidungen wider. So ging im Revisionsverfahren 5 StR 668/96[200] der abgeurteilten Körperverletzung mit Todesfolge (bei einer Tatzeit-BAK um 3,61 ‰) ein Streit unter Zechbrüdern voraus. Im Verfahren 4 StR 147/03[201] betrug die BAK des wegen Vollrausches verurteilten Angeklagten zur Tatzeit 4,02 ‰, als er seinen Zechgenossen durch Schläge mit der Faust und einer Taschenlampe sowie durch Fußtritte misshandelte, sodass dieser u.a. ein Schädelhirntrauma und mehrere Gesichtsfrakturen erlitt. Nicht anders lag es im Verfahren 4 StR 160/02[202]: Wieder einmal hatte die leicht reizbar und aggressiv reagierende Angeklagte nach erheblichem Alkoholgenuss, der nicht ausschließbar zu ihrer Schuldunfähigkeit geführt hatte, einen „Zechkumpanen“ derart geschlagen und getreten, dass dieser an den Folgen der Verletzungen verstorben war.
74
Die forensischen Probleme liegen zunächst im Tatsächlichen und dort bei der Feststellung der inneren Tatseite (Tötungs- oder nur Verletzungsvorsatz?). Hochalkoholisiert (BAK 3,5 ‰) ersticht der Täter im Streit einen befreundeten Zechkumpanen und verletzt dessen streitschlichtend eingreifende Ehefrau schwer. Nach Auffassung des BGH war der Tötungsvorsatz in Bezug auf den Getöteten nicht tragfähig begründet; hinsichtlich der der Ehefrau zugefügten Verletzung hätte auch nur fahrlässige Begehungsweise erörtert werden müssen[203].
75
Strafprozessual kann bei tödlicher Gewalt unter Mitzechern die Aufklärung des Sachverhalts schnell an Grenzen stoßen. Zuweilen muss selbst der geduldigste Verteidiger passen, wenn neben den unmittelbaren Tatzeugen auch sein tatverdächtiger Mandant gegen Wahrnehmungs- und Erinnerungsstörungen[204] anzukämpfen hat. Gelingt die Tatrekonstruktion dennoch, hat der Psycho-Sachverständige das Wort[205]. Gewöhnlich hat der Rechtsanwender nur zwischen verminderter Schuldfähigkeit[206] (§ 21 StGB i.V.m. §§ 211, 212 StGB) oder Vollrausch (§ 323a StGB)[207] zu entscheiden. Fast immer herrscht bei Strafjuristen und medizinischen Sachverständigen Ratlosigkeit, wie und ob der Täter überhaupt noch vom Alkohol wegzubringen ist. Zumeist steht sogar das Unterbringungsproblem[208] im Vordergrund.
7. Drogeninduzierte Tötungsdelikte
76
Durchschnittlich 6,5 % aller Morde gehen auf das Konto von Konsumenten harter Drogen. Steht ein Mord im Zusammenhang mit einem Raubdelikt, beträgt ihr Anteil sogar knapp 20,4 %[209]. Hinter diesen Prozentzahlen verstecken sich die vereinzelten Fälle direkter Beschaffungskriminalität, in denen der Drogensüchtige seinen Dealer umbringt, um an dessen Rauschgiftvorrat zu gelangen[210]. Weitaus häufiger hat es der abhängige Gewalttäter jedoch auf Zahlungsmittel für den Erwerb von Drogen abgesehen (indirekte Beschaffungskriminalität). Wenn er unter Entzugserscheinungen leidet, werden bei sich nächst bietender Gelegenheit unbeteiligte Dritte, wie etwa Taxifahrer[211] oder Kneipen-Bedienungen[212], rücksichtslos mit dem Messer attackiert, um deren Barschaft an sich zu bringen. Wird der Täter zeitnah gefasst, kann zur Feststellung der Schuldfähigkeit sein Drogenkonsum durch entsprechende Drogenwerte im Urin und in den Haaren belegt werden[213], in denen sich bei der chemischen Analyse vielleicht hohe Werte von Kokain oder Heroin finden. Exemplarisch für diese Fallgruppe ist der an älteren Damen verübte Handtaschenraub, der für die überfallene Person tödlich endet[214]. Wenngleich zumeist das hochbetagte Opfer nur leicht verletzt wird, kann durchaus Lebensgefahr für aufmerksame Passanten entstehen, die sich an die Fersen des aufgewühlten, unberechenbar reagierenden drogensüchtigen Täters heften[215].
77
Wie verzwickt die juristische Aufarbeitung solcher Fälle sein kann, soll anhand eines dem BGH unterbreiteten Sachverhalts veranschaulicht werden. Nach durchzechter Nacht (BAK maximal 2,3 ‰) und aufgeputscht durch antriebssteigernde Drogen (Speed, Kokain) war der erst kurz zuvor aus Strafhaft und Maßregelvollzug entlassene Täter beim Einsteigen in ein Wohnhaus überrascht worden. Um der Bestrafung wegen (des vermutlich versuchten) Einbruchdiebstahls oder einem Bewährungswiderruf zu entgehen, erstach er das im Haus lebende Ehepaar mit einem zufällig bereitliegenden Messer. Er konnte zunächst unerkannt entkommen, wurde später aber anhand einer DNA-Spur überführt[216].
78
Wie so oft bei Gewalttaten, die spontan und unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen begangen wurden, stellte sich auch hier zunächst die Frage nach dem Tötungsvorsatz[217], zumal es, um flüchten zu können, objektiv ausgereicht hätte, die Opfer nur zu verletzen. Mit der Mindestfeststellung eines Eventualvorsatzes waren Mordmerkmale zu prüfen, primär die Verdeckungsabsicht[218], eventuell auch Heimtücke[219]. Arglosigkeit der Opfer ließ sich vorliegend nach Auffassung des BGH nicht begründen. Verdeckungsmotive hatten hingegen trotz des womöglich vorherrschenden Fluchtgedankens auf der Hand gelegen. Dann die Beurteilung der Schuldfähigkeit, die nur mit Hilfe eines Psycho-Sachverständigen zu klären war. Für einen Ausschluss des Hemmungsvermögens bzw. einen Vollrausch[220] gab der Sachverhalt nichts her[221]. Die Voraussetzungen des § 21 StGB lagen hingegen positiv vor. Das leitete über zum Problem der Strafrahmenverschiebung gem. § 49 Abs. 1 StGB[222]. Konnte oder musste der Täter aus seinen im Rausch begangenen Vortaten seine Neigung zu rauschbegleiteten Tötungsdelikten entnehmen? Das konnte vorliegend fraglich erscheinen, anders als der Vorwurf, sich ungeachtet einer langjährigen Alkohol- und Drogenkarriere wieder schuldhaft in diesen Zustand versetzt zu haben. War unter diesem Blickwinkel eine Strafrahmenverschiebung abzulehnen, stellte sich das Sonderproblem der nun drohenden lebenslangen Freiheitsstrafe. Es bedarf dann besonders schwerwiegender Gründe, die einer solchen Milderung entgegenstehen[223]. Diese könnten darin zu erblicken sein, dass – die Verminderung der Schuldfähigkeit hinweg gedacht – ein Doppelmord vorläge, hinsichtlich dessen auch mit Blick auf die Vortaten eine besondere Schwere der Schuld (§ 57a Abs. 1 Nr. 2 StGB)[224] festzustellen wäre.
79
Schlussendlich war die Möglichkeit der Anordnung einer Maßregel gem. § 64 StGB – Unterbringung in einer Entziehungsanstalt[225] – oder gem. § 66 StGB – Sicherungsverwahrung[226] – in Erwägung zu ziehen. Ein weites Betätigungsfeld also und eine hohe Verantwortung für den zur „Schadensbegrenzung“ berufenen Strafverteidiger.
8. Gewalttaten psychisch gestörter Täter
80
Fast schon zum „Normalbild“ eines Schwurgerichtsprozesses gehören Angeklagte mit Persönlichkeitsstörungen[227]. Es bedarf stets genauer Prüfung, ob sich die „Störungen“ noch im Spektrum des Normalpsychologischen bewegen oder ob sie, für sich allein oder aber erst in Verbindung mit anderen Defekten, die Annahme verminderter oder – in seltenen Ausnahmefällen – gar in Gänze ausgeschlossener Schuldfähigkeit rechtfertigen. Solche Tatverdächtigen sind als Mandanten nicht immer leicht zu durchschauen, geschweige denn sicher zu führen. Vor allem bei „Borderline“-Gestörten[228] kann es unter der Anspannung der Hauptverhandlung zu unliebsamen Überraschungen kommen, wenn der Betreffende, weil ihm etwas gegen den Strich geht, die Beherrschung verliert und „aus dem Ruder läuft“. Wenn alles gut geht, bleibt es bei einem heftigen Wutausbruch oder der Beschimpfung und Bedrohung eines Zeugen. Der Mandant riskiert „nur“ die (vorübergehende) Anordnung von Hand- oder Fußfesseln[229]. Viel schwieriger ist es, ein womöglich trotzig aufgetischtes Falschgeständnis wieder aus der Welt zu schaffen.
81
Nicht selten haben wir es mit sinnlosen Gewalthandlungen wahnhaft gestörter Täter zu tun, die immens unter den Tatfolgen leiden, ohne sich der eigenen Täterschaft oder einer Schuld bewusst zu sein. Ihre Tat kann sich theoretisch gegen Jedermann richten, Freunde und nahe Angehörige nicht ausgeschlossen. Oft bringen sie grundlos ihre Partnerin um, weil sie einer inneren Stimme folgen oder sich akut bedroht fühlen. Oder es trifft einen wohlmeinenden Geldgeber, dem plötzlich – ohne tatsächliche Anhaltspunkte – finstere Machenschaften unterstellt werden[230].
82
Diese Täter können, sobald nach Einschätzung des Sachverständigen § 20 StGB nicht sicher ausschließbar ist[231], mangels Schuldfähigkeit nicht bestraft werden. Über ihr Schicksal wird zumeist im Sicherungsverfahren (§§ 413 ff. StPO) entschieden, wenn die Voraussetzungen für die Anordnung einer Maßregel vorliegen. Im Jahre 2010 haben Staatsanwälte (wegen aller möglichen Straftaten) rund 500-mal Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens gestellt[232]. Die zum SchwurG eingereichte Antragsschrift der StA steht einer Anklage gleich; die Zulassung erfolgt per Beschluss. Dann findet eine – notfalls auch kontradiktorische – nicht öffentliche Hauptverhandlung statt, die mit den Plädoyers und dem Urteil endet. Dieses kann nur auf Unterbringung oder seine Ablehnung lauten (vgl. § 414 Abs. 2 Satz 4 StPO). Dagegen ist die Revision zum BGH möglich. Einen Freispruch kennt das Sicherungsverfahren nicht[233]. Womöglich ist der Tatverdächtige zugleich verhandlungsunfähig. Dann kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Hauptverhandlung sogar in Abwesenheit des Betroffenen durchgeführt werden (§ 415 StPO).
83
Die Unterbringung gem. § 63 StGB ist einer der denkbar schwersten Eingriffe[234]. Die Verteidigung muss – und sei es im Wege der Revision – gewährleisten, dass die Annahme einer rechtlich erheblichen tatauslösenden Wahnstörung beim Beschuldigten auch tatsächlich gerechtfertigt ist. Dies kann ungeachtet eines insoweit „eindeutigen“ Gutachtens zweifelhaft erscheinen, wie im Fall eines seit einigen Monaten depressiv gestimmten Beschuldigten, der – nicht unerheblich alkoholisiert – eine Bekannte aufgrund eines tags zuvor gefassten Entschlusses aufsuchte, um sie mit einem Beil zu töten. Er hatte sich in sie verliebt und machte sie, die seine Gefühle nicht erwiderte, „in wahnhafter Verkennung der Realität“ für seinen niedergedrückten Zustand verantwortlich. Nachdem er sie mit den Worten „Na du Schlampe, hast du Lust zu sterben?“ angesprochen und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, ging er mit erhobenem Beil auf sie zu, woraufhin sie in Todesangst flüchtete. Der Beschuldigte folgte ihr noch kurz, gab jedoch sein Vorhaben auf, da er dies „doch nicht übers Herz brachte“.
84
Das SchwurG, das ihn gem. § 63 StGB unterbrachte, war – sachverständig beraten – davon ausgegangen, dass beim Beschuldigten eine überdauernde Persönlichkeitsstörung vom schizoid-antisozialen Typ als schwere andere seelische Abartigkeit und zudem im Tatzeitraum eine hierauf gründende wahnhaft-depressive Psychose in der Form eines „sensitiven Beziehungswahns“ als krankhafte seelische Störung bestand. Ob dadurch, wie gem. §§ 21, 63 StGB zu fordern, seine Einsichtsfähigkeit gänzlich fehlte oder nur vermindert war, blieb zweifelhaft. Vom Totschlagsversuch war der Angeklagte jedoch strafbefreiend zurückgetreten[235]. Wegen der verbliebenen Körperverletzung (Faustschlag) und Bedrohung war keine dramatisch hohe Strafe zu befürchten. Für ein echtes Wahnerleben sprach wenig. Der Beschuldigte hatte die Ablehnung der jungen Frau völlig richtig erkannt und dieses – noch nachvollziehbar – als demütigend und herzlos empfunden. Auch dass er sie für seinen unglücklichen Zustand verantwortlich machte, war nicht völlig abwegig. Die weiter angenommene Persönlichkeitsstörung vom schizoid-antisozialen Typ war abzugrenzen gegenüber solchen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die sich noch innerhalb der Bandbreite menschlichen Verhaltens bewegen und Ursache für strafbares Tun sein können, ohne dass sie die Schuldfähigkeit „erheblich“ im Sinne des § 21 StGB berühren[236].
9. Politisch motivierte Gewalttaten
85
Von politisch motivierten Straftaten („Hassdelikten“ bzw. Verbrechen mit fremdenfeindlichem oder antisemitischem Hintergrund), denen „niedrige Beweggründe“ im Sinne des § 211 Abs. 2 StGB[237] zugrunde liegen, sprechen wir, wenn die Umstände der Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen lassen, dass sich der Angriff gegen die politische Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuelle Orientierung, Behinderung oder das äußere Erscheinungsbild bzw. den gesellschaftlichen Status des Opfers richtet[238].
86
Besonders beunruhigend sind und waren durch Fremdenhass induzierte Brandanschläge. Das Jahr 1993 war mit insgesamt 284 gezählten Brandstiftungen und Brandanschlägen hervorstechend. Die Anzahl ist kontinuierlich abgesunken und hat im Jahr 2000 die Zahl von 34 nicht überschritten. Mordanschläge rechter Gewalttäter machen nur einen kleinen Bruchteil der Mordstatistik aus, das jedenfalls wurde von den amtlichen Stellen bislang behauptet. Nachdem im September 2000 der „Tagesspiegel“ vermeldet hatte, dass in der Zeit von 1990 bis Juli 2000 aufgrund rechter Gewalt insgesamt 93 Todesopfer zu beklagen waren, soll eine Überprüfung der Einzelfälle diese Annahme nur in 37 Fällen bestätigt haben; in 57 Fällen soll eine rechtsorientierte Motivation des Täters nicht feststellbar gewesen sein[239]. Die Zahl der politisch motivierten Tötungsdelikte liege für die Jahre 1994 bis 2000 konstant zwischen 8 und 11 Fällen jährlich[240]. Die von rechten Gewalttätern verübten Tötungsdelikte einschließlich Versuche würden zwischen zehn im Jahre 2001 und zwei im Jahre 2005[241] schwanken. Von Gewalttätern des linken Spektrums begangene Tötungsdelikte würden zahlenmäßig zwischen null und drei Taten bzw. Versuchen pro Jahr liegen[242].
87
Heute wissen wir es besser. Seit November 2011 ermittelt der GBA gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der terroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU). Die Gruppierung soll bundesweit für neun Morde an Kleinunternehmern türkischer und griechischer Herkunft in den Jahren 2000 bis 2006, den Mordanschlag auf zwei Polizisten in Heilbronn im April 2007 und zwei Bombenanschläge in Köln 2001 und 2004 verantwortlich sein. Ende 2011 befanden sich bereits vier Beschuldigte in Untersuchungshaft[243].
Teil 1 Einführung › A › V. Verurteilungsmaßstab