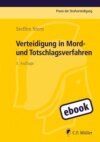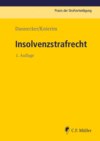Kitabı oku: «Verteidigung in Mord- und Totschlagsverfahren», sayfa 20
Teil 3 Grundzüge des materiellen Kapitalstrafrechts › B. Natürliche Handlungseinheit bei Tötungsdelikten
B. Natürliche Handlungseinheit bei Tötungsdelikten
238
Kommt durch eine bestimmte Handlung, wie etwa durch das Zünden eines Sprengsatzes, eine Mehrzahl von Personen ums Leben, liegt ungeachtet der womöglich sehr hohen Opferzahl Tateinheit im Sinne von § 52 StGB vor und es ist nur auf eine Strafe zu erkennen. Gerade auf dem Gebiet der Kapitaldelinquenz hatte sich der BGH wiederholt mit der Frage zu befassen, ob die sukzessiven Angriffe auf ein und dieselbe Person oder auf eine Mehrzahl von Personen, wenn sie in engem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang erfolgen, als eine einzige oder verschiedene Taten im Rechtssinn zu betrachten sind. Jeweils stand die Annahme natürlicher Handlungseinheiten zur Diskussion. Angesichts extremer Strafandrohungen kann dieser Frage in praxi womöglich große Bedeutung zukommen.
239
Die natürliche Handlungseinheit bewirkt Tateinheit, wenn durch das Geschehen mehrere Strafgesetze verletzt werden oder dasselbe Strafgesetz mehrmals. Die Rechtsprechung erkennt eine natürliche Handlungseinheit im Allgemeinen an, wenn zwischen einer Mehrheit gleichgearteter, strafrechtlich erheblicher Verhaltensweisen, die von einem einheitlichen Willen getragen werden, ein derart unmittelbarer räumlich-zeitlicher (und situativer) Zusammenhang besteht, dass das gesamte Handeln auch für einen Dritten (objektiv) bei natürlicher Betrachtungsweise als ein einheitliches, zusammengehöriges Tun erscheint[1]. Auch hinsichtlich der Frage, ob eine natürliche Handlungseinheit vorliegt, findet der Zweifelssatz Anwendung[2].
Teil 3 Grundzüge des materiellen Kapitalstrafrechts › B › I. Natürliche Handlungseinheit bei mehreren Tatopfern
I. Natürliche Handlungseinheit bei mehreren Tatopfern
1. Tatmehrheit bei höchstpersönlichen Rechtsgütern
240
Im Grundsatz hat der BGH hervorgehoben, dass bei Angriffen auf Leben und Gesundheit einer Mehrzahl von Personen jeweils andere höchstpersönliche Rechtsgüter verletzt werden und mehrere darauf gerichtete Willensbetätigungen weder durch ihre Aufeinanderfolge noch durch einen einheitlichen Tatplan und Vorsatz zu einer natürlichen Handlungseinheit und damit zu einer Tat im Rechtssinne werden können[3]. Es dürfe, so der BGH, nicht außer Acht gelassen werden, dass höchstpersönliche Rechtsgüter verschiedener Personen, insbesondere das Leben von Menschen, einer additiven Betrachtungsweise, wie sie der natürlichen Handlungseinheit zugrunde liege, nur ausnahmsweise zugänglich seien. Greife daher der Täter einzelne Menschen nacheinander an, um jeden von ihnen in seiner Individualität zu vernichten, so bestünde sowohl bei natürlicher als auch bei rechtsethisch wertender Betrachtungsweise selbst bei einheitlichem Tatentschluss und engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang regelmäßig kein Anlass, diese Vorgänge rechtlich als eine Tat zusammenzufassen[4].
2. Ausnahmefälle
241
Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht ausnahmslos; dem BGH zufolge kann eine natürliche Handlungseinheit im Einzelfall auch dann vorliegen, wenn es um die Beeinträchtigung höchstpersönlicher Rechtsgüter verschiedener Personen geht[5]. Die Annahme einer natürlichen Handlungseinheit in derartigen Fällen ist dann gerechtfertigt, wenn eine Aufspaltung in Einzeltaten wegen eines außergewöhnlich engen zeitlichen und situativen Zusammenhangs willkürlich und gekünstelt erscheint[6].
242
Mit Tötungsvorsatz geführte gewalttätige Angriffe gegen mehrere Personen, vor allem mit einem Messer[7] oder einer Schusswaffe[8], stellen sich demnach ausnahmsweise als natürliche Handlungseinheit und damit als eine einzige Tat im Rechtssinne dar, wenn sie von einem einheitlichen Willen getragen sind und aus räumlich sowie zeitlich unmittelbar zusammenhängenden Aktionen bestehen. Ein solcher Ausnahmefall kann etwa bei vier ungezielten Schüssen in schneller Folge[9] oder bei mehreren Schüssen auf zwei Personen innerhalb weniger Sekunden gegeben sein[10] wie auch bei gegen mehrere Opfer gerichteten Tätlichkeiten mit bloßer körperlicher Gewalt[11], zumal dann, wenn die Angriffe zeitgleich und wechselweise erfolgen[12]. Nichts anderes gilt, wenn der Täter aufgrund eines einheitlichen Tötungsentschlusses mit einem Messer wechselseitig, in räumlich und zeitlich unmittelbar zusammenhängender Weise[13] oder innerhalb weniger Sekunden ohne jegliche zeitliche Zäsur[14] mehrfach auf zwei Personen einsticht. Das gilt allerdings nicht, wenn sich der Täter erst während der Tathandlung gegen das erste Opfer zur Tötung des zweiten Opfers entschieden hat[15]. Auch mehrere Schüsse, die der Täter auf irgendwelche anderen Personen abgibt, die er als Zielobjekte aus einer Menge oder Menschengruppe zufällig erfasst, können eine natürliche Handlungseinheit bilden, solange das Verhalten des Täters von einem einheitlichen Willen getragen ist[16].
243
In Fällen der Polizeiflucht bilden alle im Verlauf einer ununterbrochenen Fluchtfahrt begangenen Gesetzesverletzungen nur eine Tat[17]. Auch dann ist natürliche Handlungseinheit anzunehmen, wenn der Täter im Zuge einer Amokfahrt nacheinander mehrere Menschen angreift und sich der Angriff von vornherein gegen eine nicht individualisierte Personenmehrheit richtet, der Kreis der Opfer sich zufällig ergibt und das Geschehen ohne Unterbrechung in einem engen zeitlichen Rahmen (wenige Sekunden) auf der Grundlage eines einheitlichen Tatentschlusses abläuft[18].
244
Die zeitliche Koinzidenz allein genügt für die Annahme einer natürlichen Handlungseinheit allerdings nicht[19]. Ersticht der Vater in einer Nacht seine beiden schlafenden Kinder, liegt nicht nur eine Tat im Rechtssinne vor, wenn zwischen der Tötung eine deutliche zeitliche Zäsur lag, die Tötung in unterschiedlichen Räumen erfolgte und er in der Zwischenzeit eine SMS verschickt und weiter getrunken hatte[20].
245
Hat der Angeklagte bei der Tat das eine Opfer getötet und das andere nur verletzt, tritt unter der Voraussetzung einer natürlichen Handlungseinheit das Körperverletzungsdelikt aus Gründen der Gesetzeskonkurrenz hinter das vorsätzliche Tötungsdelikt zurück. Verurteilt wird nur wegen einer Tat des Mordes oder Totschlags, wobei die Verwirklichung eines weiteren Tatbestands bei der Strafzumessung zuungunsten des Angeklagten berücksichtigt werden kann[21].
Teil 3 Grundzüge des materiellen Kapitalstrafrechts › B › II. Natürliche Handlungseinheit bei mehraktigem Tatgeschehen
II. Natürliche Handlungseinheit bei mehraktigem Tatgeschehen
246
Die mit bedingtem Tötungsvorsatz in Bestrafungsabsicht erfolgte Misshandlung eines Kindes, die das Kind schwer verletzt überlebt, und das – nach einer zeitlichen und situativen Zäsur von 30 Minuten – wohlüberlegte Ertränken des Opfers an anderer Stelle in einem Fluss, um die vorausgegangene Straftat zu verdecken, rechtfertigt in der Regel die Verurteilung wegen versuchten Totschlags und (in Tatmehrheit) wegen Mordes[22]. Natürliche Handlungseinheit ist unter Umständen aber dann gegeben, wenn zwei auf die Tötung eines bestimmten Opfers gerichtete Verletzungsakte durch eine weitere Handlung von nur kurzer Dauer unterbrochen werden, solange der zwischen beiden Akten bestehende enge Zusammenhang hierdurch nicht in Frage gestellt wird[23].
247
So bilden die einer Schussabgabe unmittelbar nachfolgenden Misshandlungen des tödlich getroffenen Opfers mit der vorausgegangenen vorsätzlichen Tötungshandlung ohne Weiteres eine natürliche Handlungseinheit[24]. Ein die natürliche Handlungseinheit begründendes enges zeitlich und räumlich zusammenhängendes Geschehen kann auch dann vorliegen, wenn zwischen einzelnen Akten des Tatgeschehens ein größerer zeitlicher Abstand liegt (20 Minuten), der nach dem Tatentschluss zur Umsetzung der Tat erforderlich war[25]. Mehrere mit demselben Tatwerkzeug gegen das Tatopfer mit Tötungsvorsatz geführte Angriffe können sogar bei einem längeren zeitlichen Zwischenraum von mehr als 30 Minuten eine natürliche Handlungseinheit bilden, wenn die Täter das zunächst nur verletzte Opfer, das sie für tot gehalten haben, nach Erkennen ihres Irrtums töten[26]. Bei einem eng zusammenhängenden, zäsurlosen Geschehen, das auf einer einheitlichen Motivation beruht (z.B. Vergeltung für erlittene Misshandlungen oder Demütigungen), kann allein der Übergang vom Körperverletzungs- zum Tötungsvorsatz die Annahme zweier selbstständiger Taten nicht bewirken[27]. Auch eine Veränderung des Tatplans während der Tatausführung steht dann der Annahme natürlicher Handlungseinheit nicht grundsätzlich entgegen[28]. Auch für die Beurteilung einzelner Versuchstaten (gegen ein und dasselbe Opfer) ist eine entsprechende Gesamtbetrachtung vorzunehmen, wobei allerdings eine tatbestandliche Handlungseinheit mit dem Fehlschlagen des Versuchs endet[29].
248
Allenfalls dann, wenn nach dem für möglich gehaltenen Scheitern des ursprünglichen Tatplans der Täter aufgrund eines neuen Entschlusses das Tatmittel wechselt und mit ihm nacheinander – mit einer deutlichen zeitlichen Zäsur – zwei Opfer tötet, ist der Zusammenhang zwischen den Tatausführungen nicht mehr so eng, als dass die Annahme einer natürlichen Handlungseinheit geboten wäre[30]. Anders als in Fällen, in denen der Täter ohne Zäsur im Tatgeschehen und mit gleicher Motivation vom Körperverletzungs- zum Tötungsvorsatz übergeht, stellt sich ein zweiaktiges Delikt mit Vorliegen einer Zäsur und Änderung der Motivationslage nicht als natürliche Handlungseinheit dar. Auch mehrere selbstständige Mordversuche gegen verschiedene Menschen werden nicht durch andauernde Versuche der räuberischen Erpressung zu einer natürlichen Handlungseinheit verklammert[31].
249
Bei mehraktigem Vorgehen kann aber auch der einheitliche Todeserfolg der Handlung zur Annahme von Tateinheit zwingen: Der Täter hatte die Geschädigte aus Verärgerung über den ihm verweigerten Geschlechtsverkehr zunächst mit bedingtem Tötungsvorsatz fünfzehn Sekunden lang gewürgt, hatte dann, als diese laute Todesschreie ausstieß, ihr – um auch seine Strafverfolgung zu verhindern – mehrfach mit Tötungsabsicht mittels eines Zimmermannshammers Schläge auf den Kopf versetzt und hatte schließlich in der irrigen Annahme, sie sei tot, einen Wohnungsbrand gelegt. Sie verstarb an den Folgen der Halskompression, des Schädel-Hirn-Traumas und der Brandverletzungen; jede der Verletzungen hätte für sich genommen in unterschiedlichem Zeitablauf zum Tode geführt. Während das SchwurG von Tatmehrheit zwischen Mord und Brandstiftung mit Todesfolge ausgegangen war, stellte der BGH klar, dass die Geschädigte infolge der Kombination aller gegen sie gerichteten Gewalthandlungen, auch des Brandes, verstorben war, sodass der einheitliche Erfolg der Handlung – der Tod der Geschädigten – die Straftatbestände des Mordes und der qualifizierten Brandstiftung zur Tateinheit verband[32].
250
Ist nicht aufklärbar, ob eine dem Tötungsdelikt unmittelbar vorausgegangene Körperverletzungshandlung nicht auch mit Tötungsvorsatz erfolgt war, ist die Annahme zweier selbstständiger Taten verwehrt und stattdessen nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ das Gesamtgeschehen als ein in natürlicher Handlungseinheit begangenes vorsätzliches Tötungsdelikt zu werten[33]. Versucht der Staatsanwalt, zusammenhängende Sachverhalte künstlich aufzuspalten, um mit Hilfe mehrerer Freiheitsstrafen eine möglichst hohe Gesamtstrafe fordern zu können, ist dem unter Hinweis auf diese BGH-Rechtsprechung entgegenzutreten.
Teil 3 Grundzüge des materiellen Kapitalstrafrechts › B › III. Tatrichterlicher Beurteilungsspielraum
III. Tatrichterlicher Beurteilungsspielraum
251
Im Einzelfall kann die Frage, ob natürliche Handlungseinheit oder Tatmehrheit vorliegt, einen Beurteilungsspielraum für den Tatrichter eröffnen. Die Überprüfung durch das Revisionsgericht ist dann darauf beschränkt, ob die tatrichterliche Bewertung vertretbar ist und nicht von unzutreffenden Maßstäben ausgeht. Hält sie dieser Überprüfung stand, so ist sie – unbeschadet der Frage, ob auch eine andere Beurteilung möglich wäre – vom Revisionsgericht hinzunehmen[34].
Anmerkungen
[1]
BGH Beschl. v. 18.04.1996 – 4 StR 89/96, StV 1996, 481; Urt. v. 27.03.1953 – 2 StR 801/52, BGHSt 4, 219 [220]; Urt. v. 16.07.1968 – 1 StR 25/68, BGHSt 22, 206 [209] = NJW 1968, 1973.
[2]
BGH Urt. v. 15.06.2005 – 1 StR 499/04, NStZ-RR 2007, 195; für mehraktiges Geschehen.
[3]
BGH Urt. v. 19.11.2009 – 3 StR 87/09, NStZ-RR 2010, 140.
[4]
BGH Urt. v. 24.02.1994 – 4 StR 683/93, StV 1994, 537 [538].
[5]
BGH Urt. v. 01.04.2009 – 2 StR 571/08, NStZ 2009, 501 = StraFo 2009, 246.
[6]
BGH Urt. v. 19.11.2009 – 3 StR 87/09, NStZ-RR 2010, 140; Urt. v. 28.10.2004 – 4 StR 268/04, NStZ 2005, 262.
[7]
BGH Urt. v. 07.10.1997 – 1 StR 418/97, NStZ-RR 1998, 203; Beschl. v. 14.02.1990 – 2 StR 34/90, StV 1990, 544.
[8]
BGH Beschl. v. 24.10.2000 – 5 StR 323/00, NStZ-RR 2001, 82.
[9]
BGH Urt. v. 31.07.1996 – 1 StR 270/96, StV 1997, 128
[10]
BGH Urt. v. 09.09.2003 – 5 StR 126/03, StV 2004, 205 = NStZ-RR 2004, 14; Beschl. v. 24.10.2000 – 5 StR 323/00, NStZ-RR 2001, 82.
[11]
BGH Urt. v. 06.02.2003 – 4 StR 450/02.
[12]
BGH Urt. v. 18.12.2002 – 2 StR 149/02, NStZ 2003, 366.
[13]
BGH Beschl. v. 16.10.2001 – 4 StR 415/01.
[14]
BGH Beschl. v. 21.11.2000 – 4 StR 354/00, NJW 2001, 838
[15]
BGH Urt. v. 28.10.2004 – 4 StR 268/04, NStZ 2005, 262.
[16]
BGH Urt. v. 18.12.1984 – 1 StR 596/84, NJW 1985, 1565; Maiwald, JR 1985, 512.
[17]
BGH Beschl. v. 08.07.1997 – 4 StR 271/97, NStZ-RR 1997, 331.
[18]
BGH Urt. v. 16.08.2005 – 4 StR 168/05, NStZ 2006, 167.
[19]
BGH Urt. v. 07.10.1997 – 1 StR 418/97, NStZ-RR 1998, 203.
[20]
BGH Beschl. v. 28.03.2007 – 2 StR 62/07, NJW 2007, 1540.
[21]
BGH Beschl. v. 23.08.2011 – 4 StR 308/11.
[22]
BGH Urt. v. 09.04.1997 – 3 StR 612/96, NStZ 1997, 434.
[23]
BGH Beschl. v. 25.11.1992 – 3 StR 520/92, NStZ 1993, 234.
[24]
BGH Beschl. v. 17.06.1998 – 3 StR 118/98, NStZ 1998, 621.
[25]
BGH Urt. v. 21.10.1986 – 1 StR 501/86, StV 1987, 389.
[26]
BGH Urt. v. 16.05.1990 – 2 StR 143/90, NStZ 1990, 490.
[27]
St. Rspr.; BGH Urt. v. 01.06.2006 – 3 StR 77/06, NStZ 2006, 712 = StV 2007, 17.
[28]
BGH Urt. v. 19.10.2011 – 1 StR 273/11.
[29]
BGH Urt. v. 25.11.2004 – 4 StR 326/04, NStZ 2005, 263.
[30]
BGH Urt. v. 13.09.1995 – 3 StR 221/95, NStZ 1996, 129; v. Heintschel-Heinegg, JABl 1996, 537.
[31]
BGH Beschl. v. 22.10.1997 – 3 StR 419/97, NStZ 1999, 80 = StV 1998, 70.
[32]
BGH Urt. v. 09.12.2009 – 5 StR 403/09, StraFo 2010, 122.
[33]
BGH Beschl. v. 18.10.2001 – 3 StR 387/01, NStZ-RR 2002, 75 = StV 2002, 601.
[34]
BGH Urt. v. 03.09.2002 – 5 StR 139/02, NStZ 2003, 146; Urt. v. 25.09.1997 – 1 StR 481/97, NStZ-RR 1998, 68 = StV 1998, 204.
Teil 3 Grundzüge des materiellen Kapitalstrafrechts › C. Dogmatischer Dissens um Mord und Totschlag
C. Dogmatischer Dissens um Mord und Totschlag
Teil 3 Grundzüge des materiellen Kapitalstrafrechts › C › I. Die Rechtsprechung ignoriert Lehre und Schrifttum
I. Die Rechtsprechung ignoriert Lehre und Schrifttum
252
Während Lehre und Schrifttum[1] nahezu einhellig im Mord nichts anderes als einen qualifizierten Totschlag erblicken (Verwirklichung des Totschlagstatbestands sowie zusätzlich eines der in § 211 Abs. 2 StGB genannten Mordmerkmale), hält der BGH unbeirrt seiner Auffassung von der Selbstständigkeit der Tatbestände von Mord und Totschlag die Treue[2]. Allerdings hat der 5. Strafsenat des BGH in einem „obiter dictum“ Bedenken geäußert, an der bisherigen Spruchpraxis des BGH festzuhalten[3]. Eine Neuorientierung der Rechtsprechung scheint überfällig[4].
253
Dem BGH zufolge sind Mordmerkmale nicht als Strafschärfungsgründe zu betrachten, sondern als eigenständige Umstände, die die Mordstrafe begründen. Der BGH hat die Notwendigkeit einer restriktiven Auslegung der Mordmerkmale hervorgehoben; es seien hohe Anforderungen an die Abgrenzung des Mordtatbestands vom Tatbestand des Totschlags zu stellen[5].
Teil 3 Grundzüge des materiellen Kapitalstrafrechts › C › II. Die praktischen Konsequenzen
II. Die praktischen Konsequenzen
254
Die praktischen Konsequenzen dieses Meinungsstreits[6] lassen sich wie folgt skizzieren:
1. Problem der disgruenten Tatbeteiligung
255
Die dogmatischen Schwierigkeiten beginnen, sobald an einem Tötungsdelikt mehrere Tatbeteiligte mitwirken, von denen nicht alle ein und dasselbe oder überhaupt ein Mordmerkmal verwirklichen.
a) Mittäterschaft bei Mord und Totschlag
256
Dass Mord und Totschlag in Mittäterschaft begangen werden können, leitet die Lehre[7] zwanglos aus § 28 Abs. 2 StGB her, wonach eine Strafschärfung aufgrund besonderer persönlicher Merkmale nur für den Täter oder Teilnehmer in Betracht kommt, bei dem diese Merkmale vorliegen. Der Rechtsprechung hingegen ist der Rückgriff auf § 28 Abs. 2 StGB, der nur strafschärfende, nicht aber strafbegründende Umstände erfasst, naturgemäß versperrt. Und § 28 Abs. 1 StGB, der das Fehlen strafbegründender Merkmale regelt, gilt erklärtermaßen nur für den Anstifter oder Gehilfen. Grundsätzliche Bedenken des 4. Strafsenats des BGH[8] gegen die Annahme von Mittäterschaft bei Mord und Totschlag hat der 1. Strafsenat des BGH[9] allerdings später beherzt überwunden und darauf verwiesen, dass eine Zurechnung von Tatbeiträgen über § 25 Abs. 2 StGB nicht notwendig die Verletzung (völlig) identischer Strafgesetze voraussetze. Zutreffend weist Beulke[10] darauf hin, dass die Kontroverse über das Verhältnis von §§ 211, 212 StGB (nunmehr) für den Bereich der Mittäterschaft irrelevant sei.
b) Beihilfe und Anstiftung
257
Zu teilweise grundverschiedenen Ergebnissen führt der Meinungsstreit hingegen bei den übrigen Beteiligungsformen. Hauptfrage: Ist (etwa mit Blick auf § 28 StGB) der Mordtatbestand auch für den Gehilfen oder Anstifter zugrunde zu legen, der selbst kein Mordmerkmal erfüllt, und was gilt im umgekehrten Fall, wenn sich Mordmerkmale möglicherweise nur beim Gehilfen oder Anstifter vorfinden?
258
Bei den persönlichen Merkmalen im Sinne von § 28 StGB ist stets zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen zu unterscheiden; nur den täterbezogenen Merkmalen kommen die in § 28 StGB genannten Rechtswirkungen zu[11]. Folglich ist auch bei der (disgruenten) Beteiligung an einem Kapitaldelikt zunächst zwischen tatbezogenen oder personenbezogenen Mordmerkmalen zu differenzieren. Jedoch herrscht schon bei der Einordnung nicht immer Einigkeit.
259
Tatbezogen sind nach wohl h.M. die Mordmerkmale „heimtückisch“, „mit gemeingefährlichen Mitteln“, „grausam“. Als täterbezogene (personenbezogene) Mordmerkmale gelten nach wohl überwiegender Ansicht „aus Mordlust“, „zur Befriedigung des Geschlechtstriebs“, um „eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken“, „aus Habgier“ oder „sonst aus niedrigen Beweggründen“[12].
260
Wegen Beihilfe zum Mord aus niedrigen Beweggründen z.B. können Gehilfen also nur dann verurteilt werden, wenn der Täter aus niedrigen Beweggründen gehandelt hat und sie selbst als Gehilfen ihre Tatbeiträge entweder ebenfalls aus niedrigen Beweggründen oder in Kenntnis der niedrigen Beweggründe des Täters erbracht haben[13].
261
Anstiftung zum Heimtücke-Mord setzt voraus, dass der Anstifter die Möglichkeit einer heimtückischen Begehungsweise, wenn auch nicht unbedingt gewollt, so doch zumindest vorhergesehen und billigend in Kauf genommen hat[14].
262
| Mordmerkmal | täter-/personenbezogen | tatbezogen | |
|---|---|---|---|
| Begehungsweise | Heimtücke | hM; BGH Urt. v. 24.11.2005 – 4 StR 243/05, NStZ 2006, 288 | |
| Grausamkeit | hM; BGHSt 23, 123; 24, 106, | ||
| Gemeingefährliche Mittel | hM; BGH Urt. 13.05.1971– 3 StR 337/68, juris | ||
| besonderes Tatmotiv | Niedriger Beweggrund | hM; BGH Urt. v. 10.06.09 – 4 StR 645/08, NStZ 2009, 627* | |
| Habgier | hM; BGH Urt. v. 16.07.2003 – 2 StR 68/03, StV 2004, 355 | ||
| Mordlust | hM | ||
| Motiv der Triebbefriedigung | hM | ||
| Absicht des Täters | Verdeckung und Straftatermöglichung | hM; BGH NStZ-RR 2002, 139; BGHSt 23, 36 |
| * | Ausnahmefälle BGH Urt. v. 19.10.2001 – 2 StR 259/01, BGHSt 47, 128 [131] mwN. = NStZ 2002, 84 |
263
| Täter | Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verwirklicht | Wissensstand des Teilnehmers | Teilnehmer erfüllt kein eigenes Mordmerkmal | Teilnehmer erfüllt aber eigenes Mordmerkmal | ||||
| ↓ | tatbezogenes Mordmerkmal | personenbezogenes Mordmerkmal | |||||
| § 211 StGB | Lit. | Rspr. | Lit. | Rspr. | Lit. | Rspr. | |
| durch tatbezogenes Mordmerkmal z.B. (Heimtücke) | hat keine Kenntnis vom Mordmerkmal beim Täter | allg. Ansicht §§ 212, 26/27über§ 16 I | allg. Ansicht §§ 212, 26/27 | §§ 211, 26/27 über § 28 II | §§ 212, 26/27 ggf. § 212 II | ||
| kennt Mordmerkmal beim Täter | allg. Ansicht §§ 211, 26/27 | ||||||
| durch personenbezogenes Mordmerkmal z.B. (Mordlust) | weiß nichts vom Mordmerkmal beim Täter | allg. Ansicht §§ 212, 26/27 | §§ 212,26/27 über§ 28 II | §§ 212, 26/27 | §§ 211, 26/27 über § 28 II | §§ 212, 26/27 | |
| über § 28 II | über § 16 I | ||||||
| kennt Mordmerkmal beim Täter | §§ 212, 26/27 | §§ 211, 26/27 | §§ 211, 26/27 jedoch Milderung gem. § 28 I | §§ 211, 26/27 aber keine Milderung gem. § 28 I bei sich überkreuzenden* Merkmalen | |||
| über § 28 II | jedoch Milderung gem. § 28 I | ||||||
| § 212 StGB | allg. Ansicht §§ 212, 26/27 | allg. Ansicht §§ 212, 26/27ggf. § 212 II oder§§ 211, 30 | §§ 211, 26/27 über§ 28 II | §§ 212, 26/27 ggf.§ 212 II | |||
| * | z.B. Handeln aus unterschiedlichen niedrigen Beweggründen: BGH Urt. v. 24.05.1968 – 5 StR 704/68, BGHSt 23, 39 ; hierzu Arzt JZ 1973, 682 ff. ; BGH Urt. v. 12.01.2005 – 2 StR 229/04, StraFo 2005, 211. |