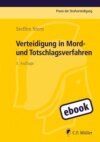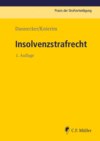Kitabı oku: «Verteidigung in Mord- und Totschlagsverfahren», sayfa 22
5. Strenge Anforderungen an die Darlegungspflicht des Tatrichters
294
Aufgrund der Hemmschwellen-Lehre gelten, wenn der Tötungsvorsatz (auch) aus dem äußerst gefährlichen Handeln hergeleitet wird, besondere Anforderungen an die Feststellung des inneren Tatbestandes und seiner Darlegung in den Urteilsgründen (gesteigerte Feststellungs- und Darlegungspflicht)[35]. Der BGH verpflichtet den Tatrichter, alle Umstände, die für die Annahme oder die Verneinung bedingten Tötungsvorsatzes Relevanz erlangen können, insbesondere jene zur subjektiven Tatseite, zu berücksichtigen, diese in den Urteilsgründen mitzuteilen und – nachvollziehbar – erschöpfend zu würdigen. Beide Elemente der inneren Tatseite, also sowohl das Wissens- als auch das Willenselement, müssen in jedem Einzelfall nicht nur besonders geprüft, sondern auch durch tatsächliche Feststellungen belegt werden[36]. Die Würdigung hierzu muss sich mit den Feststellungen des Urteils zur Persönlichkeit des Angeklagten auseinandersetzen und auch die zum Tatgeschehen bedeutsamen Umstände mit in Betracht ziehen[37].
295
Es muss andererseits – vor allem bei Verneinung des Tötungsvorsatzes – auch aus der Urteilsbegründung erkennbar werden, dass der offensichtlichen Lebensgefährlichkeit des Angriffs in dem gebotenen Maße das für die Annahme eines bedingten Tötungsvorsatzes indizielle Gewicht beigemessen wurde[38].
296
Wird das Opfer absichtlich in einer Weise verletzt, die ganz offensichtlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit – etwa einem gezielten Stich in das Herz vergleichbar – zum Tode führt[39], so liegt (zumindest) bedingter Tötungsvorsatz auf der Hand, ohne dass es dafür besonderer Anforderungen an die Darlegung der inneren Tatseite in den Urteilsgründen bedarf. Das hat der BGH zum Beispiel bei zwei kraftvollen Hammerschlägen auf den Hinterkopf des Opfers entschieden[40]. Der BGH gebraucht in diesen Evidenz-Fällen zuweilen auch die Formulierung, die Tatausführung belege bereits selbst, dass der Täter bei der Tat mit Tötungsvorsatz gehandelt habe[41].
297
Dass eine Handlung generell geeignet ist, tödliche Verletzungen herbeizuführen, macht hingegen eine sorgfältige Prüfung des Tötungsvorsatzes nicht entbehrlich[42]. Selbst die offen zu Tage getretene Lebensgefährlichkeit zugefügter Verletzungen ist nur ein mehr oder weniger gewichtiges Indiz, nicht aber ein zwingender Beweis für (bedingten) Tötungsvorsatz des Täters[43]. Das folgt bereits aus der Existenz der Strafvorschrift des § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB. Der auf eine vorsätzliche Körperverletzung „mittels einer das Leben gefährdenden Handlung“ gerichtete Vorsatz (Körperverletzungsvorsatz) ist streng von dem Vorsatz zu unterscheiden, einen Menschen mittels einer (auch) im Sinne von § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB tatbestandsmäßigen Handlung zu töten (Tötungsvorsatz). Auch wer die „Gefährlichkeit der Verletzungshandlung“ erkannt hat, muss sich nicht bewusst mit dem Tod des Geschädigten abgefunden, diesen also nicht innerlich gebilligt haben[44], weshalb auch Zweifel am bedingten Tötungsvorsatz der Annahme vorsätzlichen Handelns nach § 224 StGB mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung (Abs. 1 Nr. 5) nicht entgegen stehen[45].
6. Zur Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände
298
Bei der gebotenen Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände können – je nach Eigenart des Falles – unterschiedliche Wertungsgesichtspunkte im Vordergrund stehen. Welche Aspekte zwingend zu erörtern sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Hier ist es unbedingt zu empfehlen, sich mit den unterschiedlichen, in der Rechtsprechung des BGH zur Hemmschwellen-Lehre vorzufindenden Beurteilungsgesichtspunkten vertraut zu machen.
a) Objektive Tatumstände
299
Zu den Gesichtspunkten, die in eine umfassende Würdigung der objektiven Tatumstände mit einzubeziehen sind, zählen die konkrete Tatsituation, insbesondere die konkrete Angriffsweise sowie Lage und Abwehrmöglichkeit des Opfers[46], aber auch das Verletzungsbild[47]. Gegen Tötungsvorsatz kann sprechen, dass der Täter dem Opfer „nur einmal“ und mit „deutlich verminderter Wucht“ in den Rücken gestochen und sodann (nur noch) „unter Verzicht auf den weiteren Einsatz des Messers“ mehrfach auf ihn eingetreten hat[48].
300
Auch kann von Bedeutung sein, dass das Geschehen vor zahlreichen Zeugen stattfindet, der Täter also mit seiner Überführung rechnen muss. Dies kann dafür sprechen, dass er zwar die Gefährdung, nicht aber den Tod des Kontrahenten in sein Bewusstsein und in seinen Willen aufgenommen hatte[49].
b) Individueller Beurteilungsmaßstab
301
An die objektive Größe und Nähe der Todesgefahr kann allerdings nur dann angeknüpft werden, wenn der Täter sich der Gefahr zum Zeitpunkt der Tatausführung tatsächlich bewusst war[50]. Dieses Bewusstsein kann insbesondere infolge einer durch Affekt, Alkohol oder Drogen erklärbaren psychischen Beeinträchtigung oder aufgrund einer hirnorganischen Schädigung gefehlt haben[51]. Maßstab ist nicht „jeder Normaldenkende“, sondern allein, ob gerade der Angeklagte unter Berücksichtigung aller objektiven und subjektiven Umstände der Tat in der konkreten Situation die tödlichen Gefahren erkannt und den Todeserfolg innerlich gebilligt hat[52].
302
Die Art der Ausführung sowie die von der Tat ausgehende Gefährlichkeit können sich auch angesichts des Kenntnisstandes des Täters relativieren[53]. Man ist als Verteidiger immer wieder erstaunt, wie mangelhaft die anatomischen Kenntnisse gerade junger Männer mit schlechter Schulbildung sind, die als Gewalttäter in Erscheinung treten. Es ist keineswegs ohne Weiteres davon auszugehen, dass der Täter sich aufgrund „laienhaften Verständnisses medizinischer Kenntnisse“ darüber im Klaren ist, mit zwei Stichen in die Leistengegend „lebenswichtige Blutgefäße wie die Oberschenkelschlagader“ treffen und das Opfer dadurch töten zu können[54]. Die Todesgefahr kann verkannt worden sein, wenn bei ähnlich riskantem Vorverhalten des Täters schwerwiegende Folgen ausgeblieben sind, wie beispielsweise bei der Verabreichung eines lebensgefährdenden Medikaments über einen langen Zeitraum, um das Kind ruhig zu stellen[55], oder bei der Anwendung gefährlicher Sexualpraktiken, wenn diese bis dahin immer folgenlos geblieben sind und das Todesrisiko stets beherrscht wurde[56].
c) Persönlichkeit des Täters
303
Von Rechts wegen ist nicht zu beanstanden, wenn der Tatrichter – auch nur bedingten – Tötungsvorsatz trotz brutalen und rücksichtslosen Vorgehens der Täter nicht mit letzter Sicherheit festzustellen vermag und hierbei „das Alter, die mangelnde Lebenserfahrung, die hohen Defizite der Angeklagten auf ethischem Gebiet und die sonstigen Persönlichkeitsakzentuierungen“ berücksichtigt[57]. Insbesondere das voluntative Vorsatzelement, also die billigende Inkaufnahme des Todes, kann zweifelhaft erscheinen, wenn sich der hochgradig erregte Angeklagte in einem affektiven Ausnahmezustand befunden hat, obwohl er von Zeugen als ruhiger, besonnener Mensch geschildert wird, der kaum aus der Ruhe zu bringen sei und in der Hauptverhandlung den Eindruck eines aggressionsgehemmten, nicht gewalttätigen, nicht leicht zu provozierenden Menschen gemacht hat[58], wie umgekehrt ein starker Mangel an Ausgeglichenheit und Besonnenheit sowie die Neigung zu impulsiven Gewaltreaktionen aus nichtigem Anlass womöglich befürchten lassen, dem Angeklagten seien die Konsequenzen seines Handelns eventuell sogar unter Inkaufnahme tödlicher Folgen gleichgültig gewesen[59].
d) Vorleben des Täters
304
Aus dem Vorleben des Täters, vor allem aus Vorstrafen wegen gefährlicher Körperverletzung[60], können sich Hinweise auf seine Einstellung zu den geschützten Rechtsgütern ergeben[61].
e) Beziehung des Täters zum Opfer
305
Auch die Beziehung des Täters zum Opfer ist zu berücksichtigen[62]. Je größer die Wertschätzung oder gar Zuneigung gegenüber dem Opfer, desto fernliegender die Annahme, der gefährlich handelnde Täter habe dessen Tod billigend in Kauf genommen.
f) Die Beweggründe des Täters
aa) Motivlage
306
Gegen Tötungsvorsatz spricht überdies, wenn ein einsichtiger Beweggrund für eine so schwere Tat wie die Tötung eines Menschen fehlt[63]. Der Beweggrund einer mit bedingtem Tötungsvorsatz verübten Tat ist etwas anderes als das einer mit Tötungsabsicht (dolus directus I) verübten Tat zugrunde liegende „Tötungsmotiv“. Der mit bedingtem Tötungsvorsatz Handelnde verfolgt mit seiner Tat andere Ziele als die der Tötung eines Menschen. Er verfügt deshalb in Verfolgung seines anders gelagerten Handlungsantriebs in der Regel über kein eigentliches Tötungsmotiv[64]. Es geht vielmehr um die für sein Vorgehen bestimmenden Beweggründe und die Frage, ob die durch seine Zielvorstellungen ausgelösten Handlungsanreize oder -impulse überhaupt stark genug sind, um gerade ihn dazu zu bringen, bewusst und gewollt die Tötungshemmschwelle zu überschreiten und die Vernichtung menschlichen Lebens billigend in Kauf zu nehmen[65].
bb) Interessenlage
307
Vor allem interessenwidrige Tatfolgen widerstreiten der Annahme der Billigung eines tödlichen Tatverlaufs. Je unbedeutender das primäre Handlungsziel (Gefährdung des Opfers aus Geltungsstreben, Körperverletzung als Denkzettel) und je unwillkommener dem Handelnden die Tatfolgen sein dürften, weil sie ihm selbst schaden (Verlust einer geliebten, sehr nahestehenden Person; Zerstörung der eigenen Unterkunft durch Explosion, dauerhaft drohende Vergeltungsaktionen), desto unwahrscheinlicher ist die Annahme eines in kognitiver und voluntativer Hinsicht vorliegenden bedingten Tötungsvorsatzes.
308
Der bereits angesprochene „Armbrust-Fall“[66] ist ein Musterbeispiel dafür, wie bereits die Interessenlage des Täters und seine Verbundenheit mit dem Opfer[67] die billigende Inkaufnahme einer Tötung und damit die Annahme eines Eventualvorsatzes fernliegend erscheinen lassen kann. Das gilt umso mehr, wenn über das Fehlen eines nachvollziehbaren Tötungsmotivs hinaus dem Tatgeschehen auch kein vergleichbares Vorverhalten des Angeklagten entspricht[68]. Ist im Einzelfall der Grund für ein gewalttätiges Vorgehen des Angeklagten gegen einen anderen nicht bekannt, kann aus Art und Schwere der Körperverletzung allein nicht auf das Vorliegen eines Tötungsvorsatzes geschlossen werden; dazu bedarf es in diesem Fall weiterer (zusätzlicher) aussagekräftiger Indizien[69]. Von Interesse sind namentlich das Ziel und der Beweggrund für die Tat, die Art der Ausführung, die von der Tat ausgehende Gefährlichkeit, der Kenntnisstand des Täters, aber auch seine psychische Verfassung[70].
g) Äußerungen des Täters vor, bei oder nach der Tat
309
Auch Äußerungen vor, bei oder nach der Tat können mitunter Rückschlüsse darauf gestatten, wie der Täter die Vernichtung menschlichen Lebens im Allgemeinen oder im konkreten Fall beurteilt[71].
310
Entlastend sind unmittelbar im Anschluss an das Tatgeschehen geäußerte Worte des Erschreckens und des Bedauerns, wie etwa nach einem tödlichen Streit: „Oh Gott, ich habe sein Herz getroffen. Du darfst nicht sterben. Hätten wir doch nur unsere Schnauze gehalten“[72].
311
Als Indiz, das bedingten Tötungsvorsatz in Frage stellen konnte, war im Rahmen der Gesamtbetrachtung zwingend die betroffene Reaktion eines Polizeibeamten zu berücksichtigen, der nachts flüchtenden Einbrechern nachgeeilt war und einen von ihnen mit einem Schuss tödlich getroffen hatte. Nach Kenntnisnahme vom Tod des Einbrechers äußerte er „Ach du Scheiße“ und setzte sich benommen wirkend, so als könne er nicht glauben, was passiert sei. Später weinte er und äußerte fassungslos, fast wie im Selbstgespräch: „Auf dem Schießstand trainiert man so etwas ständig und trifft so gut wie nie, und nun reicht ein Schuss“[73].
312
Gegen Tötungsvorsatz sprach in einem anderen Fall nach Auffassung des BGH[74], dass der Messerstecher seinem Opfer, das schwer verletzt davonrannte, nachrief: „Geh weg, du Penner“ und „Lauf weg, sonst bring ich dich um!“. Der Wortlaut könne darauf hindeuten, dass der Täter, als er dem Fliehenden nacheilte, nur noch seinen Gegner verjagen und nicht mehr töten wollte.
313
Bei spontanen Äußerungen anlässlich der Festnahme ist zu bedenken, dass sie möglicherweise nicht die Vorstellung des Angeklagten zum Zeitpunkt des Angriffs und mithin nicht die subjektive Seite des Tatgeschehens widerspiegeln[75].
314
Keinen untrüglichen Beleg für Tötungsvorsatz hat der BGH in folgenden Äußerungen gesehen: Erklärt der Angeklagte nach der Flucht vom Tatort gegenüber den anderen Beteiligten: „Wenn ich ein Messer gehabt hätte, hätte ich ihn abgestochen“, ist es von Rechts wegen nicht zu beanstanden, wenn das Tatgericht hieraus keinen „zweifelsfreien Rückschluss“ auf einen Tötungsvorsatz zieht, weil die Erklärungen seinem Bedürfnis entsprungen seien, sich hervorzutun und vor seinen Bekannten zu prahlen. Diese Beurteilung des Nachtatverhaltens sei, so der BGH, sicher nicht die einzig mögliche. Sie sei aber in sich widerspruchsfrei, ließe auch keine sonstigen Rechtsfehler erkennen und sei daher hinzunehmen[76].
315
Allein die Äußerung des Angeklagten: „Ich bringe euch um!“, belegt keinen natürlichen Tötungsvorsatz, wenn der Täter das Opfer in der Vergangenheit schon öfter mit dem Tode bedroht hatte, ohne dass die Ernsthaftigkeit der Äußerungen festgestellt werden konnte[77]. Soweit in zeitlicher Nähe zum Tatgeschehen Drohungen erfolgen, wie etwa: „Ich bringe dich um!“ oder „Ich schmeiß dich aus dem Fenster!“, so hat der BGH darauf hingewiesen, dass solche Äußerungen möglicherweise nicht wörtlich gemeint gewesen seien[78]. Vom Täter im Vorfeld geführte Reden, das spätere Opfer „vom Balkon werfen“, es „einbuddeln“ oder „in einen Fluss werfen“ zu wollen, können u.U. reine „Spekulationen“ darstellen, die „ziellos“ und „halbherzig“ geäußert wurden, durch das weitere Tatgeschehen aber als überholt zu erachten sind[79]. Auch der wütende Ausruf des mit einem Messer angreifenden Täters: „Ich stech dich ab!“ oder „Ich mach dich platt!“, gibt für einen Tötungsvorsatz nichts her, wenn die Äußerung unter den gegebenen Umständen ebenso gut mit einem bloßen Körperverletzungsvorsatz vereinbar ist[80], oder vielleicht auch nur eine Machtdemonstration[81] bzw. den Versuch darstellte, das Opfer in Todesangst zu versetzen („Du Hure, Du sollst sterben für das, was Du mir angetan hast“)[82]. Vergleichbares gilt für die Äußerung des Täters gegenüber dem verletzt am Boden liegenden Opfer: „Leg dich niemals mit einem Albaner an, sonst wirst du sehen, was passiert.“, wenn anzunehmen ist, dass der Täter nur einschüchternd, erzieherisch und belehrend auf das Opfer einwirken wollte[83].
316
Kehrt das durch eine Messerattacke nicht lebensbedrohlich verletzte Opfer, nachdem es geflüchtet war, an den Tatort zurück, ist der Ausruf des Täters „Lebst du noch?“ nicht als erstaunte Frage, sondern als erneute Drohung aufzufassen, wenn daraufhin das Opfer erneut flüchtet und der unbewaffnete Täter ihm folgt, um ihn (ohne bedingten Tötungsvorsatz) zu schlagen und zu verletzen[84].
317
Als Indiz für einen bedingten Tötungsvorsatz muss hingegen gewürdigt werden, wenn der mit einem Rechen beidhändig zuschlagende Täter erneut angreift und dabei äußert: „Ich schlag dich tot!“[85] oder der Gewalttat eine per SMS gestellte Frage an den Mittäter vorausgeht, ob man das Opfer „abmurksen“ wolle[86]; ebenso wenn der Beschuldigte, der einen nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten nach der Drohung: „Ich mache dich alle“, mit einem Totschläger attackiert hatte, bei seiner Vernehmung am Tag nach der Tat äußert, er hätte, wenn er ein Messer dabeigehabt hätte, „den Bullen abgestochen“[87]. Einem unbewaffneten Mittäter, der nur mit den Fäusten eingegriffen hatte, konnte bedingter Tötungsvorsatz angelastet werden, weil er den Haupttäter mit den Worten angestachelt hatte: „Schlag ihn tot, schlag ihn tot!“. Auch die nachträgliche Äußerung des Täters, das Opfer könne sich (für sein Überleben) bei den eingeschrittenen Zeugen bedanken, lässt u.U. erkennen, dass der Beschuldigte die Todesgefahr zutreffend erkannt und ihre Verwirklichung jedenfalls in Kauf genommen hatte[88].
h) Unüberlegte Spontantaten
318
Gerade unüberlegte Spontantaten geben dem BGH immer wieder Veranlassung, eine besonders sorgfältige Prüfung einzufordern, ob im Einzelfall auch das – selbstständig neben dem Wissenselement stehende – voluntative Vorsatzelement gegeben ist[89].
i) Psychische Verfassung
319
Von Interesse sind nicht nur das Ziel und der Beweggrund für die Tat, die Art der Ausführung, die von der Tat ausgehende Gefährlichkeit und der Kenntnisstand des Täters, sondern auch seine psychische Verfassung[90].
j) Gewalttaten unter Alkohol-, Medikamenten- und Drogeneinfluss
320
Bei der erforderlichen Gesamtwürdigung ist auch zu berücksichtigen, ob bei einem unter erheblicher Rauschgift- oder Alkoholeinwirkung stehenden Angeklagten sowohl das Erkennen als auch die Billigung möglicher Folgen seines Tuns durch Intoxikation maßgeblich beeinflusst sein kann[91]. Nicht selten wirken Alkohol und Drogen kumulativ. Das voluntative Element kann zweifelhaft erscheinen, wenn die Tat aus einem spontanen, intoxikationsbedingten Handlungsimpuls heraus begangen wurde[92]. Nach Auffassung des BGH liegt es allerdings nur in Fällen außergewöhnlich hoher Alkohol- und Drogenintoxikation auf der Hand, dass es neben der Beeinträchtigung des Hemmungsvermögens auch zu einer Einschränkung der Wahrnehmungsfähigkeit kommen kann, wobei zu bedenken sei, dass jedenfalls bei schweren und lang andauernden Gewalthandlungen die Erkenntnisfähigkeit trotz alkoholbedingter Bewusstseinstrübung kaum fraglich sein könne. Auch insoweit ist der Tatrichter in gesteigertem Maße darlegungspflichtig[93]. War der Täter alkohol- oder drogeninduziert in seiner Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigt, obliegen dem Tatgericht besondere Begründungsanforderungen, wenn es das Wissenselement des bedingten Vorsatzes aus der objektiven Gefährlichkeit der Handlung herleiten und annehmen will, dass der Angeklagte trotz erheblicher Alkoholisierung erkannt hatte, dass seine Gewalthandlung zum Tod des Opfers führen könnte und diese Folge auch wollte[94].
321
Schon durch einfachen Haschischkonsum („Joint“) kann im Einzelfall die Erkenntnisfähigkeit im Hinblick auf die Gefährlichkeit des Handelns beeinträchtigt sein, zumal bei sehr jungen Tätern[95]. Auch bei und nicht ausschließbarer hirnorganischer Schädigung des alkoholisierten Täters kann bedingter Tötungsvorsatz hinsichtlich besonders gefährlicher Gewalthandlungen zu verneinen sein[96].
k) Affektive Erregung
322
Zu den Umständen, die die Annahme eines bedingten Tötungsvorsatzes in Frage stellen können und deshalb ausdrücklicher Erörterung in den Urteilsgründen bedürfen, zählt, dass der Täter sich in einer psychophysischen Ausnahmesituation befunden hat, in der – wie bei hochgradiger Alkoholisierung und affektiver Erregung – seine Erkenntnisfähigkeit und Willenskräfte beeinträchtigt waren[97].
l) Gruppendynamik
323
Vorstellbar, wenn auch – soweit ersichtlich – vom BGH noch nicht entschieden ist, dass der oder die Täter durch einen gruppendynamischen Prozess in Bezug auf ihr eigenes Vorgehen an einer zutreffenden Gefahreneinschätzung gehindert wurde[98].