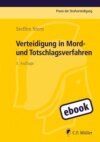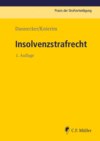Kitabı oku: «Verteidigung in Mord- und Totschlagsverfahren», sayfa 26
b) Schraubendreher
396
Selbst wenn das Opfer infolge seiner Abwehr letztlich nur leichtere Verletzungen erlitten hat, kann das neben dem Wissenselement selbstständig erforderliche Wollenselement des Tötungsvorsatzes bejaht werden, wenn der Täter zweimal mit einem spitzkantigen Schraubendreher mit einer etwa sieben Zentimeter langen Spitze in hasserfüllter Abneigung auf eine Person in Richtung des Brustbereichs einsticht, und danach einräumt, er habe den Streit zwischen ihm und dem späteren Opfer „im Kampf einer abschließenden finalen Lösung zuführen“ wollen[224].
c) Zustechen mit einer Glasscherbe
397
Weil es sich nicht vom Tötungsvorsatz überzeugen konnte, hat das SchwurG den Angeklagten nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge, nicht jedoch wegen Totschlags verurteilt, der von einem Zechkumpanen – beide waren stark alkoholisiert – beim Herumraufen auf einen Glastisch gestoßen worden war und, um sich für die Demütigung zu rächen, einen Glassplitter in den Hals seines Kontrahenten gestoßen hatte, der innerhalb von 5 Minuten verblutete. Der BGH hatte die Beweiswürdigung aus Rechtsgründen hinzunehmen, auch wenn ein anderes Ergebnis wirklichkeitsnäher gewesen wäre. Das LG hatte dem Angeklagten die hohe Alkoholisierung und seinen Erregungszustand zugutegehalten, sodass er womöglich die Gefährlichkeit seines Tuns nicht erkannt habe. Maßgeblich war aber auch das Nachtatverhalten des Angeklagten, der über die Tatfolgen massiv erschrocken war, sich (vergeblich) intensiv um die Rettung des Opfers bemüht und schließlich sogar darum gebeten hatte, sich vom bereits verstorbenen Opfer verabschieden zu dürfen[225].
4. Lebensgefährliche Wurfgeschosse
a) Schleudern eines Beils
398
Rechtlich einwandfrei war nach Ansicht des BGH die Verurteilung eines Angeklagten wegen versuchten Totschlags, der ein Beil mit Wucht gezielt aus 4 – 5 m Entfernung in Richtung einer Tür geschleudert hatte, obwohl er durch die Milchglasscheibe hindurch hinter der Tür einen Polizeibeamten wahrgenommen hatte. Das Beil hatte die Scheibe etwa in Kopfhöhe durchschlagen und war, ohne die Person zu treffen, zu Boden gefallen. Die Glasscheibe habe auch aus Sicht des Angeklagten kein nennenswertes Hindernis geboten, auf einen glücklichen Ausgang habe er folglich nicht vertrauen können. Er habe es dem Zufall überlassen, ob sich die von ihm erkannte Gefahr verwirklichte oder nicht[226].
b) Schleudern eines schweren Aschenbechers
399
Als sich anlässlich eines Kneipenbesuchs der stark angetrunkene Angeklagte in eine körperliche Auseinandersetzung mit anderen Gästen verstrickte und wahrnahm, dass ihm eine stark blutende Kopfplatzwunde zugefügt worden war, ergriff er sofort und spontan einen auf dem Tresen stehenden 500 g schweren Aschenbecher (mit einem Durchmesser von 15 cm) und warf diesen aus ein bis zwei Meter Entfernung gezielt in Richtung des Kopfes eines Beteiligten. Dieser trug dadurch eine Schädelfraktur mit einer Epiduralblutung davon, die eine Hirnstammeinklemmung hervorrief. In der Folgezeit kam es durch diese Verletzung zu einem Versagen mehrfacher Vitalfunktionen, sodass der Geschädigte 10 Wochen später verstarb. Da schon objektiv bedingter Tötungsvorsatz nicht nahelag, wurde der Angeklagte zu Recht nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt[227].
5. Gewaltangriffe mittels Fußtritten
400
Bei Gewaltangriffen, die mit Fußtritten gegen das Opfer einhergehen, kommt es speziell auf
| • | Anzahl, |
| • | Wucht und |
| • | Zielrichtung der Tritte an, auf das getragene |
| • | Schuhwerk, die |
| • | Dauer der Misshandlung insgesamt und das entstandene |
| • | Verletzungsbild. |
401
Nicht untypisch für die Schwurgerichtspraxis ist die folgende Fallgestaltung: Der insbesondere nach erheblichem Alkoholgenuss zu Aggressionen neigende Angeklagte hatte eines Nachts mit seinem Bekannten eine ausgedehnte Zechtour unternommen, in dessen Verlauf er diesen (wohl aus nichtigem Anlass) mit Fausthieben niedergeschlagen und so heftig auf ihn eingetreten hat, dass er schwere Verletzungen erlitt und infolge einer massiven Bluteinatmung in die Lunge verstarb. Das SchwurG hatte ihn wegen Totschlags zu 9 ½ Jahren Haft verurteilt, ohne sich zum Tötungsvorsatz mit der erheblichen Alkoholisierung des Täters zu befassen. Das war jedoch unerlässlich, weil für das Vorgehen des „in Wut geratenen“ Angeklagten gegen seinen Zechkumpanen ein Motiv nicht festgestellt werden konnte, erheblich verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 StGB aufgrund einer Alkoholintoxikation angenommen werden musste und er eine dissoziale Persönlichkeitsstruktur aufwies[228].
a) Typische Verletzungsbilder
402
Empirisch belastbare Untersuchungen über die Häufigkeit auf Tritteinwirkungen zurückzuführender Todesfälle gibt es bisher nicht. Insbesondere in der PKS werden durch Fußtritte verübte Gewaltverbrechen nicht gesondert erfasst. Die durch Tritte ausgeübte stumpfe Gewalt kann, abhängig von der konkreten Angriffsweise, nur zu oberflächlichen Blessuren (Abschürfungen, Ablederungen, Blutunterlaufungen, Platzwunden), vielleicht aber auch zu schwersten knöchernen oder inneren Verletzungen führen, unter Umständen sogar, insbesondere bei wuchtigen Tritten gegen den Kopf, zum Tode des Opfers. Das Verletzungsbild ist äußerst variabel und zeigt sich in seinem ganzen Ausmaß erst bei der Obduktion[229]. Typische Folge von Tritten gegen den Schädel sind Brüche des mittleren Gesichtsschädels, Nasenbein- oder Unterkieferbrüche. Typische Hirnschädigungen manifestieren sich in Gehirnerschütterungen bzw. Gehirnquetschung, die in aller Regel mit temporärer Bewusstlosigkeit einhergehen. Schwerste Krankheitsbilder entstehen im Falle von Hirnverletzungen bzw. Hirnblutungen oder massiven Hirnschwellungen (traumatische Hirnödeme)[230].
403
In den allermeisten Fällen erfolgen Gewaltangriffe nicht durch Schuh- bzw. Stiefeltritte allein, sondern in Kombination mit anderen Angriffsformen und Angriffsmitteln[231]. Durch massives Treten und Schlagen auf Brust und Bauch des Opfers entstehende Polytraumata haben ein eigenes Gesicht, das Forster wie folgt beschreibt[232]: „Serien von massiven Faustschlägen und Tritten, teils mit der Spitze des Schuhs, teils mit seitlichen Kanten, ausgeführt von meist zwei oder mehreren Personen, erzeugen ein Schädigungsbild von wechselnder, aber dennoch markanter Zusammensetzung: multiple Hämatome und Schürfungen im Gesicht, voneinander abgesetzte Lippenverletzungen, streifenförmige wechselnd lange Hautdurchtrennungen im Gesicht, Gesichtsschädelfrakturen, voneinander abgesetzte Blutunterlaufungen in der Brust- und Bauchwand, Frakturen einzelner Rippen oder Gruppen weniger Rippen (Stöße mit der Schuhspitze in den Thorax), Leber-, Milz- und Nierenverletzungen, Ein- oder Abrisse der Mesenterialvenen.“ Unter Umständen droht das Opfer zu verbluten oder durch Blutaspiration zu ersticken.
404
Aus Verteidigersicht bleibt allerdings darauf hinzuweisen, dass Rippenbrüche auch im Zuge intensiver Reanimationsmaßnahmen entstehen können. Immerhin treten bei etwa 25 % aller Patienten, an denen Wiederbelebungsversuche unternommen wurden, Rippenfrakturen auf, nicht selten handelt es sich um Serienfrakturen[233].
b) Zielrichtung der Fußtritte
aa) Wuchtige Fußtritte gegen den Kopf
405
Tritte mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf und den Oberkörper stellen zunächst nur eine das Leben gefährdende Behandlung i.S.v. § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB dar, wenn sie nach der Art der Ausführung der Verletzungshandlungen zu lebensgefährlichen Verletzungen führen können[234]. Ob darüber hinaus bedingter Tötungsvorsatz zu bejahen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei massiven Fußtritten mit beschuhtem Fuß gegen den Kopf eines am Boden liegenden wehrlosen Opfers dürfte nach Auffassung des BGH die Annahme bedingten Tötungsvorsatzes, je nach Fallgestaltung, mehr oder weniger auf der Hand liegen[235], zumindest aber im Grundsatz nicht fernliegen[236]. Er ist jedenfalls immer ernsthaft unter Einbeziehung der Motivation und der psychischen Verfassung des Täters sorgfältig zu prüfen. Geschieht dies nicht in ausreichendem Maße, ist die Feststellung, der Täter habe nur mit Körperverletzungsvorsatz angegriffen, nicht tragfähig[237].
bb) Fußtritte gegen Hals und Rumpf
406
Ein gezielt gegen den Rumpf eines Menschen gerichteter Fußtritt ist schon objektiv nicht ohne Weiteres potenziell lebensbedrohlich, solange nicht ausgerechnet der Solarplexus[238] getroffen wird und, über Schwindel oder drohende Bewusstlosigkeit hinaus, bei dem Opfer ausnahmsweise – vor allem wegen einer Erkrankung des vegetativen Nervensystems – die Gefahr des höchst selten eintretenden („medizinische Rarität“[239]) sog. Reflextodes („Vagustod“) besteht. Vergleichbares kann durch einen Tritt gegen den sog. Erb’schen Punkt an der Seite des Halses eintreten[240].
407
Heinke[241] ist der Frage nachgegangen, wie gefährlich Fußtritte im Bewusstsein der Bevölkerung sind. Aus einer Rekrutenbefragung hat er die These abgeleitet, dass nicht nur Fußtritte gegen den Kopf, sondern auch Fußtritte gegen den Oberkörper einer am Boden liegenden Person mit der Vorstellung lebensbedrohlicher Verletzungen verbunden seien, was bei entsprechenden Angriffshandlungen generell die Annahme bedingten Tötungsvorsatzes nahelege. Eine hiervon abweichende, dem Täter günstigere Annahme sei nur bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für Defizite auf der kognitiven oder voluntativen Vorsatzebene gerechtfertigt. Dieser holzschnittartigen Analyse ist Eisenberg[242] mit überzeugenden Argumenten entgegengetreten. Zu Recht weist dieser auf gravierende methodische Schwachstellen hin, die mit der Auswahl der Probanden (Rekruten) beginne und bis zur unzulässigen Verallgemeinerung der Befunde reiche.
408
Ein Erfahrungssatz, dass „jedermann“ um die äußerste Gefährlichkeit von Fußtritten wisse, selbst wenn diese nur in Richtung Oberkörper des Opfers erfolgen, existiert sicherlich nicht. Nur ausnahmsweise wird der Täter (etwa als Kampfsportler[243]) über dieses Spezialwissen verfügen. Überdies sind auf der Täterseite nicht selten Alkohol und Gruppendynamik, vielleicht auch Affekte im Spiel. Es kommt weniger auf den Wissensstand des Bevölkerungsdurchschnitts oder darauf an, ob der Täter schon von Fällen gehört hat, in denen das brutal zusammengetretene Opfer verstorben ist; entscheidend ist allein die Bewusstseinslage des Täters im Zeitpunkt und vor dem Hintergrund der Tatausführung. Kommt ihm infolge hochgradiger Erregung und erheblicher Alkoholisierung nicht in den Sinn, dass er das Opfer durch sein konkretes Vorgehen womöglich tötet, fehlt es bereits am Vorsatzelement des Wissens bzw. Bewusstseins. Das Vorhandensein von Allgemeinwissen über die abstrakte Gefährlichkeit genügt nur für eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung i.S.v. § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB bzw. mittels eines gefährlichen Werkzeugs i.S.v. § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB bzw. wegen Körperverletzung mit Todesfolge gem. § 227 StGB, wenn das Opfer seinen schweren Verletzungen erliegt[244].
cc) Sprung in den Rücken des bäuchlings liegenden Opfers
409
Nicht untypisch für äußerst brutales Vorgehen von Gewalttätern ist das Springen auf den am Boden liegenden Körper (Kopf, Brustkorb oder Rücken) des bereits verletzten oder gar kampfunfähigen Opfers. Sprünge mit beiden Füßen auf den Kopf sind als besonders gefährlich einzustufen und dürften generell die Annahme zumindest bedingten Tötungsvorsatzes rechtfertigen[245]. Der BGH hat in einem Fall, in dem ein Mittäter zunächst nur mit Körperverletzungsvorsatz gehandelt hatte, dann aber dem bäuchlings auf dem Rücken liegenden, durch einen Messerstich bereits schwer verletzten Opfer in den Rücken gesprungen war, beanstandet, dass das Tatgericht sich für die Verneinung des Tötungsvorsatzes lediglich davon hatte leiten lassen, dass die durch den Sprung entstandenen Verletzungen nicht konkret lebensgefährlich gewesen seien, anstatt der Frage nachzugehen, ob sich möglicherweise der Körperverletzungsvorsatz in der Schlussphase zum Tötungsvorsatz gesteigert haben könnte[246].
c) Schuhwerk
aa) Barfüßiges Zutreten
410
Dass auch das Zutreten mit unbeschuhtem Fuß unter Umständen geeignet ist, tödliche Verletzungen hervorzurufen[247], ist längst nicht jedermann bekannt. Die Annahme auch nur bedingten Tötungsvorsatzes dürfte sich in derartigen Fällen verbieten.
bb) Tritte mit Turnschuhen
411
Ob ein Schuh am Fuß des Täters ein gefährliches Werkzeug i.S.v. § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB darstellt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab[248]. Ein Turnschuh ist zwar regelmäßig als gefährliches Werkzeug anzusehen, wenn damit, mit welcher Partie des Schuhs auch immer, einem Menschen in das Gesicht getreten wird[249]; da jedoch selbst wuchtige Tritte gegen Kopf oder Oberkörper eines Menschen nicht zwangsläufig lebensgefährliche Verletzungen hervorrufen, wird (bedingter) Tötungsvorsatz im Allgemeinen fernliegen. Das schließt im Einzelfall die Verurteilung einer Turnschuh-Gang wegen versuchten Totschlags bei gemeinschaftlichem Eintreten und Einschlagen auf ein wehrloses Opfer nicht aus[250].
cc) Festes Schuhwerk
412
Ein Straßenschuh von üblicher Beschaffenheit ist regelmäßig als gefährliches Werkzeug im Sinne von § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB einzustufen[251]. Wuchtige Fußtritte mit festem Straßenschuh in die Bauchgegend des am Boden liegenden Opfers, die letztlich zu einer tödlichen Bauchfellentzündung führen, lassen noch nicht unbedingt auf einen Tötungsvorsatz schließen, wenn es sich bei dem Angeklagten um eine einfach strukturierte Persönlichkeit mit enorm eingeschränktem sozialen Horizont handelt, der sich zur Tatzeit jedenfalls in einem „leichten Rausch“ befand und den Tritt spontan, aus einer momentanen Verärgerung heraus ohne längere Überlegung ausführte[252]. Wuchtige Tritte mit festem Schuhwerk gegen den Kopfbereich eines Menschen sind zwar grundsätzlich abstrakt geeignet, lebensbedrohliche Verletzungen, in ungünstigen Fällen sogar den Tod des Opfers herbeizuführen (§ 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB). Tötungsvorsatz versteht sich jedoch nicht von selbst[253]. Im Einzelfall, so der BGH, sei aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn das Tatgericht einen bedingten Tötungsvorsatz nach sorgfältiger Abwägung verneinte, weil der Täter mit seinen Springerstiefeln zwar schnell und kräftig drei- bis fünfmal gegen den Oberkörper sowie den Kopfbereich des am Boden liegenden Opfers, aber nicht mit voller Kraft zugetreten habe und die konkreten Verletzungen für sich genommen auch nicht lebensgefährlich gewesen seien[254].
413
Der Angeklagte, der zur Tatzeit „leichte Wanderstiefel“ trug, hatte einer BGS-Beamtin (in Zivil), die mit seiner Bekannten rangelte, einen Tritt gegen die rechte Kopfseite versetzt, den er „etwas abbremste, um ihm an Wucht zu nehmen“. Die Jugendkammer durfte fehlenden Tötungsvorsatz (allein) daraus herleiten, dass der Angeklagte kein schweres Schuhwerk trug, nur einmal zutrat und die Bekannte aufforderte aufzuhören, da die Zeugin „ja schon halb tot“ sei[255].
414
Das mehrfache Eintreten mit festem Schuhwerk auf den Kopf, in das Gesicht und in die Bauchgegend des zu Boden gestreckten wehrlosen Opfers ist ein gewichtiges Beweisanzeichen für einen bedingten Tötungsvorsatz. Auch der Tatsache, dass der Täter im ersten Teilakt nicht freiwillig von seinem Opfer abließ, sondern schon durch seine Begleiter weggezogen werden musste, kann ein hoher Indizwert für die innere Einstellung des Angeklagten gegenüber der Tötung seines Opfers zukommen[256]. Bei mit großer Brutalität und Aggressivität ausgeführten Tritten mit dem beschuhten Fuß und Springen mit beiden Füßen auf den Brustkorb kann ein menschenverachtender Vernichtungswille zum Ausdruck kommen, der nicht nur Tötungsvorsatz impliziert, sondern auch die Annahme niedriger Beweggründe rechtfertigt[257].
d) Gemeinschaftliches Zutreten
415
Bei gemeinschaftlichen mehrminütigen wuchtigen Tritten mit festem Schuhwerk gegen Kopf und Hals des wehrlos am Boden liegenden Opfers dürfte bedingter Tötungsvorsatz allerdings zumeist äußerst naheliegen[258]; die hierdurch verursachten Verletzungsbilder sind, von glücklichen Verläufen abgesehen, durchweg besorgniserregend[259].
416
Aber auch dann bedarf es einer sorgfältigen Betrachtung aller Tatumstände. Es liegt selbst in solchen Fällen innerhalb des tatrichterlichen Beurteilungsspielraums, wenn Zweifel am Tötungsvorsatz eines Tatbeteiligten verblieben, weil
| • | es sich um ein spontanes Geschehen gehandelt hat, das – tumultartig, – in ständiger Bewegung schnell wechselnd stattfand und – nur begrenzt zuverlässig zu rekonstruieren war; |
| • | sich überdies keine Handlungen des Angeklagten fanden, bei denen sich Tötungsvorsatz aufdrängt; |
| • | keine vom Angeklagten „eigenhändig“ zugefügten schweren Verletzungen[260] vorlagen. |
417
Bei gemeinschaftlichem Vorgehen gegen ein wehrloses Opfer können im Einzelfall auch heftige Tritte mit leichterem Schuhwerk ausreichen: Die fünf erheblich (i.S.v. § 21 StGB) alkoholisierten Angeklagten, die sämtlich Turnschuhe trugen, hatten nachts einen Schwarzafrikaner verprügelt und aus einem Motivbündel von Lust an Gewalt, Menschenverachtung und Fremdenfeindlichkeit mit massiven Schuhtritten verletzt. Für Tötungsvorsatz sprach das Zufügen der Verletzungen bei Bewusstlosigkeit des Opfers und das bedenkenlose Verlassen des Opfers in eklatant hilfloser Situation, aber auch das „Pulsfühlen“ sowie die Tatmotivation des Ausländerhasses[261].
418
Beanstandet hat der BGH die Verurteilung eines jungen Angeklagten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, der sich in erheblich alkoholisiertem Zustand an der grundlosen Misshandlung eines harmlosen Passanten beteiligt hatte. Während der Mitangeklagte, der das Opfer angegriffen und diesen in einen Hinterhof geprügelt hatte, dem Opfer 5-mal mit voller Wucht gegen den ungeschützten Kopf trat, versetzte der Angeklagte diesem lediglich mit Verletzungsvorsatz einen leichten Tritt gegen den Kopf. Den Tritten des Mitangeklagten sah der Angeklagte zu, was den Mitangeklagten zur weiteren Tatausführung ermutigte. Sie ließen von dem Opfer ab, als die Polizei nahte. Das Opfer erlitt durch die Tritte multiple Gesichtsschädelbrüche, die zu einer lebensbedrohlichen Gehirnschwellung und zu dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen führten. Da den Feststellungen zufolge nicht auszuschließen war, dass der Angeklagte als Erster (und nur mit Körperverletzungsvorsatz) zugetreten und sich dann nicht weiter beteiligt hatte, kam nur Totschlag durch Unterlassen in Betracht, nachdem der Angeklagte durch den gemeinschaftlichen Angriff als Garant hilfspflichtig gewesen sei. Dies setzt freilich voraus, dass der angetrunkene Angeklagte die Gewalthandlungen seines Mittäters überhaupt hätte wirksam verhindern können, was jedenfalls nach dem Sachverhalt nicht auf der Hand lag[262].