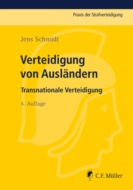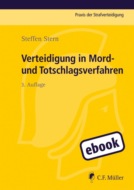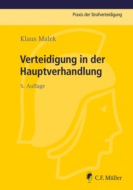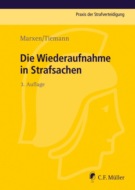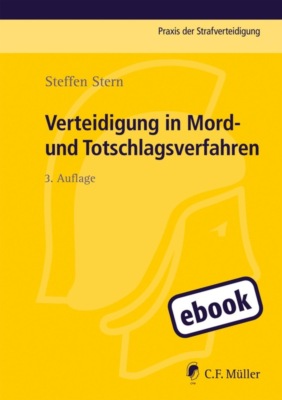Kitabı oku: «Verteidigung in Mord- und Totschlagsverfahren», sayfa 32
Teil 4 Vorsätzliche Tötungsdelikte
Inhaltsverzeichnis
A. Mord, § 211 StGB
B. Totschlag, § 212 StGB
C. Mord und Totschlag durch Unterlassen
D. Beteiligung an Mord und Totschlag
E. Tötung auf Verlangen, § 216 StGB
F. Materiellrechtliche Sonderprobleme
G. Strafzumessung bei Mord und Totschlag
Teil 4 Vorsätzliche Tötungsdelikte › A. Mord, § 211 StGB
A. Mord, § 211 StGB
501
Mord ist die vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen unter einem oder mehreren der in § 211 Abs. 2 StGB genannten besonders verwerflichen Begleitumständen[1]. Die Mordmerkmale lassen sich in drei Gruppen unterteilen, die an besondere Tatmotive (1. Gruppe), spezielle Tatmodalitäten (2. Gruppe) oder bestimmte Absichten des Täters (3. Gruppe) anknüpfen. Auf Mord steht grundsätzlich lebenslange Freiheitsstrafe. Gem. § 78 Abs. 2 StGB unterliegt Mord (§ 211 StGB) keiner Verfolgungsverjährung. Die Beihilfe zu einem Tötungsverbrechen, das allein wegen niedriger Beweggründe des Täters ein Mord ist, verjährt nach 15 Jahren, wenn der Gehilfe nicht ebenfalls aus niedrigen Beweggründen handelte[2].
502
Wie bereits erwähnt, gebietet der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei Vorliegen außergewöhnlicher schuldmindernder Umstände in Durchbrechung der absoluten Strafandrohung die Anwendung des Sonderstrafrahmens des § 49 Abs. 1 StGB (sog. Rechtsfolgenlösung)[3]. An die Stelle einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe tritt zeitige Freiheitsstrafe von 3 bis 15 Jahren. Diese Strafrahmenverschiebung, die – fakultativ – eigentlich nur in den Fällen des Versuchs (§§ 22, 23 Abs. 2 StGB) oder des Mordes bzw. Mordversuchs durch Unterlassen (§ 13 Abs. 2 StGB) und – obligatorisch – auf den Mordgehilfen (§ 27 Abs. 2 StGB) anzuwenden ist, kann jedoch nicht auf die vorerwähnte Rechtsfolgenlösung gestützt werden, wenn das Gericht die Möglichkeit einer fakultativen Strafmilderung nach den §§ 13, 49 Abs. 1 StGB bewusst nicht ergriffen hat[4]. Das Höchstmaß des anzuwendenden Strafrahmens beträgt nach dreifacher Milderung der Strafe aus § 211 Abs. 1 StGB (z.B. wegen Beihilfe ohne Mordqualifikation und § 21 StGB) acht Jahre, fünf Monate und eine Woche[5].
Teil 4 Vorsätzliche Tötungsdelikte › A › I. Spezielle Vorsatzfragen bei Mordvorwürfen
I. Spezielle Vorsatzfragen bei Mordvorwürfen
503
Der Mordvorsatz muss die Tötungshandlung ebenso wie die jeweils einschlägigen Mordmerkmale umfassen. Für den Mord genügt generell bedingter Tötungsvorsatz[6], dies aber nur, soweit dolus eventualis noch mit der Annahme bestimmter Mordmerkmale zu vereinbaren ist. Bedingter Tötungsvorsatz steht der Annahme des Mordmerkmals „Töten zur Ermöglichung einer anderen Straftat“ nicht entgegen. Die Tötung muss nicht „notwendiges“ Mittel zur Begehung der anderen Straftat sein[7]. Bei Mordlust ist in jedem Fall Tötungsabsicht (dolus directus I) oder zumindest direkter Tötungsvorsatz (dolus directus II) zu verlangen. Bedingter Tötungsvorsatz wird sich mit der Annahme von Verdeckungsabsicht, mit der er nicht stets und zwingend in Widerspruch steht[8], nur in Ausnahmefällen vertragen[9] und längst nicht immer mit der Feststellung niedriger Beweggründe[10]. Alkoholisierung[11] oder heftige Gemütsbewegungen können es dem Täter im Einzelfall verwehren, sich der besonderen Merkmale des Mordes bewusst zu werden[12]. So kann bei einer hochgradigen Erregung des Täters das Bewusstsein gefehlt haben, die Durchführung der Tat werde durch die Arglosigkeit des Opfers erleichtert[13]. Dies liegt gewöhnlich auch bei Spontanität des Tatentschlusses und seiner Ausführung nicht fern, wenn es, ausgelöst durch jahrelange Entwürdigung und wiederholte Misshandlungen, infolge plötzlich aufsteigender Verbitterung und Wut zu Angriffen auf einen Schlafenden kommt[14].
Teil 4 Vorsätzliche Tötungsdelikte › A › II. Tatmotiv und Zweifelssatz
II. Tatmotiv und Zweifelssatz
504
Dem Tatgericht ist es unbenommen, sich die Überzeugung von der Täterschaft des Angeklagten auch dann zu bilden, wenn ein Tatmotiv nicht feststellbar oder wenig plausibel ist, es sich aber trotzdem sicher ist, dass der Angeklagte den tatbestandlichen Erfolg auf die eine oder andere mögliche und vom Gericht selbst gesehene und erwogene Weise herbeigeführt hat[15]. Kommen mehrere Tatmotive gleichermaßen in Betracht, gebietet es – nach Ausschöpfung aller Aufklärungsmöglichkeiten – der Zweifelssatz, den für den Angeklagten günstigsten Beweggrund als leitend anzusehen[16]. So kann es bei mehreren Verletzungshandlungen nach dem Zweifelssatz geboten sein, von einem durchgängigen Tötungsvorsatz auszugehen, anstatt einen Körperverletzungsvorsatz mit nachfolgender Verdeckungsabsicht anzunehmen[17]. Wer nämlich von Anfang an mit (bedingtem) Tötungsvorsatz handelt, wird nicht dadurch zum Mörder, dass zwischen zwei Einzelakten Verdeckungsabsicht hinzutritt[18]. Anderes gilt allenfalls, wenn zwischen den einzelnen Gewalthandlungen eine zeitliche Zäsur liegt, die einen neuen Tatentschluss erfordert[19]. Nach einem (nicht auf Anhieb erfolgreichen) Totschlagsversuch kann das Absehen von Rettungsmaßnahmen zur Verdeckung dieses Geschehens sogar nach einer Zäsur keinen Mordvorwurf begründen, weil dieses Verhalten lediglich auf das Unterlassen eines Rücktritts hinausläuft[20].
Teil 4 Vorsätzliche Tötungsdelikte › A › III. Die Begehungsweise als Mordmerkmal
III. Die Begehungsweise als Mordmerkmal
505
Die Tötung einer Person ist als Mord einzustufen, wenn der Täter heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln handelt (Merkmale der 2. Gruppe).
1. Heimtücke
a) Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers
aa) Definition
506
Heimtückisch tötet, wer die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers in feindlicher Willensrichtung bewusst zur Tötung ausnutzt[21]. Wesentlich ist, dass der Mörder sein Opfer, das keinen Angriff erwartet, also arglos ist, in einer hilflosen Lage überrascht und dadurch daran hindert, dem Anschlag auf sein Leben zu begegnen oder ihn wenigstens zu erschweren[22]. Als wehrlos gilt, wer infolge seiner Arglosigkeit seine Verteidigungsfähigkeit nahezu oder in Gänze eingebüßt hat. Die Arglosigkeit setzt voraus, dass sich das Opfer „keines Angriffs vonseiten des Täters versieht“[23]. Arglosigkeit ist nicht nur dann zu verneinen, wenn der Angegriffene einen Angriff auf sein Leben befürchtet, sondern auch dann, wenn er nur einen sonstigen erheblichen Angriff gegen seine körperliche Unversehrtheit erwartet[24].
bb) Aussagekraft von Verletzungsbildern
507
Dass im Rahmen einer Obduktion keine Abwehrverletzungen festgestellt werden, bietet keinen zwingenden Anhaltspunkt dafür, dass der Angriff für das Opfer völlig überraschend gekommen sein muss. Ein entsprechender Erfahrungssatz existiert nicht. Das Verletzungsbild kann zum Beispiel dadurch geprägt sein, dass das Opfer in der konkreten Angriffssituation infolge körperlicher Unterlegenheit zur Leistung einer effektiven Gegenwehr nicht mehr in der Lage gewesen ist[25].
cc) Generelles Misstrauen
508
Ein generelles Misstrauen des Opfers gegenüber dem Täter schließt dabei Arglosigkeit nicht von vorneherein aus[26].
dd) Längere Zeit zurückliegende Aggressionen und Tätlichkeiten
509
Liegen Aggressionen und Tätlichkeiten längere Zeit zurück, kann das Opfer (wieder) arglos sein[27].
ee) Eigenes aggressives Verhalten des Opfers
510
Trotz eigenen aggressiven Verhaltens kann das Mordopfer arglos sein, wenn der Täter bei früheren Auseinandersetzungen „maßvoll“ reagiert und das Opfer nicht verletzt hat[28].
ff) Wortwechsel und feindselige Atmosphäre
511
Ein der Tat vorangegangener bloßer Wortwechsel oder eine nur feindselige Atmosphäre schließt Heimtücke jedenfalls dann nicht aus, wenn das Opfer hieraus noch nicht die Gefahr einer Tätlichkeit entnommen hat. Eine (anfänglich) vorhandene oder noch fortbestehende Arglosigkeit wird auch beim Umschlagen in einen offenen Streit erst dadurch beseitigt, dass das Opfers nun aufgrund der Ereignisse mit einem tätlichen Angriff rechnet[29].
gg) Heimtückemord „mit Vorankündigung“?
512
Wer heimtückisch handeln will, pflegt seine Tat nicht kurz zuvor anzukündigen. In solchen Fällen bedarf die Annahme des zur Tatbestandserfüllung des Heimtückemordes zu fordernden Ausnutzungsbewusstseins ganz besonderer Umstände[30].
hh) Fehleinschätzung der Gefährlichkeit des zu erwartenden Angriffs
513
Das Opfer ist jedoch nicht etwa nur deshalb arglos, weil es zwar mit einem Angriff gerechnet, sich aber, weil der Täter wider Erwarten ein Messer mit sich führte, in der Gefährlichkeit des zu erwartenden Angriffs verschätzt haben kann. Es genügt, wenn das Opfer mit einem Angriff gegen seine körperliche Unversehrtheit rechnete; Lebensbedrohlichkeit des erwarteten Angriffs ist nicht Voraussetzung[31].
ii) Maßgeblicher Zeitpunkt
514
Es kommt allein darauf an, ob das Opfer im Tatzeitpunkt mit Feindseligkeiten des Täters rechnet[32]. Bei einem mehrgliedrigen Tatgeschehen ist Arglosigkeit in Bezug auf einen ersten, nur mit Körperverletzungsvorsatz begangenen Angriff belanglos[33]. Es kommt nicht auf das Vorliegen von Arglosigkeit bei einem früheren oder späteren Handlungsabschnitt an, sondern darauf, ob das Opfer bei Beginn des ersten mit Tötungsvorsatz geführten Angriffs arglos war[34]. Ausnahmsweise kann für den maßgeblichen Zeitpunkt der Heimtücke anderes gelten, wenn der Täter das Opfer mit Tötungsvorsatz planmäßig in einen Hinterhalt lockt, um eine günstige Gelegenheit zur Tötung zu schaffen, und die entsprechenden Vorkehrungen und Maßnahmen bei Ausführung der Tat noch fortwirken[35]. Auch wenn der Täter dem Opfer mit Tötungsvorsatz in einem Versteck auflauert, um es zu überraschen, kommt es für die Annahme der Arglosigkeit des Opfers bei Beginn des tödlichen Angriffs nicht darauf an, ob und wann genau dieses das Vorhaben des ihm entgegentretenden Täters bemerkt hat[36].
jj) Offene feindselige Auseinandersetzungen
515
Das Opfer eines Tötungsdelikts ist nicht arglos, wenn sich das Opfer bewusst in eine feindliche Auseinandersetzung mit dem Täter eingelassen hat und deshalb mit ernsten Angriffen (Schüsse auf die Insassen eines Pkw) rechnen musste[37] oder der Tat eine offene Auseinandersetzung mit von vornherein feindlichem Verhalten des Täters vorangegangen ist. Arglosigkeit kann jedoch erneut vorherrschen, wenn das Opfer aus dem Verhalten des Täters auf ein Ende der Feindseligkeiten schließt und deshalb keinen weiteren Angriff mehr befürchtet[38].
516
Besonderer Betrachtung bedürfen Fälle, in denen dem mit Tötungsvorsatz geführten Angriff eine einverständliche Schlägerei zwischen den Beteiligten vorangeht und das „Tatopfer“ zwar in die ihm drohende Körperverletzung wirksam eingewilligt, der Täter aber unter Bruch der vereinbarten „Spielregeln“ zum tödlichen Angriff mit einem gefährlichen Werkzeug übergeht[39]. Arglosigkeit des Opfers dürfte allerdings nicht zu bejahen sein, wenn es zuvor seinerseits die „Spielregeln“ gebrochen und, obwohl „Mann gegen Mann“ vereinbart war, beispielsweise weitere (bewaffnete) Personen zu seiner „Verstärkung“ mitgebracht hat.
517
Allerdings kann das Opfer auch dann arglos sein, wenn der zum Angriff entschlossene Täter ihm zwar offen feindselig entgegentritt, die dem Opfer verbleibende Zeitspanne zwischen dem Erkennen der Gefahr und dem unmittelbaren Angriff aber so kurz ist, dass keine Möglichkeit bleibt, dem Angriff irgendwie zu begegnen[40].
518
Abwehrversuche, die das durch einen überraschenden Angriff in seinen Verteidigungsmöglichkeiten behinderte Opfer im letzten Moment unternommen hat, stehen der Heimtücke dann nicht entgegen[41].
519
Nichts anderes gilt, wenn der Tat eine offen feindselige Auseinandersetzung vorausgeht, das Tatopfer aber aufgrund besonderer Umstände gleichwohl nicht mit einem erheblichen Angriff gegen seine körperliche Unversehrtheit rechnet[42], oder wenn bei einer offenen Auseinandersetzung dem Opfer deshalb keine Zeit zur Abwehr verblieb, weil der zunächst nur vorherrschende Körperverletzungsvorsatz überraschend schnell in einen Tötungsvorsatz umgeschlagen ist[43]. Davon ist allerdings nicht auszugehen, wenn den Feststellungen zufolge der Angeklagte den Geschädigten angehalten und vor dem Hintergrund sexueller Übergriffe auf seine Tochter unvermittelt gefragt hat, was dieser mit der Tochter mache, und erst aufgrund der höhnischen Reaktion des Geschädigten den Tatentschluss gefasst hat. Die Schlussfolgerung, dass der Geschädigte schon beim ersten Anblick des Angeklagten bis zum tatsächlichen Angriff mit einer körperlichen Auseinandersetzung gerechnet habe, weil er dessen 15-jährige Tochter sexuell belästigt hatte und sich deshalb sogleich, ohne den Angeklagten auch nur zu begrüßen, entfernen wollte, ist nicht zu beanstanden[44].
kk) Keine konfrontative Erpressung ohne Argwohn
520
Der Erpresser, der die offene Konfrontation mit seinem Opfer sucht, ist in aller Regel nicht arglos[45].
b) Ausnutzungsbewusstsein
aa) Grundsätzliches zur inneren Tatseite des Heimtückemordes
521
Das Mordmerkmal der Heimtücke setzt in subjektiver Hinsicht neben Kenntnis der Situation des Opfers zusätzlich voraus, dass dem Täter bei Beginn der tödlichen Attacke bewusst ist, einen durch seine Ahnungslosigkeit gegenüber dem Angriff schutzlosen Menschen zu überraschen[46]. Zur inneren Tatseite der Heimtücke gehört, dass der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit des Angegriffenen nicht nur in einer äußerlichen Weise wahrgenommen, sondern sie in ihrer Bedeutung für die Tat bewusst erfasst hat[47]. Es reicht aus, wenn der Täter sich bewusst ist, einen durch seine Ahnungslosigkeit gegenüber einem Angriff schutzlosen Menschen zu überraschen[48]. Ob der Täter darüber hinaus die Arg- und Wehrlosigkeit bewusst zur Tatbegehung instrumentalisiert haben muss, wird gegenwärtig uneinheitlich beantwortet. Während der 1. und der 4. Strafsenat dies im Einzelfall ausdrücklich gefordert haben[49], geht nach Auffassung des 2. Strafsenats dieses Verlangen „über die rechtlichen Anforderungen an das Mordmerkmal der Heimtücke hinaus“[50]. Regelmäßig erfordert Heimtücke nicht, dass sich im bewussten Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit noch eine besondere Tücke und Verschlagenheit oder ein verwerflicher Vertrauensbruch zeigt[51].
522
Veranlassung, das Ausnutzungsbewusstsein in Frage zu stellen, besteht bei Spontantaten, affektiven Durchbrüchen, heftigen Gemütsregungen aus Wut und Hass sowie gravierenden Beeinträchtigungen des Steuerungsvermögens aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum. Der Schluss, der Täter habe sich infolge heftiger Gefühlsaufwallung und seiner Enthemmung nicht ausschließbar keine weiteren Gedanken über die Vorstellung des Opfers gemacht, kann sich aus folgenden Indizien ergeben: Spontaner Tatentschluss, kein einleuchtendes Tatmotiv, „Lebenskrise“ (aufgrund seines beruflichen Misserfolgs), Alkoholerkrankung, Konflikt mit Lebens- und/oder Geschäftspartnerin, eingeschränkte Steuerungsfähigkeit infolge Alkoholgenusses, Schlafdefizit[52]. Für intaktes Ausnutzungsbewusstsein sprechende Umstände, insbesondere umsichtiges Tat- und Nachtatverhalten des Angeklagten, wie etwa das Anlegen von Handschuhen vor der Tatausführung, das verdeckte Annähern an das Opfer sowie das Abdecken des Tatwerkzeugs, dürfen andererseits nicht außer Betracht bleiben[53]. Allerdings muss angesichts einer konkreten Ankündigung, das Opfer jetzt aufsuchen und töten zu wollen, das Verbergen der Waffe bei Annäherung durch eine Menschenmenge keineswegs der Überrumpelung des Opfers gegolten, sondern kann allein dem Zweck gedient haben, dass Eingreifen unbeteiligter Dritter zu verhindern[54]. Im Einzellfall kann dem Angreifer nicht bewusst geworden sein, dass eine auf frühere Aggressionen und einer feindseligen Atmosphäre beruhende latente Angst des Opfers dessen Arglosigkeit im Augenblick der Tat nicht beseitigt hat[55].
bb) Beurteilung des Ausnutzungsbewusstseins ist Rechtsfrage
523
Ob beim Täter das erforderliche Ausnutzungsbewusstseins vorgelegen hat, ist eine reine Rechtsfrage, die das Gericht nicht der Verantwortung eines Sachverständigen überlassen darf[56]. Deshalb ist der Aufsatz eines Psychiaters wie Dannhorn[57], der als juristischer Laie den Schwurgerichten – aber auch dem BGH als Revisionsinstanz – mit gewagten Alltagstheorien törichte Nachsicht mit heimtückisch oder aus niedrigen Beweggründen mordenden Gewalttätern „nachzuweisen“ sucht, schon vom Ansatz her äußerst problematisch.
cc) Beurteilungsspielraum
524
Lässt sich der Sachverhalt nicht sicher klären, ist nicht zu beanstanden, wenn auf unsicherer Tatsachenbasis bereits die Ausnutzung von Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers und damit das Vorliegen des Mordmerkmals der Heimtücke objektiv verneint wird[58]. Wenn das Tatgericht angesichts der besonderen äußeren und inneren Umstände des Tatgeschehens keine sichere Überzeugung von der subjektiven Tatseite der mordqualifizierenden Merkmale zu gewinnen vermag und die Beweiswürdigung keine durchgreifenden Lücken oder Widersprüche aufweist, ist die Annahme fehlenden Ausnutzungsbewusstseins vom Revisionsgericht hinzunehmen[59].
dd) Spontanentschluss – Augenblickstat
525
Die Spontanität des Tatentschlusses im Zusammenhang mit der Vorgeschichte und dem psychischen Zustand des Täters kann ein Beweisanzeichen dafür sein, dass ihm das Ausnutzungsbewusstsein fehlt[60]. Das gilt verstärkt dann, wenn der Angriff plötzlich, ungeplant und unüberlegt vor Zeugen und ohne jegliche Sicherungstendenzen stattfindet[61]. Bei „Augenblickstaten“, insbesondere bei effektiven Durchbrüchen oder sonstigen heftigen Gemütsbewegungen kann es nach Lage des Einzelfalls der Darlegung bedürfen, warum der spontan agierende Täter trotz seiner Erregung die für die Heimtücke maßgebenden Aspekte in sein Bewusstsein aufgenommen hat[62]. Wird das Vorliegen eines Spontanentschlusses mit fehlerhafter Begründung abgelehnt, ist auch die Bejahung des für den Heimtückemord erforderlichen Ausnutzungsbewusstseins nicht tragfähig[63].
ee) Psychische Ausnahmesituation
526
Berechtigte Zweifel am Ausnutzungsbewusstsein können sich im Einzelfall etwa auf einen affektiven Impulsdurchbruch beim Angeklagten als Folge einer von ihm als Provokation empfundenen Äußerung des Opfers gründen, insbesondere dann, wenn obendrein Anhaltspunkte dafür fehlen, dass der Angeklagte das Opfer bereits mit der Erwägung, es zu töten, an den Tatort gelockt haben könnte[64].
(1) Beurteilung des Einzelfalls
527
Psychische Ausnahmezustände, auch solche unterhalb der Schwelle des § 21 StGB[65], können der Annahme des Ausnutzungsbewusstseins entgegenstehen[66]. Allerdings besteht Einigkeit, dass nicht jede affektive Erregung oder heftige Gemütsbewegung daran hindert, die Bedeutung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers für die Tat zu erkennen[67], dies ist vielmehr Tatfrage[68]. Selbst aufgrund eines relevanten Affekts vom Schweregrad des § 21 StGB darf nicht unweigerlich auf das Fehlen des Ausnutzungsbewusstseins geschlossen werden[69].