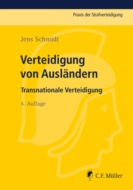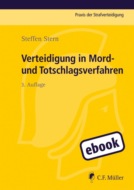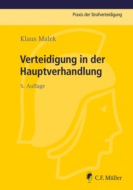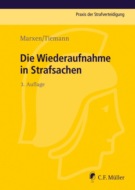Kitabı oku: «Verteidigung in Mord- und Totschlagsverfahren», sayfa 9
III. Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten
24
Die allermeisten der als unnatürlich erkannten Todesfälle, die in ein Ermittlungsverfahren münden, gelten als aufgeklärt[69]. Die Quote in Bezug auf Mord und Totschlag liegt seit Jahrzehnten auf hohem Niveau bei etwa 90 bis 95 Prozent[70]. Für einige Großstädte wie Augsburg, Bielefeld, Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Gelsenkirchen, Halle, Krefeld, Leipzig, Lübeck, Mannheim, Münster, Rostock oder Wiesbaden wurden 2010 Aufklärungsquoten von 100 % vermeldet[71]. Doch diese Erfolgszahlen täuschen über den allgemeinen „Täterschwund“ hinweg, der von der Registrierung des Tatverdächtigen in der PKS bis zum Verfahrensabschluss, wie er sich in der Rechtspflegestatistik niederschlägt, zu beobachten ist. Während die PKS die Verdachtslage aus polizeilicher Sicht widerspiegelt und nicht nachträglich korrigiert wird, falls sich der Verdacht nicht erhärtet, misst die Strafverfolgungsstatistik (StrVerfStat) das Ergebnis der (in Form von Strafprozessen durchgeführten) gerichtlichen Untersuchungen. Bisweilen entpuppt sich ein – zumindest aus Polizeisicht – scheinbar eindeutig geklärter Mord im Nachhinein als harmloser Unglücks- oder natürlicher Todesfall. Nach Abgabe der Akten an den Staatsanwalt kommt es überdies nicht nur zu Verfahrenseinstellungen, weil Zweifel an der Täterschaft des Beschuldigten bestehen, sondern in ganz hoher Zahl werden die Vorwürfe auch „herunterdefiniert“, vom Mord zum Totschlag, von der vorsätzlichen zur fahrlässigen Tötung, zur Körperverletzung mit Todesfolge oder zum Rauschdelikt[72].
25
Aus älteren Untersuchungen der frühen 70er wissen wir, dass mindestens jeder 2. Fall, in dem der Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts bestanden hat, nicht zu einer entsprechenden Verurteilung geführt hat. Noch dramatischer waren die Zahlen, wenn es um nur versuchte Tötungsdelikte ging. In allenfalls ein Viertel der Vorwürfe hatte sich der Verdacht auch im Schwurgerichtsverfahren uneingeschränkt bestätigt[73]. Im Jahre 2010 endeten immerhin 44 Verfahren wegen versuchten oder vollendeten Mordes oder Totschlags mit Freispruch[74]. Kommt es wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts zum Schuldspruch, werden im Durchschnitt zwischen 7 und 8 Haftjahre verhängt[75].
Teil 1 Einführung › A › IV. Charakteristische Tötungsdelikte
IV. Charakteristische Tötungsdelikte
1. Beziehungstaten
26
Bei der Mehrzahl der Tötungsdelikte handelt es sich um Beziehungstaten[76], die polizeisprachlich auch als Nahraumdelikte bezeichnet werden. 2010 fanden im Bereich von Mord und Totschlag zwei von drei vollendeten Taten unter Verwandten oder näheren Bekannten statt[77]. In nur 10,6 % der Fälle mit getöteten Frauen gab es nachweislich zuvor keine persönlichen Berührungspunkte[78]. Das Risiko der Frau, den Gewalttätigkeiten ihres männlichen Partners zum Opfer zu fallen, ist sechsmal größer als umgekehrt. Im Vergleich dazu laufen selbst zuvor misshandelte Frauen bei Tötung ihres Partners bzw. bei entsprechenden Tötungsversuchen weitaus häufiger Gefahr, wegen Mordes verurteilt zu werden. Das jedenfalls berichtet Oberlies[79], die geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verurteilungsstatistik männlicher und weiblicher Mörder und Totschläger anhand von 177 Schwurgerichtsurteilen untersucht hat.
27
Einen der vorderen Ränge in der Schwurgerichtsstatistik nehmen tödlich endende Konflikte zwischen Intimpartnern innerhalb der Trennungsphase ein, wobei zumeist die Frau den ungehemmten Aggressionen des Mannes zum Opfer fällt[80]. In hoher Zahl lassen sich die Täter durch heftige Gemütsbewegungen – sog. Affekte[81] –, diese vielleicht gepaart mit Alkohol[82], zur Tat hinreißen. Dem Angriff auf das Leben des anderen haftet zumeist wenig Planvolles an, wenngleich dem Tatgeschehen mitunter eine lange Phase des Nachstellens und des diffusen Drohens vorgelagert sein kann[83]. Nach dem Geschehen ist der Täter zutiefst erschüttert und überaus geneigt, sich für seine Schandtat „selbst zu richten“. Im Zuge der Tatortanalyse[84] finden sich Hinweise auf das Bemühen emotionaler Wiedergutmachung (sog. Undoing). Der Täter aus dem Umfeld des Opfers versucht durch seine Handlungsweise, die Tat symbolisch durch das Zudecken, Falten der Hände oder Reinigen des Opfers ungeschehen zu machen[85]. Seine Ergreifung lässt in der Regel nicht lange auf sich warten. Gott sei Dank kommt bei nicht wenigen Gewaltangriffen das (zumeist weibliche) Opfer mit dem Leben davon. Wenn die Frau Glück hat, lässt der Affekttäter von sich aus von ihr ab, weil er „zu Verstand kommt“ oder plötzlich doch Mitleid empfindet[86]. Vor allem Würge- und Drosselvorgänge[87] werden ohne äußeren Zwang abgebrochen. Dann stellt sich die Frage des strafbefreienden Rücktritts[88]. Einigen Frauen gelingt die Flucht erst durch List oder massive Gegenwehr, andere überleben, weil Nachbarn oder Unbeteiligte dazwischentreten. Die Intensivmedizin tut ein Übriges. Oft hat es zuvor Phasen der Trennungen und Versöhnungen gegeben, des Bedrohens und des Verzeihens. Dann vielleicht die ersten Handgreiflichkeiten, schließlich Morddrohungen.
28
Abgesehen von der Rücktritts-Problematik werfen Affektdelikte dieser Kategorie immer auch die Frage nach der Schuldform (Verletzungsvorsatz/Tötungsvorsatz[89]) und der Schuldfähigkeit[90] des Täters auf. Die Abläufe ähneln sich auf frappierende Weise. Häufig spielt sich das Tatgeschehen in den eigenen vier Wänden ab. Die Ermittlungen kommen zumeist dadurch in Gang, dass Nachbarn die Polizei herbeirufen, nachdem sie aus der betreffenden Wohnung verdächtige Geräusche oder gar Hilferufe wahrgenommen haben. Der Täter verweilt womöglich noch am Tatort und lässt sich widerstandslos festnehmen.
29
Affekttäter kommen aus allen Bevölkerungsschichten. Arbeiter und Angestellte, aber auch Ingenieure, Ärzte, Studienräte und sogar Pastoren haben sich schon auf der Anklagebank wiedergefunden, nachdem sie ihre Geliebte bzw. Ehefrau getötet oder dies zumindest versucht haben. Die „verhängnisvolle Affäre“, die einen Seitensprung zum Albtraum werden lässt, bis das Fass überläuft und ein seriöser Anwalt zum „Mörder“ wird, ist kein lebensfernes Konstrukt. Vor Jahren musste sich das Aachener SchwurG mit der Totschlagsanklage gegen einen Chefarzt befassen, weil er eine Krankenschwester seiner Krebsstation erstochen hatte. Zu ihr hatte er lange Zeit eine außereheliche Beziehung unterhalten, bis ihr Drängen und Fordern, sich von Ehefrau und Kindern zu trennen, immer extremere Züge annahm. Erst ein demonstrativ zur Schau getragener Parasuizid, dann anonyme Briefe an die Ehefrau. Schließlich die Drohung, ihn durch Indiskretionen beruflich zu ruinieren. Seinen herbeigeführten Rauswurf als Arzt bezahlte die Unglückliche mit ihrem Leben. Außer sich, drang der Onkologe nachts durch ein winziges Toilettenfenster in ihre Wohnung ein und erstach die junge Frau mit einem Küchenmesser. Anschließend lenkte er nach stundenlanger Irrfahrt seinen Pkw gegen einen Brückenpfeiler. Wie durch ein Wunder überlebte er diesen „Unfall“ schwerverletzt. Natürlich können auch Frauen im Affekt töten, wie jedermann aus der Vita der Schauspielerin Ingrid van Bergen weiß, die 1977 „rasend vor Eifersucht“ ihren zwölf Jahre jüngeren Lebensgefährten erschoss.
30
„Gängig“ ist auch das Erschießen[91] oder Erstechen[92] der geliebten (oder auch verhassten) Person auf offener Szene. Es sind insbesondere eifersüchtige Männer, die, nachdem sie verlassen worden sind, ihrer Ex-Partnerin unter hochgradiger affektiver Anspannung auflauern oder sie am Arbeitsplatz überraschen, „zur Rede stellen“ und vor den Augen der Arbeitskollegen töten. Nach anschließender Flucht, auf der der Täter womöglich zunächst ziellos herumirrt, stellt er sich schließlich selbst der Polizei. Für die Verteidigung gilt es dann, den auf Eifersucht oder planvollen Waffeneinsatz gestützten Mordvorwurf abzuwehren und die schuldvermindernden Elemente des Affekts sichtbar zu machen. Erstaunlich oft wird die Polizei durch den Täter selbst zum Tatort gerufen. Oder er bittet Dritte, die Polizei oder Feuerwehr zu alarmieren, um dem Opfer ärztliche Hilfe zu leisten. Hier liegt es besonders nahe, den Tötungsvorsatz in Zweifel zu ziehen[93].
2. Zweikämpfe und Schlägereien mit tödlichem Ausgang
31
Ebenso häufig anzutreffen sind Tötungsdelikte, die aus einer Gruppe heraus, nicht selten im Zuge einer Massenprügelei, jedenfalls aber im Rahmen wechselseitiger Tätlichkeiten geschehen. Es sind durchweg junge Täter, die sich in gruppendynamischen Kraftfeldern dazu hinreißen lassen, mit Messern oder anderen gefährlichen Werkzeugen auf ihre gleichaltrigen Kontrahenten loszugehen. Wie bei allen Gewaltdelikten ist der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen beträchtlich[94].
32
Typisch ist der vom BGH in 2001 verhandelte Totschlagsversuch eines Heranwachsenden. Während einer „Zeltdisco“ war es zwischen rivalisierenden Gruppen aus der Nachbarschaft zu einer Massenschlägerei gekommen. Der Angeklagte, ein Albaner, hatte einen seiner „Gegner“ verfolgt und mit dem Messer niedergestochen[95]. Tötungsdelikte, die aus Schlägereien heraus spontan geschehen, können u.U. die Beteiligten beider Seiten auf die Anklagebank bringen, sofern sie noch ausfindig zu machen sind. Es muss dann in einer extrem zeitaufwändigen Hauptverhandlung geklärt werden, in welcher Rolle die jeweiligen Angeklagten „mitgemischt“ haben und ob überhaupt einer von ihnen strafrechtliche Verantwortung für die tödliche Stichverletzung trägt.
33
Beteuert jeder seine Unschuld, ist die Beweislage mitunter äußerst verwirrend. Die Geschädigten, selbst in Gefahr allein schon wegen ihrer Beteiligung an der Schlägerei (§ 231 StGB[96]) bestraft zu werden, halten mit der Wahrheit hinterm Berg. Womöglich kommt es unter den Angeklagten zu wechselseitigen Schuldzuweisungen. Vom Exzess[97] des unerkannt entwischten Haupttäters ist die Rede. Die StA hingegen spricht von Zurechenbarkeit und Mittäterschaft[98]. Unbeteiligte Beobachter, die vielleicht sogar selbst unter Alkoholeinfluss standen[99], helfen vielfach nicht weiter. Da in aller Regel ein Turbulenzgeschehen zugrunde liegt, das eine präzise Wahrnehmung erschwert, sind die Angaben von Augenzeugen zur Tatentstehung, zum Ablauf und zu den Beteiligten wenig verlässlich. Häufig kommt es schon im Ermittlungsverfahren zu Lichtbildvorlagen oder Gegenüberstellungen[100]; die Ergebnisse sind oft mit großer Skepsis zu betrachten. Das gilt verstärkt für Täteridentifizierungen in der Hauptverhandlung, wenn keine Vergleichspersonen bereitstehen und die Angeklagten auf der Anklagebank Platz nehmen mussten[101]. Zeugen sind womöglich dem einen oder anderen Lager zuzuordnen, oder sie ergreifen aus Mitleid unbewusst Partei für den Unterlegenen, das Opfer. Immer fragt sich, wie oder wer die Auseinandersetzung begonnen hat. Womöglich berufen sich gerade die Angeklagten darauf, angegriffen worden zu sein und sich nur gewehrt zu haben (Notwehr, Nothilfe)[102]. Mit Hilfe der Kriminaltechnik werden über Blutanhaftungen oder Fasern an sichergestellten Kleidungsstücken unmittelbare Kontakte zwischen Opfer und Tatbeteiligten nachvollzogen. Allerdings kann Blut auch sekundär übertragen worden sein. Spurenkunde ist gefragt.
34
Wird die Tatbeteiligung/Täterschaft eingeräumt oder anderweitig geklärt, stellt sich die Frage nach dem Tötungsvorsatz[103]. Es wird sodann, unterstützt durch Psychiater und/oder Pharmakologen, die (kombinierte!) Wirkung antriebssteigernder Substanzen und gruppendynamischer Prozesse[104] auf das Hemmungsvermögen zu beurteilen sein. Hier könnte die Verteidigung auf die zusätzliche Hinzuziehung eines Psychologen hinwirken[105]. Schließlich eignen sich diese Fälle auch oft genug für einen Täter-Opfer-Ausgleich (TAO; § 46a StGB)[106].
3. Bewaffnete Überfälle und Einbrüche mit Todesopfern
35
Immer wieder sorgen mit Waffen verübte Raubdelikte für Aufsehen. Beispiel Taximorde[107]: Charakteristisch ist der Fall eines zur Tatzeit knapp 21-jährigen Angeklagten, der sich Anfang 2009 in finanziellen Schwierigkeiten befunden und in 2 Fällen, bewaffnet mit einem Teleskopschlagstock, am Zielort die Taxifahrer mit wuchtigen Schlägen schwer verletzt hatte, um mit einer lächerlichen Beute von 250,00 € bzw. 100,00 € zu entkommen[108]. Aus Verteidigersicht ist nicht selten das sichere „Wiedererkennen“ des Tatverdächtigen durch das Opfer problematisch. Die Verwendung eines „Totschlägers“[109] wirft die Frage auf, ob sogar (bedingter) Tötungsvorsatz vorlag und von einem Mordversuch auszugehen ist. Da die Opfer überlebt haben, wäre allerdings die Frage nach einem strafbefreienden Rücktritt[110] zu stellen. Die Beuteerwartung kann nicht hoch gewesen sein; also ist beim Täter von akuter Geldnot auszugehen. Womöglich handelt es sich um die Beschaffungstat eines Drogenabhängigen, was die Hinzuziehung eines Psychosachverständigen zur Beurteilung der Steuerungsfähigkeit erforderlich machen würde. Hier ist jeweils, fehlende Vorstrafen und ein reumütiges Geständnis vorausgesetzt, auch an einen minder schweren Fall[111] zu denken.
36
Während tödlich verlaufende Überfälle auf Geldinstitute, wie etwa der spektakuläre Bankraub in Gladbeck im Jahre 1988, der mit dem Tod zweier Geiseln endete[112], dank vielfältiger Schutzvorkehrungen mittlerweile äußerst selten sind, machen immer noch brutale, tödlich endende Überfälle auf Tankstellen[113], Geldboten[114] oder Spielhallen[115] von sich reden. Auch Einbrüche in Wohn- und Geschäftsräume unter Mitnahme von Waffen oder gefährlichen Werkzeugen enden mitunter tödlich, wenn die Täter durch Hausbewohner überrascht werden, in Panik geraten und spontan töten, um unerkannt zu bleiben[116]. Erstickt das Opfer, das mittels eines Knebels oder Klebebandes am Schreien gehindert werden sollte, liegt eine Abweichung vom vorgestellten Kausalverlauf vor[117]. Nicht selten sind die Täter drogen- oder alkoholabhängig und zur Tatzeit berauscht, sodass sich häufig genug die Frage der Schuldverminderung gem. § 21 StGB und der Unterbringung stellt[118].
4. Bluttaten im Namen der Ehre
37
Weil Tötungen aus Blutrache und sog. Ehrenmorde[119] große Gemeinsamkeiten aufweisen und vielleicht auch mit denselben Klischees behaftet sind, werden sie nicht selten in einem Atemzug genannt und auch juristisch abgehandelt. Täter und Opfer sind zumeist nichtdeutscher Abstammung und kommen aus strenggläubigen Einwandererfamilien, die sich noch sehr stark an heimatlichen Wertvorstellungen und Gebräuchen orientieren oder sich, wie etwa die Yeziden, bedingungslos den ungeschriebenen Gesetzen ihrer Glaubensgemeinschaft unterwerfen. Die Beteiligten leben zumeist abgeschottet in Parallelwelten oder Parallelgesellschaften und haben kaum Kontakte zu deutschen Familien. Ehen oder Liebschaften mit Deutschen sind tabu. In der Kultur ihres jeweiligen Herkunftslandes haben Ehrenmorde und Blutrache seit Langem eine unheilvolle Tradition. In beiden Konstellationen spielt die verletzte Ehre eines Familienverbandes eine entscheidende Rolle[120]. Und hier wie dort stellt sich die Frage, ob die durch Herkunft, Erziehung, Glauben oder Tradition bewirkte „Verblendung“ des Täters der Annahme niedriger Beweggründe[121] entgegensteht.
38
Aus Sicht eines Strafverteidigers in Schwurgerichtsverfahren ist allerdings dringend davor zu warnen, Tötungen aus Blutrache und Ehrenmorde in einen Topf zu werfen. Sie lassen sich, was die emotionale Ausgangslage des Täters anlangt, in vielen Fällen kaum miteinander vergleichen. Und sie werfen auch im Rahmen des Verteidigungskonzepts völlig unterschiedliche Fragen auf. Angesichts großer Übereinstimmungen hinsichtlich des kulturellen Hintergrunds und gängiger Denkschablonen kommt mitunter im Einzelfall die sorgfältige Prüfung zu kurz, ob es sich überhaupt um einen „klassischen Fall“ von Ehrenmord oder Blutrachetötung handelt, der die Annahme einer geplanten Bluttat aus niedrigen Beweggründen nahelegen könnte.
39
Bluttaten im Namen der Ehre mögen zahlenmäßig nicht sonderlich groß sein, sind aber durchweg aufsehenerregend. Wenn die verblendeten Täter denn überhaupt gefasst und vor Gericht gestellt werden, steht ihnen die breite Öffentlichkeit in Deutschland zumeist mit völligem Unverständnis gegenüber. Entsprechend groß ist der mediale Druck, der auf dem SchwurG lastet. Die Gefahr, dass die Tat des Angeklagten vorschnell in das Raster der „Blutrache“ oder des „Ehrenmordes“ gepresst wird, ist nicht unbeträchtlich. Die Verteidigung in diesen Fällen erfordert Engagement und Unerschrockenheit, aber auch kritische Distanz. Gerade in Blutrachefällen gibt es kaum neutrale Zeugen, vielmehr stehen sich Zeugen zweier, seit jeher verfeindeter Lager unversöhnlich gegenüber. Das schlägt sich unter Umständen auch in der Bereitschaft nieder, für die „gute Sache“ des eigenen Lagers – wenn nötig – hemmungslos zu lügen. Und die Erwartungen an den Verteidiger, einen Freispruch, zumindest aber eine „milde Strafe“ zu erreichen, sind hoch. Auf der anderen Seite steht die Familie des Opfers, die zwar ebenfalls anwaltlich vertreten[122] ist, aber aus dem Verlangen, nun ihrerseits Rache zu üben, keinen Hehl macht. Geht es vor dem SchwurG um eine Tötung aus Blutrache, ist sonnenklar, dass auf der „Opferseite“ bereits Überlegungen oder Entscheidungen getroffen worden sind, an wem man Rache üben und welches Mitglied der Opferfamilie die Vollstreckung übernehmen wird. Der Verteidiger muss also von Anbeginn darauf drängen, den inhaftierten Mandanten von Mithäftlingen abzuschirmen, die mit der Opferfamilie – wenn auch nur weitläufig – verwandt sind.
40
Für die Hauptverhandlung ist ein Höchstmaß an Sicherheit einzufordern[123], um der Gefahr einer Eskalation oder gar tätlicher Angriffe im Gerichtssaal und auf den Zugängen entgegenzuwirken. Nicht nur die Familie des Opfers stellt u.U. ein Sicherheitsrisiko dar. Im Februar 2009 kam es in Hamburg in dem vorerwähnten Prozess um die Tötung der 16-jährigen Morsal O. zu tumultartigen Szenen, als das LG die Verurteilung des Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verkündete. Die Mutter des Verurteilten drohte noch im Gerichtssaal, sich aus dem Fenster zu stürzen, wurde aber durch ein Familienmitglied vom Fensterbrett gezerrt. Der Vater wurde vor dem Gerichtsgebäude ausfallend und bedrohte dort anwesende Journalisten. Bereits im Sitzungssaal hatten die Familienmitglieder immer wieder gegen die schusssichere Glasabtrennung gepocht. Ein jüngerer Bruder des Angeklagten musste, weil er das Gericht anpöbelte, abgeführt werden, andere Familienmitglieder begleiteten die Urteilsbegründung mit lautem Schluchzen. Immer wieder gab es Zwischenrufe. Selbst der Angeklagte attackierte die Richter verbal und warf einen Papierstapel in ihre Richtung[124]. Auch das LG Hagen musste sich in dem oben dargestellten Fall nach der Urteilsverkündung unflätige Beschimpfungen durch den Vater des Angeklagten anhören, der ausgerastet war und wegen der Strafhöhe laut auf dem Gerichtsflur skandierte[125].
a) Ehrenmorde
41
Ehrenmorde finden innerhalb der eigenen Familie statt. Das Grundschema des Ehrenmordes, wie er vorwiegend in türkischstämmigen Familien vorkommt, besteht in der Tötung eines zumeist weiblichen Familienmitgliedes durch ein männliches Mitglied ein und derselben Familie zur Wiederherstellung der Familienehre, die zuvor durch das Opfer beschmutzt bzw. beschädigt worden ist. Mit der Tötung des „Rechtsbrechers“ durch die Hand eines Familienmitglieds ist die verloren geglaubte Ehre der Familie wiederhergestellt und der Konflikt „bereinigt“[126]. Das landläufig verbreitete Bild, dass die Opfer fast ausnahmslos Frauen seien, die Tabus verletzen und dadurch die Ehre der Familie beschädigen, wird durch eine soeben veröffentlichte, vom BKA in Auftrag gegebene Studie zurechtgerückt. Immerhin sind 1/3 der durch Ehrenmorde Getöteten männlichen Geschlechts[127].
42
Nicht selten sind Ehrenmorde darauf zurückzuführen, dass sich junge Frauen einer Zwangsheirat entzogen oder widersetzt haben. Das am 01.07.2011 in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat (ZwHeiratBekG) v. 23.06.2011 (BGBl. I S. 1266 [Nr. 33]) ist ein erster wichtiger Schritt, der bundesdeutschen Rechts- und Werteordnung auch innerhalb rückständiger nichtdeutscher Familien oder Gemeinschaften Geltung zu verschaffen.
43
Spektakuläre Strafprozesse über Ehrenmorde[128], in denen die Werte des deutschen Rechtsstaats und die verkrusteten Vorstellungen einer anatolischen, afghanischen oder yezidischen Parallelgesellschaft aufeinanderprallen, sind Zeitdokumente einer gescheiterten Integration.
44
Erst im September 2010 hat der BGH das Ehrenmord-Urteil gegen einen 47 Jahre alten türkischen Angeklagten bestätigt, den im März 2010 das SchwurG Schweinfurt wegen der Ermordung seiner 15-jährigen Tochter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt hatte[129]. Der in seinem Ehrgefühl verletzte Täter missbilligte die Beziehung seiner Tochter zu einem gleichaltrigen Freund. Nachdem sein Bemühen, die Tochter in die Türkei zurückzuschicken, gescheitert war, hatte er in der Nacht zum 24.06.2009 mit einem dreißig Zentimeter langen Fleischmesser 68-mal auf seine Tochter eingestochen. Aus Verteidigersicht stellt sich bei geklärter Täterschaft die Frage nach der Bewusstseinslage des verblendeten Tatverdächtigen in Bezug auf etwaige Mordmerkmale (Heimtücke und niedrige Beweggründe[130]) und – auch angesichts der engen Stichfolge – der verminderten Schuldfähigkeit wegen eines Affekts[131]. Die Tat beruht in diesen Fällen nach den Vorstellungen der Rechtsgemeinschaft in Deutschland jedenfalls dann auf niedrigen Beweggründen, wenn der Täter bereits viele Jahre in Deutschland lebt, auch hier zur Schule gegangen und mit den deutschen Rechts- und Wertvorstellungen vertraut ist – so die Urteilsbegründung das LG Hamburg im Prozess um den Ehrenmord an der 16-jährigen Morsal O., die im Mai 2008 durch ihren 23-jährigen Bruder mit 23 Messerstichen getötet worden war, weil sie ihren Körper nicht genügend durch Kleidung verhüllt, sich zu stark geschminkt, heimlich Umgang mit Männern gepflegt, sich angeblich prostituiert und Drogen genommen hatte. Der Täter war mit seiner Familie 1992 aus Afghanistan in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt und hatte in der Folgezeit die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen[132].
45
Häufig gibt es eine Vielzahl von tatverdächtigen Familienangehörigen, die als Haupttäter, Anstifter oder Gehilfen in Betracht kommen, wie etwa im Fall eines vom LG Kleve abgeurteilten Ehrenmordes. Ein 20 Jahre altes türkisches Mädchen musste die intime Beziehung zu seinem Freund mit dem Leben bezahlen[133]. Die junge Frau war durch einen Gehilfen an einen entlegenen Ort gelockt und dort von ihrem Bruder durch Angriffe gegen den Hals und durch das Zertrümmern des Schädels getötet worden. Der Vater hatte derweil plangemäß die andere Tochter abgelenkt[134].
46
Dass archaische Strukturen auch überwunden werden können, zeigt der Fall eines durch das LG Limburg an der Lahn wegen versuchter Anstiftung zum Ehrenmord verurteilten Türken. Der aus Anatolien stammende, als Imam tätige und den heimatlichen Wertvorstellungen eng verbundene 47-jährige Angeklagte hatte entschieden, eine seiner Töchter im Sommer 2006 in die Türkei zu schicken, um sie dort mit ihrem Cousin, dem sie nie begegnet war, zu verheiraten. Es kam zur Verlobung, die die Tochter jedoch wieder löste, nachdem sie sich in der Türkei in einen anderen Mann verliebt hatte. Der Vater drohte seiner Tochter mit dem Tod, falls die Hochzeit nicht doch noch stattfinden werde. Die Tochter floh zur Familie ihres neuen Lebensgefährten, den sie auch heiraten wollte. Der Angeklagte bedrängte einen seiner Söhne, seine Schwester in der Türkei zu töten. Der verzweifelte Sohn offenbarte sich jedoch seinem Lehrer, der die Polizei verständigte[135].