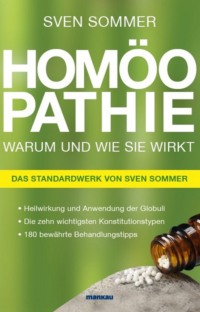Kitabı oku: «Homöopathie. Warum und wie sie wirkt», sayfa 5
DER GALILEO-EFFEKT IN DER HOMÖOPATHIE
Hahnemann: wie Galileo ein verkanntes Genie seiner Zeit?
Wiederholt sich die Geschichte?
Generell stellt sich die Frage, ob eine Außenseitermethode wie die Homöopathie überhaupt eine reelle Chance hat, eines Tages bewiesen zu werden, wenn die meisten Wissenschaftler bisher steif und fest behaupten, sie könne nicht wirken. Doch wie die Geschichte beweist, kann es mitunter etliche Jahrhunderte dauern, bis sich ein Wissen als selbstverständlich etabliert hat. Dies möchte ich am Beispiel des heliozentrischen Weltbildes verdeutlichen. Schon damals weigerten sich Wissenschaftler fast 250 Jahre lang umzudenken und einzugestehen, dass ihre Ansicht, alles drehe sich um die Erde (und damit um den Homo sapiens), falsch war.
Das kopernikanische Weltsystem
Der polnische Astronom Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543) stellte als Erster die Theorie eines heliozentrischen Weltsystems auf. Er ging davon aus, nicht die Erde, sondern die Sonne befinde sich im Mittelpunkt unseres Universums, während unser Planet sich um sich selbst drehe und um die Sonne kreise. Sein Hauptwerk »Über die Kreisbewegungen der Weltkörper« war zwar schon 1530 fertiggestellt worden, wurde jedoch erst nach seinem Tod veröffentlicht. Die meisten derer, die Kopernikus’ Theorie damals verstanden, konnten jedoch das Konzept einer sich bewegenden Erde, die nicht im Mittelpunkt alles Seins steht, nicht akzeptieren. Für mehr als ein halbes Jahrhundert gab es deshalb nur etwa zehn Befürworter des heliozentrischen Weltsystems. Der größte Teil von ihnen war übrigens außerhalb der Universitäten tätig. Darunter befanden sich der Deutsche Johannes Kepler (1571 – 1630) und der Italiener Galileo Galilei (1564 – 1642).
Ein verkanntes Genie seiner Zeit
Galileo Galilei, von der damaligen Wissenschaft vielfach nicht gewürdigt, entwickelte das heliozentrische Weltbild weiter. Doch damit nicht genug: Schon zu Beginn seiner Karriere erhielt er, damals gerade erst fünfundzwanzig Jahre alt, einen Lehrstuhl für Mathematik an der Universität von Pisa, den er aber schon drei Jahre später wieder abgeben musste, weil seine Behauptung, die gängige Lehrmeinung des Aristoteles sei falsch und die Fallgeschwindigkeit sei proportional zum Gewicht eines Körpers, im Widerspruch zu den etablierten Gelehrten an der Universität stand. Natürlich sollte Galileo auch hier Recht behalten.
Als er allerdings 1613 eine Arbeit veröffentlichte, in der er die Richtigkeit der kopernikanischen Theorie voraussagte, teilte ein Professor der Universität Pisa dem Arbeitgeber Galileis, den Medici, mit, der Glaube an eine sich bewegende Erde sei ketzerisch. Drei Jahre später wurden kopernikanische Bücher der kirchlichen Zensur unterworfen und Galileo wurde aufgefordert, die Auffassung einer sich bewegenden Erde nicht länger zu vertreten. Galileo wagte sich erst Jahrzehnte später wieder an das Thema heran, als er den Dialog veröffentlichte, in dem er die kopernikanische Theorie in Bezug auf die Gezeiten neu diskutierte. Die Strafe folgte stante pede und er wurde von der Inquisition in Rom vorgeladen, welche ihn 1633 zwang, seiner »ketzerischen« Theorie abzuschwören. Die lebenslange Haft, zu der er verurteilt wurde, konnte zu ständigem Hausarrest abgemildert werden. Den »Dialog« musste er jedoch verbrennen und seine Verurteilung konnte damals an jeder Universität eingesehen werden.
Erst 1992 (!) gestand der Vatikan seinen Irrtum endlich ein, nachdem ihm zwanzig Jahre zuvor anhand der Prozessunterlagen die Hauptverantwortung für die Verurteilung zugeschrieben wurde. Galileo wurde daraufhin offiziell von der Kirche rehabilitiert. Die Beteiligung der damaligen etablierten Wissenschaft – man erinnere sich: Es war ja ein Kollege aus Pisa gewesen, der ihn an die Inquisition verraten hatte – wurde dagegen bis heute weder richtig aufgedeckt noch zugegeben. Nach der Unterdrückung der kopernikanischen Idee im Zuge des Kirchenprozesses gegen Galilei blieben nur noch ganz wenige heimliche Anhänger des heliozentrischen Weltsystems übrig. Die meisten Wissenschaftler nahmen damals das heute längst wieder vergessene Modell des Dänen Tycho Brahe (1546 – 1601) an, in dem zwar die Planeten um die Sonne kreisen, die Sonne sich aber weiterhin einmal pro Tag um die ruhende Erde dreht.
Newtons Himmelsmechanik zeigte endlich: Galilei hatte Recht
Erst Isaac Newton (1643 – 1727) verband die mathematische Physik Galileis mit den Kepler’schen Planetengesetzen und entwickelte das universelle Gravitationsgesetz. Dabei stehen alle Körper im Weltraum unter dem Einfluss der Schwerkraft. Dies veröffentlichte Newton 1687 in seinem Hauptwerk Principia Mathematica. Somit übernahmen Ende des 17. Jahrhunderts die meisten Wissenschaftler und Denker Englands, Frankreichs, Dänemarks und der Niederlande das kopernikanische System. Im restlichen Europa, also auch in Deutschland, sollte es noch weitere 100 Jahre dauern, bis sich das heliozentrische Weltsystem in den wissenschaftlichen Kreisen endgültig durchgesetzt hatte.1
Es verstrichen also gut zweihundertfünfzig Jahre, bis sich knapp vor Beginn des neunzehnten Jahrhunderts das Wissen etablierte, dass die Erde (und somit auch der Mensch) nicht im Mittelpunkt der Schöpfung steht. Die Kirche, aber auch die meisten Vertreter der damaligen Wissenschaft, konnten und wollten diese Erkenntnis lange Zeit nicht akzeptieren. Die Ideen von Kopernikus und Galilei waren ihnen einfach zu radikal. Selbst über die Jahrhunderte hinweg gab es hier nur ganz wenige aufgeschlossene Geister, die diese Ideen überhaupt verstanden. Die meisten damaligen Wissenschaftler besaßen weder den Weitblick noch den Mut, Erkenntnisse und Einsichten zu akzeptieren, die dem Wissen ihrer Zeit so weit voraus waren. Zudem stellte dieses neue Wissen eine Bedrohung für die damals vorherrschende Wissenschaft dar: Generationen altehrwürdiger Gelehrter hätten falsch gelegen und hätten eingestehen müssen, ihre Idee eines geozentrischen Weltbilds sei »out of date«. Das hätte das bisherige Verständnis von der Welt komplett auf den Kopf gestellt. Ganze Bücher hätten umgeschrieben werden müssen! Das konnte und durfte einfach nicht sein. Selbst als Newton es ihnen vorrechnete, dauerte es noch Jahrzehnte, bis sich das etablierte, was heute jedes Kind in der Schule lernt.
Fazit
Dem kritischen Beobachter eröffnet sich hier so manche historische Parallele zwischen der Entdeckung physikalischer Effekte von großen Himmelskörpern im Makrokosmos des Weltraums und der Erkenntnis von der Wirksamkeit kleiner Kügelchen im Mikrokosmos der homöopathischen Potenzen. Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts stellt sich somit wieder einmal die Frage, ob die Geschichte sich nicht vielleicht doch wiederholt.
MODERNE ERKENNTNISSE UND THEORIEN
HOMÖOPATHIE UND REGELKREISE
Wissenschaftliche Modelle geben Funktionsweisen in schematisierter, auf wesentliche Züge komprimierter Darstellung wieder. Sie stellen eine effektive Hilfe bei der Aufstellung von Hypothesen dar, aus denen in der Folge Theorien entstehen können.
Das homöopathische Ähnlichkeitsprinzip, moderne Erkenntnisse über die Rezeptordynamik und komplexe Regelkreissysteme
Zu seiner Zeit glaubte Hahnemann, homöopathische Mittel würden die Lebenskraft stärken. Heute sprechen wir eher von einer Stärkung des Immunsystems. Doch was passiert genau? Mit Sicherheit weiß man es bisher nicht, aber in diesem Kapitel soll ein erstes Modell vorgestellt werden, an dem sich Wissenschaftler heutzutage die Wirkung der allerkleinsten Gaben zu erklären versuchen. Da homöopathische Mittel oft in Potenzen unter der D24 verwendet werden, in denen immer noch kleine chemische Mengen pflanzlichen, mineralischen oder tierischen Ursprungs zu finden sind, wird in einem ersten Schritt auf die Wirksamkeit kleinster Dosen pharmakologisch wirksamer Substanzen eingegangen. Mit dieser Vorgehensweise umgeht man das Problem hoher Verdünnungen, in denen rechnerisch keine Moleküle mehr vorhanden sind. Das biophysikalische Paradigma der homöopathischen Hochpotenzen soll an späterer Stelle diskutiert werden.
Komplexe Regelkreissysteme
Ein möglicher Wirkmechanismus homöopathischer Mittel wird heute in deren Fähigkeit gesehen, komplexe Regelkreissysteme zu regulieren. Da das Verständnis besagter Regelkreise unabdingbar für das Verstehen dieses Erklärungsmodell ist, hier erst einmal die wichtigsten Fakten: Ganz generell werden Regelkreise verwendet, um Regulationsvorgänge zu beschreiben, in denen variable Werte in einem bestimmten Rahmen, also zwischen einer unteren und oberen Grenze, gehalten werden sollen. Dabei wird eine Abweichung vom Soll-Zustand über Signale an ein Regulationssystem mitgeteilt, das die Veränderung registriert und Vorgänge in Kraft setzt, um den Soll-Zustand wiederherzustellen.
Im menschlichen Körper gibt es zahllose Beispiele solcher Regelkreissysteme: die Regulation des Blutdrucks oder des kardiovaskulären (Herz-Kreislauf) und respiratorischen (Atmung) Systems, die Wärme- und Blutzuckerregulation, der gesamte Hormonhaushalt, die Aufnahme von Nährstoffen und die Natrium-Kalium-Pumpe an der Zellmembran. Allseits bekannt ist die Regulation des Blutzuckers. Üblicherweise schwankt dieser beim gesunden Menschen um einen normalen unteren und oberen Wert (Nüchternzucker: 65 – 120 mg/dl). Wenn wir etwas Süßes essen, steigt der Blutzucker rapide an, was dazu führt, dass körpereigenes Insulin ausgeschüttet wird, um den erhöhten Blutzuckerspiegel zu senken. Funktioniert dieser Regelkreis nicht mehr, fällt die Regulation aus. Es kommt entweder zum Unterzucker, zur Hypoglykämie, oder zum zu hohen Zucker, Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) genannt.
Die Sache ist insofern höchst komplex, da die Regulation eines bestimmten Regelkreises wiederum andere Regelkreise beeinflussen kann bzw. direkt in diese eingreift. Das geschieht auf und zwischen allen körperlichen Ebenen, sprich: auf Zell- oder Organ-Ebene, auf der körperlichen Ebene als Ganzes und auch auf der psychischen Ebene.
Somit dienen Regelkreismodelle in der Medizin dazu, Teilfunktionen eines komplexen Ganzen zu beschreiben. Damit ein Regelkreis im Körper funktionieren kann, bedarf es folgender Komponenten:
• anatomische und biochemische Wirkmechanismen, die regulierbar und reversibel sind, z. B. endokrine Drüsen, Gefäßwände, Zellmembranen und Enzyme.
• Signalmoleküle wie Hormone, Cytokine und Neurotransmitter (Botenstoffe).
• Rezeptoren, an denen die Signalmoleküle andocken. Diese gibt es an der Zellmembran und in der Zelle selbst. Sie sind höchst flexibel und anpassungsfähig.
Rezeptordynamik
Bei dem hier vorgestellten Erklärungsmodell1 der Wissenschaftler Paolo Bellavite und Andrea Signorini sind die Rezeptoren und ihr Verhalten von größter Bedeutung. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass etliche Phänomene, die auch bei Experimenten mit homöopathischen Mitteln beobachtet wurden, durch das Verhalten dieser Rezeptoren erklärt werden könnten – unter anderem,
• dass ein Mittel bei unterschiedlicher Dosierung unterschiedliche Wirkungen aufweisen kann.
• dass zwei unterschiedliche Mittel ein und dieselbe Wirkung zeigen können.
• dass ein Mittel zwar bei einem kranken Organismus, nicht aber bei einem gesunden wirkt.
• dass die Wirksamkeit eines Mittels je nach Zustand des Organismus variiert bzw. je nachdem, ob und auf welche Weise der Organismus mit anderen Mitteln vorbehandelt worden ist.
Doch wie funktionieren diese Rezeptoren? Um die Frage beantworten zu können, folgt eine grob vereinfachte Zusammenfassung der heute in der Biomedizin gängigen Vorstellungen über die Rezeptordynamik.
Generell dienen Rezeptoren zur Aufnahme von Signalen. Dabei können die Zellen die Anzahl ihrer Rezeptoren erhöhen (Sensibilisierung bis hin zur Hypersensibilität) oder verringern (Desensibilisierung, Anpassung, Toleranzerhöhung). Auf diese Weise sind sie in der Lage, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und ihren eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Folgende gängige Zustandsänderungen der Rezeptoren sind bekannt:
• Sensibilisierung: Eine kleine Dosis eines Signalstoffs führt zu einer Vermehrung der Rezeptoren (und zwar nicht unbedingt nur der signalspezifischen, sondern in der Regel auch der unspezifischen), ohne dass die Zelle dabei wirklich aktiviert würde, das heißt, ohne eine Wirkung zu provozieren. Die Zelle ist jedoch sensibilisiert (entweder nur für den Signalstoff oder auch für andere Moleküle) und kann jederzeit schnell reagieren.
• Aktivierung: Eine stärkere oder normale Dosis eines Signalstoffs führt über die Rezeptoren zu einer Aktivierung der Zelle, was dann eine spezifische Wirkung hervorruft, beispielsweise eine Kontraktion (bei einer Muskelzelle) oder die Bildung eines Hormons (in einer Drüse).
• Desensibilisierung: Eine sehr starke oder sehr lange andauernde Ausschüttung von Signalstoffen führt dazu, dass die Rezeptoren für dieses spezifische Signal rasch abnehmen. In der Zelle kommt es zur Desensibilisierung auf den Signalstoff, was man Gewöhnungseffekt nennt. Da die anderen, unspezifischen Rezeptoren aber noch existieren, eventuell sogar noch zugenommen haben, kann die Zelle weiterhin auf andere Signale reagieren, ja sogar hochsensibel für diese sein.
Dieser dosierungsabhängige Umkehreffekt ist bereits seit Paracelsus in der Pharmakologie bekannt. Jedes Gift kann auch eine Heilwirkung entfalten: »Dosis fecit venenum« (»Die Dosis macht das Gift«). Die in der Heilkunde bekannte Arndt-Schultz-Regel besagt nichts anderes.
Das Ähnlichkeitsprinzip
Das Modell für die Wirksamkeit homöopathischer Mittel setzt genau an diesen Rezeptoren im Regelkreissystem an. Dabei geht man davon aus, dass die spezifischen Rezeptoren in einem erkrankten System sehr stark abnehmen und eine gesunde Selbstregulation somit nicht mehr möglich ist. Hypothetisch stimuliert nun das homöopathische Mittel – aufgrund des Ähnlichkeitsprinzips – andere Rezeptoren, die daraufhin eine vergleichbare, regulierende Reaktion hervorrufen. Dies soll nun anhand von drei Abbildungen verdeutlicht werden.

Abbildung 1
Abbildung 1 zeigt schematisch und höchst vereinfacht den Regelkreis eines gut funktionierenden Systems. Dabei wird der gesunde Zustand (G) durch pathologische Störfaktoren in den kranken Zustand (K) versetzt. Auf diese Veränderung des Soll-Zustands reagiert das System mit der Zunahme der Störsignale (s), welche sich in Form von Krankheitszeichen, Symptomen und veränderten Laborwerten äußern. Zudem führt sie über eine Vermehrung der spezifischen Rezeptoren (sr) zunächst zur Sensibilisierung des Regulationssystems und in der Folge zu dessen Aktivierung. Dem folgt die regulative Reaktion oder Antwort (r), die den kranken Zustand (K) in den gesunden Zustand (G) zurückführt. Das System reguliert sich hier selbst. Es ist eine Selbstheilung, in die von außen nicht eingegriffen werden muss. Von Interesse ist dabei, dass auch die Reaktion (r) zu Krankheitszeichen, Symptomen und veränderten Laborwerten führen kann. Krankheitssymptome wie Fieber wären dementsprechend Ausdruck eines körpereigenen Selbstregulationsversuchs, der deshalb per se nicht schlecht ist. Es könnte sogar zur Beeinträchtigung der Selbstregulation kommen, wenn man diese Symptome unterdrückt. So führt Fieber dazu, dass gewisse Mikroorganismen wie Bakterien oder Viren nicht mehr gut überleben können, weil sie die erhöhte Temperatur nicht aushalten.
Ein paar Grad Unterschied machen da einiges aus. Des Weiteren heizt es unser Immunsystem kräftig an. Mit jedem Grad Temperaturerhöhung verzehnfacht sich dessen Aktivität. Normales Fieber zu unterdrücken, bedeutet also auch, die körpereigene Immunabwehr lahmzulegen oder zumindest zu schwächen.

Abbildung 2
Abbildung 2 zeigt dasselbe System, welches aber jetzt anhaltenden oder sehr starken pathologischen Störfaktoren ausgesetzt ist. Der Krankheitszustand ist verschärft, was zu einer erheblichen oder anhaltenden Zunahme der Störsignale (s) führt. Das Regulationssystem reagiert auf diesen starken und/oder anhaltenden Reiz nun nicht mit einer kräftigen Erhöhung der Rezeptoren, wie man es vielleicht erwarten könnte, sondern genau mit dem Gegenteil. Die Anzahl der spezifischen Rezeptoren nimmt rasch ab, worauf eine regulative Reaktion in zunehmendem Maß nicht mehr stattfinden kann. Es kommt zur Desensibilisierung oder Gewöhnung. Andere Rezeptoren (ar) sind jedoch noch vorhanden und können sogar zunehmen. Das System bleibt deshalb für andere Signale weiterhin empfänglich, ja eventuell sogar überempfindlich.

Abbildung 3
Abbildung 3 zeigt nun ein System, in dem ein homöopathisches Mittel den Regulationsvorgang wieder in Gang bringt. Wie in Abbildung 2 hat das Regulationssystem die spezifischen Rezeptoren (sr) verloren. Jetzt dient das homöopathische Mittel als Signal, welches das System über einen anderen Rezeptor (ar) stimuliert, eine vergleichbare oder gleiche Reaktion (r) zu produzieren, wie sie durch Stimulation der Störsignale (s) entsteht – und das, obwohl die Zahl der spezifischen Rezeptoren verringert ist.
Komplexität und individuelles Vorgehen
Das vorliegende Beispiel ist ein höchst vereinfachtes Anschauungsmodell, denn im Krankheitsfall wird in aller Regel nicht nur ein Regelkreis gestört, sondern meist eine ganze Kette von ihnen. Je nachdem, wie und in welcher Reihenfolge die einzelnen kybernetischen Kreise im individuellen Fall betroffen sind, führt dies zu einer ganz bestimmten, individuellen Auswahl von Störsignalen, also Symptomen und Krankheitszeichen.
Hier wird die Eleganz der homöopathischen Methode deutlich. Nur ein analoges Prinzip wie das Ähnlichkeitsprinzip der Homöopathie macht es bisher möglich, anhand der Arzneimittelprüfungen Wirkstoffe zu finden, die bei einer bestimmten Störung spezifisch auf diese lahmgelegten Regelkreise einwirken können. Aufgrund von Komplexität, Vielschichtigkeit und Vielzahl der betroffenen Systeme sowie durch die Dynamik und die verschiedenen Stadien der Krankheitsprozesse dürfte es im Gegensatz dazu äußert schwierig sein, Substanzen mittels heute gängiger wissenschaftlicher Vorgehensweisen und Methoden zu identifizieren, die solch spezifisch blockierte kybernetische Kreissysteme gezielt beeinflussen können.
Durch die komplexe Regelkreisdynamik werden auch ganz individuelle Beschwerdekomplexe erklärbar: Zwar finden sich bei einer bestimmten pathologischen Störung (z. B. durch das Grippevirus x) ganz typische Krankheitssymptome, unter denen die Mehrzahl der Erkrankten leiden (bei der Grippe: hohes Fieber und Gliederschmerzen). Doch neben diesen Standard-Symptomen kommt es bei jedem Einzelnen aufgrund unterschiedlich betroffener Regelkreissysteme (Art des Virus, unterschiedlicher Eintrittsort des Erregers, individueller Zustand und Reaktion des Systems etc.) zu individuellen Beschwerden, die von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich ausfallen und zudem höchst eigen und ungewöhnlich sein können, wie Durst nur während des Schüttelfrostes oder pochende Schmerzen hinter dem Augapfel, um beim Beispiel Grippe zu bleiben.
Für den Homöopathen sind gerade diese absonderlichen, ungewöhnlichen Krankheitszeichen und Symptome von großer Bedeutung, da sie ihm helfen, das Simillimum (= das ähnlichste Mittel) für eine individuelle Regelstörung zu finden.
Das komplexe Ineinandergreifen unterschiedlichster Regelkreissysteme – je nach individuellen Begebenheiten des Gesamtsystems Mensch und pathologischer Störung im Einzelfall – führt somit zu einer ganz individuellen Symptomatik, die es zu beachten gilt, wenn man in kybernetische Kreissysteme korrigierend eingreifen will. Und genau das dürfte die Homöopathie machen!
Die wirksame »Magie« der kleinen Dosen
Anhand der vorgestellten Rezeptordynamik wird zudem erklärbar, warum kleinste Dosen ausreichen, um Regulationsprozesse in Gang zu bringen. In der Tat scheint es so zu sein, dass ein gestörtes Regulationssystem zwar auf starke oder anhaltende Störsignale (s) (um auf den Regelkreis in Abb. 2 zurückzukommen) nicht mehr reagieren kann (aufgrund der Abnahme der spezifischen Rezeptoren (sr)), dafür aber übersensibel auf andere Reize wird (durch die mögliche Zunahme anderer Rezeptoren (ar)). Bereits eine minimale Dosis des Simillimums kann diese Rezeptoren stimulieren und damit die gewünschte Regulation in die Wege leiten.
Beobachtungen, die diese Vorstellung untermauern:
• Ein kranker Mensch reagiert häufig viel sensibler auf bestimmte Reize, die ihm im gesunden Zustand gar nichts ausmachen würden. Das erkrankte System scheint also generell sensibilisiert zu sein. Dies macht sich auch die Schulmedizin therapeutisch zunutze: Paracetamol beispielsweise senkt die Körpertemperatur nur, wenn Fieber besteht. Der körpereigene »Thermostat« ist somit lediglich bei einem anormalen Verhalten des Regelsystems sensibilisiert, auf Paracetamol zu reagieren.
• Im Rahmen von homöopathischen Arzneimittelprüfungen, bei denen gesunden Menschen so lange eine bestimmte Substanz verabreicht wird, bis diese Krankheitssymptome entwickeln, konnte immer wieder beobachtet werden, dass hier – zur Provokation einer Reaktion – die Dosierung oft um ein Vielfaches höher sein muss als bei der Behandlung eines kranken Menschen, der ähnliche Symptome entwickelt. Der Kranke scheint also für das Simillimum empfindlicher zu sein als der Gesunde. Zudem besteht die Gefahr, wie durch die Rezeptordynamik jetzt bekannt ist, dass eine zu große oder zu häufig wiederholte Dosis eines Homöopathikums zur Überstimulation der Rezeptoren führt, die daraufhin ebenfalls mit einem Desensibilisierungsprozess reagieren. Die gängige Vorstellung »viel hilft viel« trifft bei Regelkreisen also nicht zu.
• Da in der Homöopathie sehr häufig giftige Substanzen (Tollkirsche, Fliegenpilz, Arsen, Quecksilber etc.) eingesetzt werden, verstehen sich Minimaldosen von selbst.
| In gestörten komplexen Regelkreissystemen reichen kleinste Mengen eines spezifischen Regulativs aus, um die gewünschte Änderung herbeizuführen. Durch die Potenzierung der Mittel wird die Homöopathie den Ansprüchen eines solchen »Regelkreisregulators« in optimaler Weise gerecht. |
Homöopathie – Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung
Nach dem hier vorgestellten Erklärungsmodell wäre die Homöopathie somit eine Regulationstherapie. Kleinstdosen des Simillimum helfen dem Körper, sich selbst zu regulieren. Dies steckt den Rahmen sowohl der enormen therapeutischen Breite homöopathischer Mittel als auch der Grenzen bei deren Anwendung ab. Wann immer Regelkreise durch ein pathologisches Geschehen gestört werden, was meist der Fall ist, kann ein homöopathisches Mittel wirksam helfen, die Dinge wieder »ins Lot« zu bringen. Dies gilt natürlich nur, solange die Regelkreise regulierbar sind und die Systeme eine Reaktionsfähigkeit besitzen!
In welchen Fällen ist dies nicht mehr oder nicht mehr richtig gewährleistet?
• Wenn die pathologischen Störfaktoren zu stark sind und / oder nicht ausgeschaltet werden (hochvirulente Erreger, massives Trauma etc.). In diesem Fall besitzt das System zwar noch eine Reaktionsfähigkeit, es kann sich aber aufgrund des massiven pathologischen Geschehens nicht mehr selbst regulieren.
• Bei irreversiblen Schäden (Diabetes Typ I, Amputation etc.).
• Bei starken, kaum mehr reversiblen Organdefekten (Arteriosklerose, Schleimhautatrophie etc.).
• Bei genetisch bedingten Erkrankungen (z. B. Erbkrankheiten).
• Wenn das Regulationssystem nicht mehr richtig arbeitet (z. B. bei massiver Immunschwäche oder wenn es medikamentös blockiert wird, z. B. durch Betablocker).
| Mitunter können gut gewählte homöopathische Mittel selbst in diesen scheinbar aussichtslosen Fällen noch eine unterstützende Wirkung zeigen (sofern Teilregulationen noch möglich sind). Eine Heilung, Genesung oder Problemlösung ist jedoch in aller Regel mit Homöopathika allein nicht mehr zu erwarten. Andere Therapieverfahren sind hier vorzuziehen. |
In folgenden Fällen sollte die Homöopathie die erste Wahl sein:
• Bei allen funktionellen Beschwerden.
• Bei akuten und chronischen Erkrankungen (vorausgesetzt, die Regulationsfähigkeit ist gut und die pathologischen Störfaktoren sind nicht zu stark).
• Bei sämtlichen Beschwerden, die der Arzt nicht einordnen kann, sprich: wo er nicht weiß, was dem Patienten fehlt (ca. drei Viertel aller Fälle).
Die Wiederherstellung der körpereigenen Selbstregulation ist sicherlich die eleganteste, wünschenswerteste und nebenwirkungsärmste Methode, einen kranken Mensch gesund werden zu lassen. Andere medizinische Verfahren sollten erst eingesetzt werden, wenn die Homöopathie nicht »greift«.
Unser heutiges Verständnis von den komplexen Regelkreisprozessen verdeutlicht, dass eine Unterdrückung der Regulation (beispielsweise durch Rezeptoren- oder Regulationsblocker wie Betablocker oder Antihistaminika) bzw. eine Unterdrückung der Symptome (wie etwa mit entzündungswidrigen, fiebersenkenden oder schmerzstillenden Medikamenten) hier erst einmal nicht sinnvoll sein kann, um den Körper bei der Selbstregulation und Selbstheilung zu unterstützen. Jeder Verlust der Selbstregulation eines bestimmten Regelkreises führt zum Kompensationsversuch anderer Regelkreise, die dann aber nicht mehr optimal funktionieren können und wiederum von anderen kompensiert werden müssen. Dieser zunehmende Verlust effektiver kybernetischer Kreissysteme dürfte oftmals den Boden für chronische Krankheiten bis hin zu Krebs bereiten. Somit birgt jede Therapie, die körpereigene Regulationsmechanismen außer Kraft setzt oder unterdrückt, Gefahren in sich und sollte vor ihrer Anwendung einer kritischen Nutzen-Schaden-Analyse unterzogen werden.
Weiterhin bietet sich die Homöopathie auch als Präventivmedizin an. Eine durch Homöopathika angestrebte Funktionsoptimierung der Regelkreise erhält die Selbstregulation und damit die Gesundheit und vermeidet das Abgleiten in Mechanismen der Kompensation und Chronifizierung. Als Homöopath kann man dies immer wieder beobachten: Beschwerden, die wiederholt auftraten und schulmedizinisch beispielsweise mit Antibiotika behandelt wurden, werden durch den Einsatz homöopathischer Mittel auf einmal selten.
Und noch eine Beobachtung spricht für die Schlüssigkeit dieses Modells: Bei Kindern schlagen homöopathische Mittel meist schnell an, Krankheiten tauchen oftmals akut auf und verschwinden rasch wieder. Bei älteren Menschen beobachten wir dagegen häufig das Gegenteil: Homöopathische Mittel brauchen oftmals länger, bis sie greifen, Krankheiten ziehen sich in die Länge und werden leicht chronisch. Dieses deutliche Zeichen für eine nachlassende Selbstregulation im Alter dürfte ein weiteres Beispiel für die Richtigkeit des vorgestellten Modells sein.
Homöopathie in Bezug zu anderen konventionellen Therapieverfahren

Abbildung 4
Abbildung 4 zeigt, an welchen Stellen in diesem hier vorgestellten Regelkreissystem die Wirkung anderer medizinischer und pharmakologischer Verfahren einsetzt. Dies soll verdeutlichen, dass die Homöopathie weniger eine Alternative zu anderen schulmedizinischen Verfahren darstellt, sondern vielmehr als ein komplementäres Therapieverfahren gesehen werden sollte.
Selbstverständlich ergänzen sich Diätetik, Hygiene, Prävention (1) und Homöopathie zu einem sinnvollen therapeutischen Ansatz. Das sah schon Samuel Hahnemann so.
Bei bakteriellen Erkrankungen kann die Homöopathie mit Antibiotika (2) kombiniert werden – dies sollte aber nur geschehen, wenn es absolut notwendig ist, also wenn der pathologische Reiz sehr stark (virulenter Erreger, gefährliche Infektion) und / oder das Regulationssystem und damit die körpereigene Abwehr stark geschwächt ist bzw. wenn kein passendes homöopathisches Mittel gefunden wird.
Schwierig wird es bei den Rezeptorantagonisten (z. B. Betablocker gegen Bluthochdruck) (3), da diese das Regelkreissystem blockieren. Homöopathische Mittel können dann nicht mehr richtig wirken. Immunstimulantien (wie Interferone), spezifische Immunsuppression oder Desensibilisierungstherapien sowie Impfungen (4 + 5) wirken dagegen auf ganz ähnliche Weise wie die Homöopathie.
Medikamente, die Symptome unterdrücken (6), wie Analgetika (Schmerzmittel), Bronchodilatatoren (Asthmasprays) oder Spasmolytika (krampflösende Medikamente), können durchaus sinnvoll sein, wenn die Beschwerden sehr stark sind. Auch ist es theoretisch möglich, diese mit homöopathischen Mitteln zu einem effektiven therapeutischen Verfahren zu verbinden, dabei gibt es jedoch zwei Probleme:
a) Durch die Unterdrückung bestimmter Symptome tut sich der homöopathische Behandler, der ja für seine Mittelwahl gerade auf die Krankheitszeichen angewiesen ist, schwerer, das Simillimum zu finden. Er kann aber die Tatsache berücksichtigen, dass durch ein Medikament bestimmte Beschwerden unterdrückt werden. Andere, nicht unterdrückte Symptome können weiterhin den Weg zu einem passenden Homöopathikum weisen.
b) Da diese Medikamente in ihrer biochemischen Wirkung nicht sehr spezifisch sind, stören sie leicht die regulative Wirkung der homöopathischen Mittel.
Bei leichteren Beschwerden sollte daher auf diese Medikamente verzichtet werden. Hier sind Homöopathika in aller Regel ausreichend. Im Falle sehr starker Beschwerden ist an eine Kombinationsbehandlung zu denken, da bei rein medikamentöser Symptomunterdrückung normalerweise keine Selbstregulation angeregt wird. Man beseitigt hier zwar die Beschwerde, wartet aber darauf, dass der Körper sich selber heilt. Schafft dies das System nicht, kommt es erst zur Kompensation und dann zur Chronifizierung. Somit empfiehlt es sich beispielsweise nicht, ein ungefährliches Fieber mit Paracetamol zu senken.
Substitution und unterstützende Maßnahmen (wie herzstärkende Medikamente oder Insulin) (7) können mit Homöopathika wiederum sinnvoll kombiniert werden. Hier wird die Homöopathie jedoch nur so lange eine Wirkung zeigen, wie zumindest noch ein Rest an Regulations- und Reaktionsfähigkeit vorhanden ist.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.