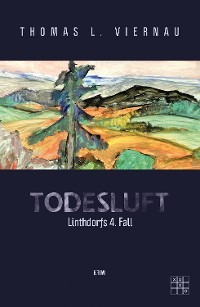Kitabı oku: «Todesluft», sayfa 2
Das verzauberte Schloss

An der Straße, welche von Coburg nach Hildburghausen führt, liegt, eine gute Stunde vor letztgenannter Stadt, das Dorf Eishausen. Links ab von der Chaussee, am fernsten Ende des ziemlich ansehnlichen Dorfes, bemerkt der Reisende ein stattliches, alle anderen Häuser des Ortes überragendes Gebäude. Und wer einmal in der Zeit von 1810 bis 1845 des Weges gekommen ist und im Dorfe sich näher erkundigt hat, der erinnert sich wohl, dass ihm die Bauern gesagt haben, jenes Haus sei das Schloss; darin wohne der » gnädige Herr« der sei sehr reich und sehr wohltätig; aber wer er selbst sei, das wisse kein Mensch, selbst der Herzog nicht.
Man wird vielleicht meinen, der Graf sei Sonderling oder Misanthrop gewesen; aber dem letzteren widersprechen diejenigen, mit denen er in nähere Berührung getreten ist, aufs Bestimmteste, und das erstere lässt sich kaum beweisen. Er soll sich nie trübsinnig oder lebensüberdrüssig gezeigt haben. Bei einer ganz objektiven Auffassungsweise zeigte er doch auch die Seite eines Gefühlsmenschen, und bei seiner heftigen Gemütsart blickte doch immer ein natürliches Wohlwollen durch. Ein köstlicher Humor war ihm eigen.
Der Charakter des Grafen zeigte sich immer als wahrheitsliebend; in den vierzig Jahren seines Einsiedlerlebens hat ihn niemand einer Lüge zeihen können; denn die Verhüllung seines Inkognitos mit dem Namen Vavel de Versay war so deutlich eben nur als Verhüllung gegeben, dass sie nicht eine Lüge genannt werden kann. Auch nach dem Tode der Dame, in der großen Verlegenheit, in welche er durch das Gericht gedrängt wird, verschmäht er das zunächst liegende Auskunftsmittel, die Verstorbene für seine Gemahlin auszugeben. Er sagt bestimmt: »sie ist nicht meine Frau gewesen, ich habe sie nie dafür ausgegeben.«
Friedrich von Bülau: Die Geheimnisvollen im Schlosse zu Eishausen
Eishausen
Sonntag, 30. November 1814
Der Novembertag verdiente den Namen »Tag« eigentlich nicht. Schon am frühen Morgen verdunkelten tiefziehende schwarzgraue Wolken das Licht. Der Graf stand am Fenster, beobachtete mit besorgter Miene die Wolkenwanderungen, holte ein kleines Notizbuch hervor, in das er seine Beobachtungen sorgfältig notierte. Die wissenschaftliche Wetterbeobachtung war eine Leidenschaft des Grafen.
Es war still im Schloss, nichts deutete darauf hin, dass hier mehrere Menschen lebten. Leise entfernte sich der Graf vom Fenster, zog sich in sein Studierzimmer zurück, um dort die neu eingetroffenen Zeitungen zu studieren. Es waren diverse Blätter, die er vor sich ausgebreitet hatte. Deutschsprachige, englische, holländische, aber auch französische Titel wiesen auf eine ungewöhnliche Belesenheit des Grafen hin. Fast zwei Stunden verbrachte er mit dem Zeitungsstudium.
Sichtlich zufrieden trank er die von einem unsichtbaren Geist kredenzte Chocolate. Er liebte den exotischen Geschmack des Kakaos, wusste um die Exklusivität des tiefbraunen Pulvers, das mit frischer Milch aufgeschäumt, den Gaumen kitzelte und den Kreislauf in Schwung brachte.
Ein Blick auf die goldene Taschenuhr, eine Schweizer Meisterarbeit, genügte. Es war Zeit für die morgendliche Audienz. Der Graf stieg bedächtig die Treppe hinauf ins Obergeschoss. Es war recht kühl hier oben. Ihm fröstelte. Dabei hatte er doch Anweisung an seinen Diener gegeben, die Räume gut zu heizen. Ein Blick auf die Kamine erwies sich als irritierend. In jedem Kamin loderte ein prächtiges Feuer.
Ein Windzug fegte durch die Räume. Zwei Fenster waren sperrangelweit geöffnet. Im Fensterrahmen zeichnete sich eine schlanke Frauenfigur ab. Mit ein paar Schritten war der Graf am Fenster, schloss es, lief zum zweiten offenen Fenster, schloss auch dieses.
»Ma chère, es ist für solche Zerstreuungen der falsche Zeitpunkt. Ich weiß, dass Doktor Nothnagel dir viel frische Luft verschrieben hat. Aber du übertreibst. Wir haben November, bald wird es Winter. Denk‘ an deine schwache Gesundheit.«
Die angesprochene Dame wandte sich dem Grafen zu, lächelte kurz und seufzte. Ihr Gesicht war fein gezeichnet, große blaue Augen schauten den Grafen direkt an. Die hohen Wangenknochen und die an antike Vorbilder erinnernde Nase gaben ihr ein edles Aussehen. Ihre Haut war blass, fast durchscheinend, ihre lockige Haarpracht unter einem feinen Seidenschal verborgen, den sie sich leger übergezogen hatte.
Sie antwortete auf Französisch: »Mais oui, je connais. Ma santé, chaque-foi, ma santé. C’est un drôle …«
Der Graf ließ sich nichts anmerken. Er kommunizierte auch weiter auf Deutsch mit ihr, obwohl es ihm ein Leichtes war, das Gespräch auf Französisch fortzusetzen.
»Ma chère, du weißt sicherlich, dass das Französische verräterisch ist. Ich möchte dich daran erinnern, was wir ausgemacht hatten. Die Wände haben Ohren, wir wissen nicht, wem wir trauen können und wem nicht.«
Im akzentfreien Deutsch antwortete sie ihm.
»Glaubst du wirklich, dass hier an diesem Ort Spitzel auftauchen sollten? Wir sind durch ganz Europa gereist, immer mit der Angst, verraten zu werden. Endlich haben wir einen abgeschiedenen Ort gefunden, der bisher von noch keinem Agenten ausfindig gemacht wurde. Endlich können wir durchatmen. Ich bin es leid, dauernd Versteck zu spielen. Das Schicksal kann man nicht auf Dauer überlisten.«
Der Graf nickte.
Natürlich, Eishausen war ein wirklich abgeschiedener Ort. Das kleine Schloss, eher ein etwas zu groß geratenes Gutshaus, war der ideale Rückzugsort. Außerdem hatte er die Zusicherung des Herzogs, sein Incognito zu wahren und keinerlei Fragen zu stellen, was seine Herkunft anging.
Auch die Dorfbewohner waren instruiert. Sein getreuer Diener hatte dafür gesorgt, dass die Dorfleute einen großen Bogen um das Schloss machten. Mit kleinen Geldspenden versicherte der Graf sich der Loyalität der Dörfler. Eigentlich war alles perfekt geregelt. Dennoch, ein Argwohn blieb.
Zu oft hatten sie schon ihre Bleibe wechseln müssen. Immer tauchten seltsame und sich verdächtig benehmende Männer auf, die ein zu großes Interesse an seiner Person zeigten.
Im württembergischen Ingelfingen waren sie viel zu nah an der französischen Grenze. Immer wieder tauchten in der Apotheke, in der sie Unterkunft bezogen hatten, französische Offiziere auf, die sich harmlos nach den Gästen des Apothekers erkundigten.
Auch in Gotha und Weimar tauchten sie auf. Erst im kleinen Hildburghausen schien er sicher zu sein. Wahrscheinlich rechneten seine Verfolger nicht damit, dass er sich in einen solch kleinen Zwergstaat zurückzog. Das Herzogtum Hildburghausen war auf der Landkarte nur ein winziger Fleck.
Es war jetzt knapp sieben Jahre her, dass sie ihren Fuß auf Hildburghäuser Boden setzten. Vorausgegangen war eine Irrfahrt durch diverse Thüringer Herzogtümer. Er hatte stets das Gefühl, dass die Herzöge einen solch brisanten Gast ungern bei sich aufnehmen wollten, hatte in Gotha bei Hofe vorgesprochen und auch in Weimar, jedes Mal wurde ihm bedeutet, dass es unmöglich wäre, ihm sein Incognito zu belassen.
Die Kabinettsmitglieder waren sich einig, schließlich wollte man es sich ja nicht mit Napoleon verderben. Die Thüringer Kleinstaaten waren allesamt mehr oder weniger freiwillig dem von Napoleon gegründeten Rheinbund beigetreten.
Seine letzte Hoffnung war der Meininger Hof, speziell die Herzogin Luise-Eleonore, deren Großmut allgemein bekannt war. Über einen guten Bekannten, den Freiherrn von Könitz, versuchte der Graf von der Herzogin eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Doch auch sie lehnte leider sein Ansinnen ab.
Die Verzweiflung war groß. Wohin konnte er sich noch wenden? Konnte er seiner Begleiterin weitere Strapazen zumuten? Was, wenn bereits napoleonische Geheimagenten ihm auf den Fersen waren?
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwand das Paar aus dem Herzogtum Meiningen ins benachbarte Herzogtum Hildburghausen. Ohne behelligt zu werden erreichte die Kutsche die Residenzstadt.
Das Paar quartierte sich vorerst im »Englischen Hof« ein, dem besten Haus des kleinen Herzogtums. Vollkommen erschöpft verbachten sie die ersten Wochen in völliger Zurückgezogenheit. Nur selten spazierten sie für kurze Zeit über den Markt, immer auf der Hut vor aufdringlichen Agenten.
Auch Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen war vor einem halben Jahr als letzter der Thüringer Herrscher dem Rheinbund beigetreten und hatte so die eigentliche Souveränität seines Landes an die Franzosen abgegeben.
Aber Friedrichs Gattin, Herzogin Charlotte, war eine Schwester der preußischen Königin Luise. Preußen war seit der Niederlage von Jena und Auerstedt keine wirkliche Schutzmacht mehr, aber der Herzog versicherte sich mittels seiner Gattin des Wohlwollens des preußischen Hofes und gewährte in einem Akt ungewöhnlicher Courage dem geheimnisvollen Paar in seinem Land ein unbefristetes Aufenthaltsrecht.
Nach einem halben Jahr zog das geheimnisvolle Paar ins herzogliche Gästehaus am Markt um. Der Aufenthalt im »Englischen Hof« erschien dem Grafen zu riskant. Zu viele Gäste verkehrten in dem Hotel und es war schwierig, unerkannt zu bleiben.
Aber auch das Gästehaus bot dem besorgten Grafen zu wenig Schutz. Ein Feueralarm trug dazu bei, dass sich das Paar nicht mehr sicher fühlte. Später stellte sich zwar heraus, dass es sich um einen falschen Alarm gehandelt hatte, aber der Graf bestand darauf, so schnell wie möglich das Gästehaus zu verlassen.
Über einen Mittelsmann mietete der Graf das Radefeldsche Haus in der Hildburghäuser Neustadt an. Hier fühlte sich das Paar endlich sicher.
Innerhalb weniger Monate verwandelte der Graf sein neues Domizil in eine kleine Festung. Kein Mensch hatte Zutritt. Außer seinem getreuen Diener, der gleichzeitig auch als Kutscher und Vertrauensmann für ihn unerlässlich war, gab es noch eine Köchin und eine Botengängerin, die sich um Einkäufe und die Post kümmerten.
Seine Begleiterin, die in Hildburghausen nur die Gräfin genannt wurde, bekam niemand zu Gesicht. Man munkelte, dass sie krank sei. Einige Eingeweihte wollten sie am Fenster gesehen haben, mit einem Schal, so dass es unmöglich war, ihr Gesicht zu sehen. Auf alle Fälle war das geheimnisvolle Paar Stadtgespräch. Dem Grafen war dies nicht verborgen geblieben.
Er drängte darauf, ein Domizil, weitab der Residenz zu erwerben. Über einen herzoglichen Mittelsmann erwarb der Graf im fünf Meilen von Hildburghausen entfernten Dorfe Eishausen ein kleines Schloss. Das Eishausener Anwesen gehörte zum Besitz des Herzogs und war für den Grafen ein ideales Versteck.
Kostspieliges Mobiliar wurde auf Anweisung des Grafen herbeigeschafft, auch auf die Garderobe legte das geheimnisvolle Paar großen Wert. Stets war der Graf elegant gekleidet. Selbst der Diener fiel mit seiner silberbesetzten Livree auf. Die unsichtbare Mitbewohnerin verfügte über einen erstaunlichen Kleidervorrat, allesamt feinste Pariser Mode.
Jeden Tag pünktlich um zehn Uhr fuhr der silberbetresste Diener die Kutsche vor, die von zwei pechschwarzen Rappen gezogen wurde. Die Kutsche selbst war ebenfalls in einem dunklen Braunton gestrichen, die Fenster mit kleinen Tüllgardinen verhangen, so dass es unmöglich war, einen Blick ins Innere zu werfen.
Der Graf begleitete seine Dame, öffnete ihr die Tür, half ihr beim Einsteigen, sorgsam darauf achtend, dass der Schal nicht verrutschte, der das Antlitz der Dame verhüllte. Endlich stieg er selber zu und gab dem Diener Befehl loszufahren. Der Weg war immer derselbe. Man fuhr Richtung Rodach, einem kleinen Ort unmittelbar an der Grenze des Herzogtums Hildburghausen zum Herzogtum Coburg. Rodach war bereits coburgisch. Kurz vor Erreichen der Stadtgrenze ließ der Graf jedoch stets wenden.
Dann ging es wieder zurück zum Schloss Eishausen, das seine schlichte Profanität gegen einen geheimnisvollen Nimbus eingetauscht hatte. Die Leute sprachen auch vom verzauberten Schloss und nannten dessen Bewohner aufgrund ihrer Zurückgezogenheit den Dunkelgrafen und die Dunkelgräfin.
Das namenlose Paar stachelte die Neugier der Leute an. Die Postbotin wurde angehalten, einen Blick auf die Briefadressen zu werfen, um so zu erfahren, wer in dem geheimnisvollen Schloss lebe. Die meisten Briefe waren an einen Baron Vavel de Verzay gerichtet. Die Absender kamen aus allen Teilen Europas, aus Frankreich, Holland, der Schweiz, Kurland, Livland, Dänemark, den diversen deutschen Fürstentümern und sogar aus England.
Ob der Name Vavel de Verzay, mit dem keiner etwas anfangen konnte, nun der wirkliche Name des seltsamen Grafen war oder nur ein Deckname, um so von der wahren Identität abzulenken, war beim besten Willen nicht zu eruieren. Selbst Nachfragen bei Hofe in Hildburghausen erbrachten keine Ergebnisse. Herzog Friedrich hatte das Incognito seines geheimnisvollen Gastes akzeptiert und verwies darauf.
Am Nachmittag widmete sich der Graf der Lektüre der neuesten Zeitungen, schrieb zahlreiche Briefe, ja, er schien mit der ganzen Welt zu korrespondieren. Pünktlich um Vier Uhr kredenzte der Diener den Nachmittagstee. Die Gräfin erschien dann in einem ihrer schönsten Kleider, nahm dem Grafen gegenüber Platz und unterhielt sich mit ihm über die neuesten Entwicklungen.
Sie war sehr interessiert am Weltgeschehen, lauschte dem Grafen, wenn er über neue Ereignisse berichtete, speziell zu den Feldzügen Napoleons hatte sie ein fast brennendes Interesse entwickelt, fragte nach und sog jedes kleine Detail auf, um daraufhin noch mehr Fragen zu stellen. Geduldig antwortete der Graf soweit es ihm möglich war. Spekulationen waren nicht seine Sache, er hielt sich an die Fakten. Und die Faktenlage war meist recht dürftig.
Nach dem Tee begaben sich die beiden zu einem kleinen Spaziergang durch den mit hohen Hecken vor den Blicken Neugieriger geschützten Garten, der allerdings im Spätherbst wenig Erbauung bot. Das Laub raschelte unter ihren Füßen, die Gräfin hatte einen Schirm gespannt, um den unangenehmen Nieselregen abzufangen, doch der Wind trieb die feinen Wassertröpfchen fast waagerecht direkt ins Gesicht der Dame.
Eine halbe Stunde hielt das Paar tapfer aus, bevor es sich wieder zurück ins Schloss begab. Der Tagesablauf war exakt geregelt, egal was für Wetter war.
Der Graf war ein Mann von festen Prinzipien. Seine Disziplin war bewundernswert. Bedachte man, dass die selbstgewählte Abgeschiedenheit eher kontraproduktiv wirkte, war das Arbeitspensum, was er sich täglich auferlegt hatte, erstaunlich. Noch erstaunlicher war seine vollkommene Hingabe zu der Gräfin, deren Wünsche ihm Befehl waren.
Im Dorf munkelte man, es sei gar nicht seine Ehefrau. Einige wollten wissen, dass es sich um seine jüngere Schwester handele, andere waren der festen Meinung, dass es eine jung verwitwete Anverwandte des Grafen sei. Ein paar Besserwisser glaubten in ihr eine verstoßene Prinzessin zu erkennen. Die edlen Züge, das sorgfältig gewahrte Geheimnis ihres wirklichen Aussehens und die aufwändige Garderobe sprachen für diese kühne These. Aber was für eine Prinzessin sollte es sein?
Durch die napoleonischen Feldzüge waren viele Königshäuser vakant geworden. Exilierte Prinzessinnen gab es plötzlich überall. Ein Hofrat des Hildburghäuser Herzogs streute die Nachricht, dass die geheimnisvolle Gräfin eine Tochter des letzten französischen Königs sein sollte. Durch die Revolutionswirren wäre sie wohl in große Gefahr geraten, ebenso wie ihre Eltern guillotiniert zu werden, aber dank der Intervention einiger großherziger Männer wäre ihr die Flucht gelungen.
Aus dem benachbarten Herzogtum Weimar kam die Kunde, dass die Gräfin eine illegitime Tochter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. und seiner Maitresse, der Gräfin Lichtenau sei und ihre Jugend in Holland verbracht hätte. Auch hierfür gebe es allerdings keinerlei Beweise.
Ein herzoglicher Geheimrat, der über gute Beziehungen zum Wiener Hofe verfügte, erkannte in der Gräfin die Tochter des Habsburger Kaisers Joseph II., der wohl eine Affaire mit der Hofdame Wilhelmine von Botta hatte und deren Folge eben eine Tochter sei, die außerhalb Österreichs bei Verwandten der Botta in Norddeutschland aufgewachsen wäre.
Der Gothaer Hof erklärte, dass es eine geschiedene Generalsgattin sei, immerhin habe sie ja einige Zeit in Gotha zugebracht und es wären zahlreiche Briefe eines französischen Generals namens Berthelmy an sie adressiert gewesen. Die Empfängerin sei eine Agnès Berthelmy, eben die geheimnisvolle Begleiterin des Incognito reisenden Grafen.
Spekulationen über das geheimnisvolle Paar gab es also zur Genüge. Dem Grafen kamen immer wieder Gerüchte zu Ohren. Doch er schwieg zu allen Vermutungen, ließ sich mit keinem Wort aus der Reserve locken und zog sich immer mehr zurück. Er mied den Kontakt zur hiesigen Bevölkerung, machte sich aber durch zahlreiche wohltätige Spenden einen guten Leumund, so dass die Leute stets mit einer gewissen Ehrfurcht von ihm sprachen. Viele sprachen vom »Gnädigen Herrn«, nur wenige nannten ihn den »Dunkelgrafen«, ein Wort, das sich entschieden unangenehmer anhörte und Spekulationen immer neue Nahrung zutrieb.
Eine Begegnung bei Mohnkuchen
Bessre Herz und Nerven! Geh nach Liebenstein!
Spruch auf einem Liebensteiner Notgeldschein von 1921
I
Bad Liebenstein
Sonntag, 6. Mai 2007

Die Wochenenden waren frei. Linthdorf war ganz überrascht, plötzlich so viel Freizeit zu haben. Der Kurbetrieb hatte ihn die ersten Tage ziemlich ausgefüllt. Er hatte zu tun, die jeweiligen Örtlichkeiten zu finden, zwischendurch sich immer wieder rechtzeitig im großen Speisesaal zu den Mahlzeiten einzufinden und abends den zahlreichen Veranstaltungen im Foyer zu entgehen.
Es war alles ein bisschen zu viel des Guten. Linthdorf war so viel Regelmäßigkeit nicht gewöhnt.
Gestern hatte er eine erste Erkundungstour durch das Städtchen gemacht. Eigentlich wollte er ja zu der alten Burgruine hinauf. Aber davon rieten ihm die Kurärzte noch ab. Später, wenn er wieder fit genug sei, könne er gern den Liebenstein erobern, aber im Augenblick wären ein paar geruhsame Spaziergänge im Kurpark doch wohl förderlicher.
Linthdorf spürte auch bald, dass sie recht hatten. Mit seiner Kondition war es nicht zum Besten bestellt, der Kreislauf war anfällig. Nach einer Viertelstunde unstetem Herumtapsens merkte er, dass er weiche Knie bekam und Schweißperlen im Gesicht kleine Bäche bildeten.
Erschöpft suchte er ein kleines Café auf. Reger Betrieb herrschte hier. Die kleinen runden Tische waren fast alle besetzt. Nur ein einziger Stuhl an dem kleinen Ecktisch neben dem Tresen war noch frei. Mühsam schleppte sich der Riese dahin.
Am Tisch saß bereits jemand. Vor sich ein Kännchen Kaffee und einen kleinen Kuchenteller. Ein Mann undefinierbaren Alters, wettergegerbt, durchtrainiert, eher einem gerade in die Zivilisation entlassenen Indianerkrieger denn einem friedfertigen Thüringer ähnlich, verbarg sich hinter einer Zeitung.
Linthdorfs vorsichtige Frage, ob der Platz noch frei sei, wurde mit einem unwilligen Knurren beantwortet. Etwas ratlos, ob das Knurren nun eine Zustimmung oder doch eher ablehnenden Charakter habe, verharrte er für ein paar Sekunden vor dem Tischchen.
Wahrscheinlich hatte er dem Indianer das Licht genommen. Langsam senkte sich die Zeitung und ein dunkler Bass ertönte.
»Setzen Sie sich doch! Ich beiße nicht.«
Wortlos ließ sich Linthdorf auf dem freien Platz nieder. Eine junge Kellnerin kam auf ihn zugeeilt.
»Sie haben schon etwas ausgesucht? Unserr Kuchenangebot ist vorrn am Buffet ausgestellt. Heute haben wirr wiederr unserren Mohnkuchen im Angebot«, dabei strahlte sie Linthdorf an, als ob sie ihm ein Staatsgeheimnis anvertraut hätte.
Irritiert lauschte Linthdorf dem Klang der Sprache. Seltsamer Dialekt war das hier. Der Buchstabe R wurde auf der Zungenspitze gerollt, so dass fast jedes Wort mit R wie eine heilige Vokabel klang.
»Möchten Sie auch ein Heißgetrränk? Vielleicht ein Kaffee? Kännchen? Grroße Tasse? Oderr einen Geschäumten?«
Automatisch nickte Linthdorf. Ja, ja, sie solle einfach diesen Mohnkuchen und dazu ein Kännchen …
Sein Gegenüber lupfte die Zeitung, setzte ein diabolisches Grinsen auf und schnarrte im selben Singsang wie die Kellnerin: »Au, derr Mohnkuchen ist genial.«
Linthdorf nickte.
»Sie sind wohl neu hierr?«
»Auf Kur.«
»Au, was Schlimmes?«
»Nein, nein, alles wieder im Lot. Das Herz …«
»Ja, da sind die Leute drrauf spezialisiert, gerrade mit dem Herrz …, da ist nicht mit zu spaßen. Aberr unserre gute Luft, die macht Tote wiederr lebendig. Gell?«
Linthdorf schaute dem Indianer unvermittelt ins Gesicht.
»Was heißt denn Gell?«
Wieder erschien das diabolische Grinsen im Gesicht des Indianers. »Au, das heißt eigentlich goarr nix. Das hängen wir zur Bekrräftigung einfach hintenan.«
»Ach so«, Linthdorf war froh, dass sein Gegenüber die eigenartige Frage nicht als Beleidigung empfand. Indianer, selbst zivilisierte, kennen eigentlich keinen Humor.
»Hab ich grrade selberr gegessen. Schmeckt echt irre. Kuchen backen können die hier.«
Linthdorf sah interessiert auf die Zeitung des Indianers. Es war eine Thüringer Lokalzeitung: »Rennsteig-Nachrichten – Unabhängige Zeitung für Südthüringen«.
In dicken Blockbuchstaben war auf der Titelseite zu lesen: »Einbruchserie – Wieder entkamen die Täter ungeschoren!«
»Die Idylle trügt. Ist wohl doch nicht alles so friedfertig hier«, Linthdorf versuchte vorsichtig ein Gespräch jenseits des Mohnkuchens aufzubauen.
Der Indianer sprang an.
»Jooaah, das geht schon die ganzen Monate. Seit letztem Herrrbst! Angefangen hat es mit dem spektakulären Einbrruch im Weimarrerr Rrresidenzschloss. Prrrofis! Eindeutig Prrrofis!«
»Sie kennen sich aus?«
Der Indianer grinste wieder.
»Kann man so sagen. Ich habe den Arrtikel ja geschrrieben.«
»Oh, Sie sind Journalist?«
»Jooaah, bin ich. Tom Hainkel, Mein Kürrzel ist Hai, falls Sie mal in den »Rennsteig-Nachrichten« blättern sollten.«
»Angenehm, Linthdorf, Theo Linthdorf. Berlin.«
»Oooh, ein Berrlinerr! Hoab da studiert, in den Achtzigerrn.«
»Ach so.«
»Allerrdings koine Journalistik, nee, oigentlich Ökonomie.«
»Ach so, und wieso sind Sie bei der Zeitung gelandet?«
»Blonker Zufall, nach derr Wende woar oalles in Auflösung, unsere Wirrtschaft zuallererrst. Joaah, und doa hoab ich die Chance errgrriffen bei einerr Zeitungsneugrründung mitzumachen. Zuerrst hoab ich den Wirrtschaftsteil gemacht, dann woar das aberr zu langweilig. Ich muß raus, was vorr Ort errleben, brrauche Luft und Naturr. Bin dann umgesattelt in den Lokalteil. Viel interressanterr! Kommst mit Leuten z‘sammen. Bist viel unterrwegs. Ganz mein Ding.«
Linthdorf sah sich Hainkel etwas skeptisch an.
»Für einen Journalisten sind Sie aber ganz schön durchtrainiert. So sehen bei uns die Jungs von den Spezialtruppen aus.«
Hainkel entblößte zwei Reihen unnatürlich weißer Zähne, exakt ausgerichtet, keine Unregelmäßigkeit aufweisend.
»In meinerr Frreizeit mache ich ein bisschen Sporrt. Trriathlon.«
Linthdorf war beeindruckt. Triathlon hatte für ihn etwas Masochistisches. Rennen, Radfahren und Schwimmen – jedes für sich war schon Qual genug, aber alle drei Teilsportarten hintereinander in einem kräftezehrenden Wettbewerb…, für ihn emotional nicht nachvollziehbar.
Hainkel musste ungefähr in seinem Alter sein, wenn er in den Achtzigern studiert hatte. Er überlegte, wann er sich das letzte Mal sportlich betätigt hatte. Dem Dienstsport konnte er nicht viel abgewinnen.
Mit Voßwinkel hatte er früher mal Tischtennis gespielt. Überhaupt, Sport ist Mord. Hatte das nicht mal der alte Winston Churchill gesagt? Und der war ja uralt geworden. In seinem Job musste er dauernd auf den Beinen sein und hatte Stress genug. Deshalb war er ja auch hier gelandet.
»Nehmen Sie auch an Wettkämpfen teil?«
»Kloar, allerdings im Seniorrenteam. Bei den Jungschen kann ich nicht mithalten. Ist trrotzdem noch anstrrengend genug. Trrainier gerroad für die Thürringerr Landesmeisterrschaften. Uff, jeden Tag zehn Kilometerr Laufen, eine Stunde Rrad und am Wochenende Schwimmen.«
Wenn Hainkel dieses Programm sommers wie winters durchzog, war es nicht verwunderlich, dass er wie Sitting Bulls Enkel aussah.
Linthdorf musste lächeln. Ein Mann der Feder erwies sich als Iron Man. Wie ging das zusammen?
»Und in Ihrem Job können Sie Fitness ja auch gebrauchen?«
»Oigentlich nicht so sehrr. Aberr, man hat durrch den Sporrt den Kopf frrei. Das hilft schon. Geroade jetzt, bei den Einbrrüchen.«
»Ich dachte, hier in dem paradiesischen Ländchen gibt es keine Kriminalität, alles macht einen friedfertigen, harmonischen Eindruck.«
Hainkel winkte ab. »Doas ist wie im norrmalen Leben. Das Böse ist immer und überrall! Oder glauben Sie, dass es hierr keinen Neid, keine Habgierr oder Eifersucht gibt. Thürringerr sind bloß Menschen, auch wenn sie guten Kuchen backen können. Woas glauben Sie, wieviel Unrecht und Bösartigkeit ich schon erlebt habe. Die Zeitungen sind voll damit!«
Linthdorf konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, aus Thüringen mal eine negative Schlagzeile gelesen zu haben. Entweder verstanden es die Landesbehörden, geschickt von ihren Fällen abzulenken oder diese nicht an die große Glocke zu hängen, oder, was natürlich auch möglich war, es gab einfach keine spektakulären Fälle.
Hainkel deutete auf seinen Artikel in den »Rennsteig-Nachrichten«.
»Das ist nur die Spitze eines Eisberrgs. Ich bin schon seit Monaten an dieser Einbrruchsserie drran. Thüringen ist ein arrmes Land, obwohl wirr so eine rreiche Geschichte hoaben. Soviele Rresidenzen auf kleinem Rraum gibt’s in goanz Deutschland nicht mehr. Jederr Thürringische Herrzog, Grraf oderr Fürrst baute sich ein Schloss. Die Ländle waren winzig. Luxemburg wäre hierr in Thürringen schon eine Supermacht gewesen. Manche hatten geroad mal die Fläche eines hoalben Landkreises. Und jetzt ham wirr das Errbe der Kleinstaaten. Es gibt eine landeseigene Stiftung, Thüringerr Schlösser und Gärten, aberr die hat nicht genug Mittel, um die ganzen Burrgen, Schlösserr und Parrks zu betreuen. Die Sicherrungsmaßnahmen sind nur dürftig. Unmengen von Schätzen liegen da fast frrei und ungesicherrt herrum. Für Prrofis kein Prroblem… Der Schwarrzmarrkt für Kunst ist in den letzten Jahren durrch die Decke gegangen. Speziell seit wirr frreie Grenzen haben. Das ist jetzt interrnational geworden. Sie können sich goar nicht vorstellen, was fürr Unsummen von Gelderrn da rrumschwirren. Liebhoaberr geben fünf- und sechsstellige Summen für Orriginale aus. Die Thürringerr Schlösserr sind die rreinsten Schatzkammerrn.«
Linthdorf lauschte interessiert. Was Hainkel da in seinem schnarrenden Dialekt berichtete, kam ihm sehr vertraut vor. Er musste an den Arkadierverein mit dem umtriebigen Harry Treibel denken und natürlich an den intriganten Staatssekretär a.D., an Eugen Wigbert Kupfer. Wahrscheinlich gab es solche Gestalten bundesweit, ach, weltweit.
Er nickte, berichtete dem staunenden Hainkel von seinem Job als Beamter der Brandenburger Kripo und das ihm die Sachlage bekannt vorkam.
»Endlich mal ein Spezialist. Wissen Sie, unserre Polizei, also nichts gegen die Jungs, aber die sind chronisch unterrbesetzt und überrfordert. Meist haben die viel zu wenig Zeit für so etwas wie Einbruch und Diebstahl. Zumal, wenn sie es mit Prrofis zu tun haben. Die Chancen, die Täter zu erwischen, sind gering. Die Gegenseite ist zu gut organisiert. Ehe die Errmittlungen überrhaupt angefangen haben, sind die Täterr schon längst mit ihrerr Beute außerr Landes.«
Linthdorf nickte. Natürlich, straff organisierte Einbrecherbanden, die genau wussten, was sie wo erbeuten konnten, hatten ein gut organisiertes Netzwerk an Informanten aufgebaut. Dass zu zerschlagen, war eine Sisyphusarbeit. Jedes Mal, wenn es gelang, ein solches Netzwerk auszuheben, wuchs an anderer Stelle ein neues nach.
Inzwischen waren der Kaffee und der Mohnkuchen gebracht worden. Ungläubig schaute Linthdorf auf seinen Teller. Der Mohnkuchen war ein bestimmt zehn Zentimeter hohes Kunstwerk, groß wie ein halber Backstein, mit einer goldgelb glänzenden Schicht überzogen, darunter die hellblau-schwarz gesprenkelte Mohnmasse, in der riesige Rosinen leuchteten wie kleine Edelsteine. Neben dem Kuchenstück türmte sich ein gewaltiger Klecks Schlagsahne.
Hainkel sah Linthdorfs skeptischen Blick. »Wie gesoagt, derr Mohnkuchen ist echt irre hier.«
Vorsichtig schaufelte Linthdorf eine Ecke des Mohnkuchens mit seiner Kuchengabel in seinen Mund. Und wirklich, das Geschmackserlebnis war überwältigend. Mohnkuchen wie er ihn noch nie zuvor gegessen hatte. Andächtig vernichtete er das barocke Kunstwerk auf seinem Teller.
Burg Liebenstein, einst Ritterlehn,
Vergänglich ist auf Erden alles,
Du sahst Geschlechter kommen, geh’n,
Den Wohlstand blüh’n, und nun den Dalles*
*Dalles – alte Bezeichnung für Armut, Not, Geldverlegenheit
Spruch auf einem Liebensteiner Notgeldschein von 1921

II
Sanatorium für Herzleiden in Bad Liebenstein
Sonntagabend, 6. Mai 2007
Der Cafébesuch und die Thüringer Luft hatten sich positiv auf Linthdorfs Lebensgeister ausgewirkt. Satt und zufrieden war er am späten Nachmittag wieder zurück in sein Zimmer im Sanatorium gewandert.
Möglicherweise war auch die Begegnung mit dem Thüringer Journalisten daran schuld, dass er sich wieder besser fühlte. Tom Hainkel hatte ihm mit Verweis auf den Artikel von der Titelseite des Thüringer Lokalblattes eine Webseite genannt, die von ihm betrieben wurde. Die Einbruchsserie wäre da lückenlos dokumentiert, ebenfalls die Aktivitäten der heimischen Behörden, die allerdings wenig Brauchbares ermittelt hatten.