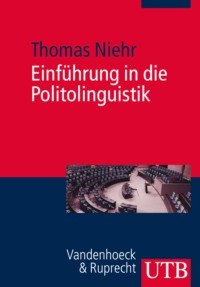Kitabı oku: «Einführung in die Politolinguistik», sayfa 2
2.4.1 Frühe Studien zur Sprache der NS-Zeit
Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte die linguistische Beschäftigung mit der Sprache des Nationalsozialismus ein. Man hatte die unheilvollen Wirkungen von Sprache gerade am eigenen Leib erfahren müssen und war deshalb sehr daran interessiert, die Eigenheiten der sogenannten NS-Sprache zu erforschen. Insofern kann man diese Phase der Politolinguistik mit Burkhardt (2003a: 132) als „rückwärtsgewandt“ bezeichnen.
Sie ist insofern prekär, als auch nicht jederzeit außer Zweifel stand, was ihr Untersuchungsobjekt sein sollte. Dies lässt sich an unterschiedlichen Bezeichnungen ablesen. Teilweise begegnet uns die Formel „Sprache des Nationalsozialismus“, teilweise ist von „Sprache im Nationalsozialismus“ bzw. „Faschismus“ die Rede.
Möchte man hier eine plausible Unterscheidung treffen, so könnte man mit von Polenz (1999: 547) den Sprachgebrauch der NSDAP seit 1920 mit dem Etikett „Sprache des Nationalsozialismus“ belegen. Die NSDAP-Sprache mit verschiedenen Traditionen politischer Sprache, die dann von 1933 bis 1945 vorherrschend wurde, ließe sich hingegen mit „Sprache im Nationalsozialismus“ angemessen beschreiben. Dabei muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass politischer Sprachgebrauch eben nicht nur die Sprache der Politiker umfasst, sondern auch das Sprachverhalten der Massen, die ja politische Strömungen mittragen:
Selten kommt dagegen in den Blick, daß diese „manipulierten“ Subjekte in großen Teilen der Geschichte ja keineswegs in die Zustimmung, in, wie es dann hieß, die „Gefolgschaft“ gezwungen wurden. Es wird nur allzu leicht vergessen, daß „die Macht“ der Nationalsozialisten ihnen in einem demokratischen Entscheidungsprozeß übertragen wurde. Es wird übersehen, daß mehrheitlich der Nationalsozialismus in Deutschland – und in Österreich – konsensuell war. (Ehlich 1998: 291 f.)
Selbstverständlich gab es während der Naziherrschaft keine wie auch immer geartete öffentliche Sprachanalyse. Eine Sprachkritik wie sie in der Zwischenkriegszeit beispielsweise von Bertolt Brecht oder Karl Kraus geübt wurde, war lebensgefährlich und damit nahezu unmöglich geworden. So erscheint Karl Kraus‘ sprachkritische Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich erst lange nach Ende der Naziherrschaft im Jahre 1952. Kraus (1952: 9) beginnt diese Schrift mit dem Satz „Mir fällt zu Hitler nichts ein“, um dann aber umso detaillierter die Sprache im Nationalsozialismus zu sezieren, etwa indem er das sprachliche Unvermögen von Parolen-Schrei(b)ern ironisierend aufs Korn nimmt:
Hätte ich Mut, würde ich mutmaßen, daß eine Prüfung auf Sprachgefühl und grammatikalisches Wissen der Leute, die durch die Forderungen „Deutschland erwache!“ und „Juda verrecke!“ zu Macht und Vermögen gekommen sind, schon bei der Frage nach eben der Konstruktion jener auf Schwierigkeiten stößt [oder stoßt, wie sie grundsätzlich schreiben]. Sie wissen bestimmt nicht, daß da ein Komma hineingehört, weil die jeweils genannte Nation, die doch angeherrscht werden soll, sonst nicht die zweite, sondern nur die dritte Person vorstellt und die verlangte Tätigkeit: erwachen oder verrecken, nicht die Befehlsform, sondern bloß die Wunschform annimmt, die ja namentlich im Fall Juda nicht angebracht wäre. […] Das Ausrufezeichen sichert noch nicht den Befehl, sondern könnte eine Verstärkung des Wunsches sein. Freilich muß man in dem Zitat, das Deutschland und Juda betrifft, den Fehler übernehmen, der insofern nicht uneben ist, als so brüske Forderung durch Sorgfalt des Ausdrucks abgeschwächt würde. Schließlich standen die Cäsaren immer über der Grammatik, und besser autarkisch nicht deutsch können, als Fremdwörter gebrauchen, von denen man doch nie wissen kann, was sie bedeuten. (Ebd.: 112)
Im Gegensatz zu einer solchen Sprachkritik wurden jedoch puristische Bestrebungen öffentlich propagiert – hier ist etwa an den Allgemeinen Deutschen Sprachverein zu denken, der sich als „SA unserer Muttersprache“ verstand und rassistischen Fremdwortpurismus betrieb. Dies allerdings auch nur so lange, bis ein Vereinsmitglied feststellte, dass das Ehrenmitglied des Vereins, Eduard Engel, ebenfalls ein radikaler Fremdwortpurist, ein „recht rühriger Jude“ sei (vgl. v. Polenz 1999: 280). Dies führte zu einer Vereinskrise, die schließlich – auch weil die Nazis aus naheliegenden Gründen vom Fremdwortpurismus nichts hielten – zum plötzlichen Ende der fremdwortkritischen Bestrebungen dieses Vereins führten, zumindest auf der Ebene des Gesamtvereins. Die einzelnen Zweigvereine spielten weiterhin eine unrühmliche Rolle und führten „Entwelschungs-Kampagnen“ u.Ä. durch (vgl. Niehr 2009, v. Polenz 1999: 283).
Eine Besonderheit der Analyse politischer Sprache während des Zweiten Weltkriegs stellen die Tagebücher des Romanisten Victor Klemperer dar. Er wurde in der Nazizeit mit Berufsverbot belegt und durfte schließlich nicht einmal mehr Bibliotheken nutzen. Er hat den öffentlichen wie privaten Sprachgebrauch seiner Zeit scharf beobachtet und analysiert. Seine Tagebücher sind deshalb eine Ausnahme, weil Klemperer als Philologe weiß, dass Situationen und Handlungszusammenhänge wichtig sind, um eine nachvollziehbare Sprachanalyse zu bewerkstelligen. Seine Sprachbeobachtungen zur Sprache im Nationalsozialismus hat er in seine Tagebücher integriert. Diese überarbeiteten und erweiterten Hinweise wurden 1946 unter dem Titel LTI (Lingua Tertii Imperii) veröffentlicht. Mit einigen wenigen Beispielen kann man die Scharfsinnigkeit der Sprachanalysen Klemperers verdeutlichen:
Ich wünsche nicht und glaube auch nicht, daß das scheußliche Wort [Entnazifizierung, Th.N.] ein dauerndes Leben behält; es wird versinken und nur noch ein geschichtliches Dasein führen, sobald seine Gegenwartspflicht erfüllt ist. Der Zweite Weltkrieg hat uns mehrfach diesen Vorgang gezeigt, wie ein eben noch überlebendiger und scheinbar zu nie mehr ausrottbarer Existenz bestimmter Ausdruck plötzlich verstummt: er ist versunken mit der Lage, die ihn erzeugte, er wird später einmal Zeugnis von ihr ablegen wie eine Versteinerung. So ist es dem Blitzkrieg ergangen und dem ihm zugeordneten Adjektiv schlagartig, so den Vernichtungsschlachten und den dazugehörigen Einkesselungen, so auch dem „wandernden Kessel“ – er bedarf schon heute der Kommentierung, daß es sich um den verzweifelten Rückzugsversuch eingekesselter Divisionen handelte […]. (Klemperer 1946/2007: 7 f.; Kursivierung von mir, Th.N.]
Hier wird deutlich, dass Klemperer Sprachwandelphänomene antizipiert. Er ist sich offensichtlich darüber im Klaren, dass die Verwendung und Nicht-Verwendung sprachlicher Ausdrücke immer auch durch die gesellschaftlichen Umstände mitbestimmt wird. Schließlich weist Klemperer auch schon darauf hin, dass eine isolierte Wortkritik wenig sinnvoll ist, da man „Wortwerte“ und „Worthäufigkeiten“ nur in (Kon-)Texten bestimmen kann. Ebenso lässt sich nur anhand konkreter Texte die spezielle Wirkung von Wörtern, ihre Rolle und Funktion analysieren:
Sondern der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang […] Worte können sein wie winzige Arsendosen: sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. […] Die nazistische Sprache weist in vielem auf das Ausland zurück, übernimmt das meiste andere von vorhitlerischen Deutschen. Aber sie ändert Wortwerte und Worthäufigkeiten, macht zum Allgemeingut, was früher einem Einzelnen oder einer winzigen Gruppe gehörte, sie beschlagnahmt für die Partei, was früher Allgemeingut war, und in alledem durchtränkt sie Worte und Wortgruppen und Satzformen mit ihrem Gift, macht sie die Sprache ihrem fürchterlichen System dienstbar, gewinnt sie an der Sprache ihr stärkstes, ihr öffentlichstes und geheimstes Werbemittel. (Ebd.: 26 f.)
Klemperer spricht deutlich an, dass es nicht nur eine kleine Clique von Machthabern ist, die diese Sprache spricht, sondern dass diese spezielle Sprache von einer Gruppen- zur Volkssprache wurde (vgl. Schiewe 1998: 213):
Durch die „Machtübernahme“ der Partei wurde sie 1933 aus einer Gruppen- zu einer Volkssprache, d.h., sie bemächtigte sich aller öffentlichen und privaten Lebensgebiete: der Politik, der Rechtsprechung, der Wirtschaft, der Kunst, der Wissenschaft, der Schule, des Sportes, der Familie, der Kindergärten und der Kinderstuben. (Klemperer 1946/2007: 31)
Dieses Diffundieren der Sprache in alle Lebensbereiche führt laut Klemperer dazu, dass schließlich auch der Sprachgebrauch aller Sprecher und damit auch ihr Denken beeinflusst wird:
Wenn einer lange genug für heldisch und tugendhaft: fanatisch sagt, glaubt er schließlich wirklich, ein Fanatiker sei ein tugendhafter Held, und ohne Fanatismus könne man kein Held sein. Die Worte fanatisch und Fanatismus sind nicht vom Dritten Reich erfunden, es hat sie nur in ihrem Wert verändert und hat sie an einem Tage häufiger gebraucht als andere Zeiten in Jahren. (Ebd.: 26; Kursivierung von mir, Th.N.]
Klemperer bemerkt, dass sogar die Unterdrückten selbst die offizielle Sprache annehmen und verinnerlichen und auf diese Weise auch dem nationalsozialistischen System Geltung verschaffen. In diesem Zusammenhang erwähnt er beispielsweise die perfide Unterscheidung von Volljuden, Halbjuden, Mischlingen ersten (und anderen) Grades, Judenstämmlingen und Privilegierten (vgl. ebd.: 227). Privilegierte waren Mitglieder jüdischer Arbeitsgruppen in Fabriken, die keinen Judenstern tragen mussten und nicht im Judenhaus wohnen mussten. Und natürlich führten diese Privilegien zu Streitigkeiten und Hass zwischen den nichtprivilegierten Juden und eben den Privilegierten. Dies ist ein besonders plastisches Beispiel dafür, wie die Sprache das Denken beeinflussen kann.
Klemperer – so lässt sich aus heutiger Zeit feststellen – war mit seinen Analysen seiner Zeit und wohl auch den Sprachkritikern der Nachkriegszeit voraus. Dass aber auch seine Beobachtungen Widersprüchliches offenbaren, hat Utz Maas (1984: 208 ff.) in einer wichtigen Untersuchung herausgearbeitet. Denn auch bei Klemperer finden sich Passagen, in denen er die Sprache des Nationalsozialismus als Gift, als Infektion des deutschen Volkskörpers usw. charakterisiert (vgl. ebd.: 215). Damit entsteht ein Topos, gegen den der Sprachwissenschaftler Maas sich mit Vehemenz wendet. Es entsteht so die Vorstellung einer kleinen Clique von perversen Nationalsozialisten, die es schafften, mithilfe der Macht des Wortes die Massen zu verführen und zu indoktrinieren. Dabei wird allerdings ausgeblendet, dass weite Teile der Bevölkerung ja zumindest keinen Widerstand geleistet hatten. Außerdem scheint es wenig plausibel, dass ein ganzes Volk den Propagandatricks einer kleinen Minderheit auf den Leim gegangen war.
Eine andere Sicht der Dinge als Klemperer vertraten Sternberger, Storz und Süskind in ihrem erstmals 1957 zusammenhängend veröffentlichten Wörterbuch des Unmenschen. Auf dieses Buch wird hier relativ ausführlich eingegangen, weil es sich dabei um eine folgenreiche Veröffentlichung der frühen Nachkriegszeit handelt, die auch für die deskriptive Linguistik und die Methoden der Politolinguistik von Bedeutung ist.9
Sternberger, Storz und Süskind wollten mit ihrem Wörterbuch vor allem nachweisen, dass das Vokabular der Nationalsozialisten inhuman sei. Durch seine „Ausmerzung“ versprachen sie sich, auch inhumane Denkweisen und aus ihnen resultierende Taten aus der Welt zu schaffen.
Das „Wörterbuch des Unmenschen“ war in der Zeitschrift „Die Wandlung“ bereits in den Jahren 1945/46 in fortlaufenden Artikeln erschienen und wurde 1957 erstmals in Buchform veröffentlicht. Man kann es als bundesrepublikanisches Pendant zu Klemperers LTI lesen (vgl. Schiewe 1998: 227). Schaut man sich die einzelnen Artikel an – das Buch enthält tatsächlich wie ein Wörterbuch Wortartikel in alphabetischer Reihenfolge –, dann ist man zunächst über die Auswahl erstaunt: Betreuung, durchführen, intellektuell, Kontakte, Gestaltung, Härte, organisieren sind Stichwörter, die in diesem Buch behandelt werden. Heutzutage verbinden wir diese Wörter nicht mit nationalsozialistischer Ideologie: Wir können eine Maßnahme durchführen, Kontakte pflegen, eine Veranstaltung organisieren usw. und finden an diesen Ausdrucksweisen nichts Unmenschliches. Andererseits fällt auf, dass Vokabeln, die wir auch heute noch für ideologisch belastet halten, wie z. B. Arier, Rasse, Blut und Boden, in diesem Wörterbuch nicht als Stichwörter verzeichnet sind.
Sternberger, Storz und Süskind hatten jedenfalls ein sehr ehrenwertes Anliegen, und zwar formulieren sie es in einer „Vorbemerkung“ zu ihrem Wörterbuch so:
So hat der Mensch auch als Unmensch seinen Wortschatz, seine eigentümliche Grammatik und seinen eigentümlichen Satzbau. Wir wollen hier seinem Wortschatz nachspüren und in der Sprache jeweils der Sache auf die Sprünge kommen, die sie bedeutet. […] Dieses Wörterbuch hat eine Aufgabe, die derjenigen der übrigen und gewöhnlichen Wörterbücher genau entgegengesetzt ist: es soll uns diese Sprache fremd machen… (Sternberger/Storz/Süskind 1957/1986: 7)
Es geht in diesem Buch also um den Wortschatz, es geht um Wörter. Sternberger, Storz und Süskind haben eine zentrale These, die ihrem Wörterbuch zugrunde liegt. Sie lautet: Wörter sind nicht unschuldig. So schreiben sie etwa über das uns heute unverdächtig klingende Wort Lager:
Das Wort „Lager“, so harmlos es einmal war und wieder werden mag, können wir doch auf Lebenszeit nicht mehr hören, ohne an Auschwitz zu denken. (Ebd.: 11 f.)
Diese These, mit der eigentlich das ganze Buch steht und fällt, ist eine ziemlich weitreichende. Möglicherweise fällt uns, die wir alle nicht persönlich den Nazi-Sprachgebrauch erleben mussten, die Beurteilung einer solchen These nicht besonders schwer. Denken wir tatsächlich an die Vernichtungslager in Auschwitz (und anderswo), wenn wir das Wort Lager hören? Dies können wir wohl – zumindest für die heutige Zeit – ausschließen. Selbst die im Zitat gemachte zeitliche Einschränkung („auf Lebenszeit“) verliert an Gewicht, wenn man bedenkt, dass bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts der Ausdruck Endlösung unbefangen im politischen Kontext der Abstimmung über das Saarstatut als neutrale Vokabel verwendet wurde (vgl. Eitz/Stötzel 2007: 169 ff.).
Ähnliches gilt für Wörter wie Raum, gestalten und durchführen, die in diesem Kontext auch genannt werden (vgl. Sternberger/Storz/Süskind 1957/1986: 11). Offensichtlich ist auch, dass Wörter wie Endlösung oder Sonderbehandlung (beides NS-Euphemismen für den Genozid an den europäischen Juden) heute und in Zukunft wieder verwendet werden können, ohne dass Assoziationen an den NSSprachgebrauch aufkommen oder gar ein Proteststurm losbricht. Ein nur flüchtiger Blick in die Presse macht dies deutlich. So berichtet beispielsweise Focus Online am 8. September 2010 über eine „Sonderbehandlung für Paris Hilton“10, während in der Online-Ausgabe der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG am 7. April 2011 ein „Jungenforscher“ gefragt wird: „Brauchen Jungen eine Sonderbehandlung?“11
Es scheint demnach zuzutreffen, „dass viele Wörter, die in der öffentlichen Sprachdiskussion als NS-Wörter fest etabliert waren, inzwischen von großen Teilen der Bevölkerung unbefangen verwendet werden“ (Dieckmann 2012: 156). Die These, dass Wörter nicht unschuldig seien – man kann sie in einem Atemzug mit der manchmal formulierten These nennen, dass Wörter „lügen“ können –, scheint uns heute kaum haltbar. Zumindest in gehörigem zeitlichem Abstand scheint es mehr oder minder unproblematisch, auch „belastete“ Vokabeln in entsprechenden Kontexten ohne politische Assoziationen zu verwenden.
Vor der Kritik an der Vorgehensweise des Wörterbuchs des Unmenschen soll jedoch die Herangehensweise der Autoren etwas ausführlicher dargestellt werden. Sternberger, Storz und Süskind gehen davon aus, dass es verschiedene Kategorien von Wörtern gibt, und zwar (vgl. Sternberger/Storz/Süskind 1957/1986: 11 f.):
– von Haus aus harmlos, aber den Unmenschen dienlich: Raum, Lager
– geschichtlich bedeutungsträchtige Wörter, die von der Sprachgemeinschaft verraten wurden: intellektuell, Intellektuelle, Anliegen, Problem
– Neu- und Missbildungen sowie Umdeutungen: Menschenbehandlung, Ausrichtung, charakterlich, Kulturschaffende
– Wörter, die für unmenschlichen Gebrauch prädestiniert scheinen: betreuen.
Exemplarisch für die Vorgehensweise der Autoren können die Bemerkungen zum Wort betreuen stehen:
[…] Dieses „be-“ drückt nicht bloß ein selbstloses Hinzielen auf den Gegenstand aus wie die einfachen Transitiva „lieben“ und „schützen“, sondern eine Unterwerfung des Gegenstands, und darauf kommt es an. Dieses „be-“ gleicht einer Krallenpfote, die das Objekt umgreift und derart erst zu einem eigentlichen und ausschließlichen Objekt macht. Muster und Vorgänger sind: Beherrschen und Betrügen, Beschimpfen und Bespeien, Bestrafen, Benutzen, Beschießen, Bedrücken, auch Belohnen und Beruhigen. In allen diesen Fällen wird das Objekt, eben der Jemand, mindestens zeitweilig des eigenen Willens beraubt oder soll des eigenen Willens beraubt werden oder hatte seine Freiheit schon verloren […] (Sternberger/Storz/Süskind 1957/1986: 31 f.)
Es hat nicht lange gedauert, bis sich auch Sprachwissenschaftler zu den Thesen von Sternberger, Storz und Süskind geäußert haben. Diese Kontroverse zwischen Sprachkritikern und Sprachwissenschaftlern ist über viele Jahre geführt worden und hat schließlich sozusagen zum „Abbruch der Beziehungen“ geführt.
Sehen wir zunächst einmal, was aus linguistischer Sicht zum Befund, den wir dem Wörterbuch des Unmenschen entnehmen können, zu sagen ist. (Nur am Rande sei dazu angemerkt, dass mit einer linguistischen Kritik natürlich nicht die zweifellos ehrenwerten Motive der damaligen Sprachkritiker infrage gestellt werden können. Allerdings dürfen auch honorige Motive nicht dazu führen, dass die sachlich-methodischen Gesichtspunkte nicht mehr offen diskutiert werden können.)
Linguisten würden gegenüber dem Wörterbuch des Unmenschen betonen, dass man Wörtern nicht vorwerfen kann, dass sie unmenschlich etc. seien. Zweifelsohne können mit bestimmten Vokabeln unmenschliche Handlungen kaschiert, beschrieben oder auch ausgeführt werden. Aber es sind doch immer die Sprecher, die sich dieser Wörter bedienen, um zu verurteilen, zu morden oder auch zu beschützen und zu retten. So kennen wir alle das Phänomen, dass Wörter sozusagen durch unmenschlichen Gebrauch kontaminiert, belastet sind – etwa im Deutschen das Wort Führer oder auch Konzentrationslager. Diese Ausdrücke verbinden wir mit dem nationalsozialistischen Regime und seiner Politik, eben weil sie von dem entsprechenden Personenkreis immer wieder verwendet wurden. Deshalb werden sensible Sprecher auch heute noch sehr vorsichtig mit der Verwendung solcher Wörter sein, und es ist auch kein Zufall, dass niemand auf die Idee gekommen ist, beispielsweise Asylbewerberheime als Konzentrationslager zu bezeichnen – außer in polemischer Absicht. Trotzdem wird man festhalten müssen, dass man den Vokabeln als solchen keine Attribute wie unmenschlich oder lügnerisch bescheinigen kann – diese Eigenschaften kommen allenfalls den jeweiligen Sprechern zu, wenn sie solche Ausdrücke zur Verschleierung ihrer Machenschaften verwenden.
Eine andere Kritik hat bereits in den 60er Jahren der Germanist Herbert Kolb unter dem Titel „Der inhumane Akkusativ“ vorgebracht. Auch diese Kritik ist in den neueren Auflagen des Wörterbuchs des Unmenschen abgedruckt. Sie soll hier wiederholt werden, weil sie auf eine Gefahr aufmerksam macht, der Linguisten auch heute noch ausgesetzt sind, der Gefahr nämlich, anhand von Beispielen gleich eine linguistische Theorie zu entwerfen. Häufig stellt sich jedoch schnell heraus, dass es genauso viele Gegenbeispiele gibt, die die schöne eigene Theorie widerlegen.
Die Theorie aus dem Wörterbuch sagte ja nichts weniger aus, als dass die sogenannten be-Verben, die ein Objekt im Akkusativ fordern, eben dieses Objekt in ein Unfreiheits-Verhältnis setzen. Die Beispiele machten dies ja auch mehr oder minder (bei belohnen und beruhigen) plausibel.
Kolb schreibt zu dieser These:
Ein Vorzug der be-Verben liegt darin, daß sie die Nennung der (akkusativierten) Person verlangen, die der präpositional damit verknüpften (,instrumentalisierten‘) Sache aber freistellen. Man kann sagen: er beliefert die Kundschaft – und muß nicht sagen: er beliefert die Kundschaft mit Ware; man kann sich begnügen mit der Angabe: er beschenkte seine Kinder – und braucht nicht hinzuzufügen: …mit Spielzeug. […] Möchte man also das sachliche Objekt nicht benennen oder hält man seine Nennung für überflüssig, so ist man geradezu auf das be-Verb angewiesen. Und diese Fälle sind beim Sprechen, in der gesellschaftlichen Konversation, im diskreten Mitteilen gewiß zahlreich, daß ich ausdrücken möchte, daß ich liefere und wem ich liefere, aber nicht, was ich liefere; daß ich schenke und wem ich schenke, nicht aber, was ich schenke. (Sternberger/Storz/Süskind 1957/1986: 236 f.)
Kolb (ebd.: 245) gelangt zu dem Schluss, dass der Akkusativ weder inhuman noch human sei, sondern lediglich eine grammatische Form,
die von human und inhuman Gesinnten gebraucht werden kann. Sogar die akkusativierenden be-Bildungen sind so wenig inhuman, wie es inhuman ist, die Gefangenen zu befreien, die Schwachen zu beschützen, die Nackten zu bekleiden.
Dem ist aus Sicht der deskriptiven Linguistik nicht viel hinzuzufügen. Gerade im letzten Zitat finden wir die Quintessenz, die man als Linguist einer solchen Art der Sprachkritik entgegenhalten muss: Die verschiedenen grammatischen Formen wie auch verschiedene Ausdrücke sind nicht als solche inhuman oder human, sie werden lediglich von entsprechend gesinnten Sprechern in entsprechender Weise verwendet.12 Dazu – das sei am Rande noch angemerkt – kann die Politolinguistik allerdings nicht mehr viel beitragen: Wenn jemand durch seinen Sprachgebrauch bewusst verletzen, beleidigen oder erniedrigen möchte, dann kann die deskriptive Linguistik das beschreiben. Inwieweit die danach anstehende moralische Bewertung noch mit Mitteln der Linguistik bzw. einer linguistisch begründeten Sprachkritik erfolgen kann, wird durchaus kontrovers diskutiert (vgl. Janich 2013).
Die frühen Arbeiten zur NS-Sprache genügen trotz ihrer ehrenvollen Motive aus heutiger Sicht nicht den methodischen Standards der deskriptiven Linguistik.
2.4.2 Die Sprache der NS-Zeit in neueren politolinguistischen Studien
In den neueren Arbeiten zur Sprache des Nationalsozialismus wird die in den vorigen Abschnitten beschriebene sprachkritische Haltung zunehmend durch eine sprachwissenschaftliche Haltung abgelöst. Es gibt sowohl Wörterbücher wie auch Textanalysen, die sprachwissenschaftlichen Standards zu genügen versuchen.
Zunächst zu nennen ist das von Cornelia Schmitz-Berning (2000) verfasste große Wörterbuch „Vokabular des Nationalsozialismus“. Hier wird die Zeit von 1918 bis 1945 in Wörterbuchartikeln erfasst. Schmitz-Berning macht deutlich, dass es nicht ohne Weiteres gelingen kann, zwischen der offiziellen und der privaten Sprache in der Zeit des Nationalsozialismus zu unterscheiden. Dies liegt daran, dass dem NS-Regime in besonderer Weise daran gelegen war,
auch den Raum der Nichtöffentlichkeit organisatorisch und ideologisch zu durchdringen. Die Reichweite der offiziellen Sprache ging daher weit über die Verwendung in Reden der Parteioberen und Funktionäre, in Verordnungen, Gesetzen, Presseanweisungen, Rundfunksendungen und Zeitungen hinaus (ebd.: IX).
Dies zeigt sich an der Vielzahl von Organisationen, Schulungen und Betreuungen der Bevölkerung, die auch den Freizeit- und Feierabendbereich abdeckten. Auf Grundlage einer Vielzahl von Quellen (vgl. ebd.: X ff.) unterscheidet Schmitz-Berning drei Typen von Wörtern:
1. Wörter, die von Nationalsozialisten neugeprägt wurden
2. Wörter, die umgedeutet wurden oder eine zusätzliche spezifische Bedeutung erhielten
3. Wörter, die sehr häufig verwendet wurden und durch die hohe Gebrauchsfrequenz ihren hohen Stellenwert im NS-Sprachgebrauch signalisierten. (Schmitz-Berning 2000: XIV f.)
Als besonders interessantes Ergebnis lässt sich festhalten, dass die wenigsten „NS-Wörter“ Neuprägungen sind. So würde man vermutlich intuitiv Wörter wie fremdblütig, Nichtarier, Rassenpflege oder Überfremdung für Ausdrücke halten, die von den Nationalsozialisten geprägt worden sind. In Wirklichkeit können sie alle jedoch schon in der Kaiserzeit nachgewiesen werden, wo sie in den entsprechenden völkisch orientierten Kreisen verwendet wurden (vgl. ebd.: XVI). Und offensichtlich gibt es Wörter, die wir heute trotz ihrer historischen Belastung wieder verwenden, ohne an ihre Rolle im NS-Sprachgebrauch zu denken. Dies zeigt sich am berühmten Beispiel betreuen, das uns bereits im Wörterbuch des Unmenschen begegnet ist. Schmitz-Berning (ebd.: 89 ff.) stellt zunächst kurz die Wortgeschichte seit dem Mittelalter dar. Für die NS-Zeit stellt sie – in Übereinstimmung mit Klemperer – eine auffällige Frequenzsteigerung fest. Diese erklärt sie dadurch, „daß betreuen im hierarchisch durchorganisierten NS-Staat einheitliche Bezeichnung für die unterschiedlichen Formen der Beziehung zwischen ↑dem Führer, Führern und Geführten wurde. Die drei Grundtypen der Betreuung: fürsorgerische Betreuung, politische Betreuung, kulturelle Betreuung schlossen immer ↑weltanschauliche Schulung und ↑Ausrichtung ein.“ (Ebd.: 90) Für die heutige Zeit heißt es dann:
In der heutigen Sprache sind betreuen, Betreuung nahezu universell verwendbare Ausdrücke zur Bezeichnung von vorsorgender, pflegender, beratender, unterweisender, beaufsichtigender, verwaltender, steuernder, regelnder Tätigkeit von Einzelpersonen, häufiger noch von Organisationen und Behörden, in bezug auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Verhaltensweisen, Sachen und Sachgebiete und gelten deshalb als Modewörter. (Ebd.: 93)
Universelle Verwendbarkeit und Ökonomie sind nach Schmitz-Berning also die wesentlichen Gründe dafür, dass betreuen dazu dient, „die unterschiedlichsten Formen der Zuwendung“ zu benennen, „ohne daß der Grad der möglicherweise mitgemeinten organisatorischen Regelung oder Bevormundung beschrieben werden muß […]“ (ebd.: 94). Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, dass im BGB 1992 Entmündigung durch Betreuung ersetzt wurde, in der Hoffnung, das negativ konnotierte Wort Entmündigung durch ein „neutrales“ Wort zu ersetzen. In einem juristischen Kommentar hieß es dazu: „Es bleibt abzuwarten, wann die neuen termini ‚Betreuung‘ und ‚Einwilligungsvorbehalt‘ so weit in das allgemeine Bewußtsein gelangt sein werden, daß von ihnen die nämliche Negativwirkung ausgeht wie vom terminus Entmündigung.“ (Ebd.: 94) Dies mag als Beispiel dafür genügen, wie die neuere Forschung, wenn sie sich auf Einzelwörter bezieht, mit solchen Phänomenen umgeht. Der Unterschied zur moralisierenden Sprachkritik der Nachkriegsjahre dürfte deutlich geworden sein.
Das Werk von Schmitz-Berning und weitere neuere Untersuchungen brachten folgende, besonders charakteristische Sprachstrategien im Nationalsozialismus zutage (vgl. Stötzel/Wengeler 1995: 364 f.):
Aufgewertet wurden bestimmte Wörter bzw. die mit ihnen bezeichneten Verhaltensweisen: hart, fanatisch, blindlings. Abgewertet wurden dagegen: demokratisch/Demokratie, objektiv, intellektuell, individuell/Individualismus.
Als ausschließliche Selbstbezeichnungen beanspruchten die Nazis: Führer, Propaganda (vs. Greuelhetze), Reich, Parteigenosse, Parteikongreß. Als positive Hochfrequenzwörter galten: Volk, Rasse, Art, Blut, Raum, Arbeit, Leistung. Pejorisierungen wurden häufig durch die Wiederholung stereotyper Eigenschaftszuweisungen erreicht: Jude = gerissen, feige, plattfüßig, krummnasig etc. Menschen und Menschengruppen wurden undifferenziert in positiv und negativ eingeteilt durch die stereotype Wiederholung von dualistischen Paradigmen: arthaft, volkhaft, artfremd, blutsfremd, volksfremd, rassefremd, fremdblütig, fremdrassisch, Fremdvölker etc. Charakteristische Wortbildungsmittel waren Präfixe, die Verläufe und Verlaufsvollzüge bezeichnen: ent- (entjuden, entnorden), ver- (verjuden, vernegern) auf/ab- (-norden, -juden, -rassen). Der Konditionierung von Fremdenhass dienten Metaphern aus dem Bereich der Medizin oder Schädlingsbekämpfung. So wurde Geschlechtsverkehr zwischen sogenannten Ariern und Nicht-Ariern als Blutvergiftung metaphorisiert, Juden als Parasiten oder Schädlinge bezeichnet.
Die bereits erwähnte Studie von Maas aus dem Jahre 1984 trägt den Titel: „Als der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand. Sprache im Nationalsozialismus.“ Maas empfiehlt, die Texte des Nationalsozialismus als polyphone Texte zu lesen, die jeweils vor dem spezifischen gesellschaftlichen und historischen Hintergrund zu interpretieren sind. Damit soll einer Lesart vorgebeugt werden, die einer politischen Clique oben das verführte Volk unten gegenüberstellt. Der nationalsozialistische Diskurs wird so zu einer
Fähre, die die Menschen von ihren konkreten Erfahrungen, ihren Hoffnungen und Ängsten, aber auch ihrem opferbereiten Elan in die integrativen Organisationsformen des Machtapparates transportierte – und auf der anderen Seite, im gleichen Diskurs, den Terror inszenierte, der alle die traf, die sich der Integration verweigerten (Maas 1984: 11).
Wie funktionierte dies konkret? Ein kleines Beispiel kann dies gut verdeutlichen. Im Jahre 1937 wurde ein Aufruf des Reichsnährstandes verbreitet (vgl. Maas 1984: 21 ff.). Er lautete folgendermaßen:

Abb. 4: Aufruf des Reichsnährstandes (Maas 1984: 12)
Zur Sicherung der deutschen Brotversorgung:
Tauscht Roggen gegen Futtermittel!
| Warum? | Aller mahlfähiger Roggen dient der Brotversorgungund gehört nicht in den Futtertrog. Wer Brotgetreide verfüttert, begeht Landesverrat (Hermann Göring auf dem Reichsbauerntag 1936) |
| Was? | Roggen wird getauscht gegen: Gerste, Mais, Maisfuttermehl; auf Wunsch gegen Kleie oder vollwertige Zuckerschnitzel. |
| Wie? | Der Eintausch erfolgt schlicht um schlicht, d.h. für die gleiche Menge Roggen gibt es die gleiche Menge Futtermittel. Dabei werden Gerste und Mais zum Roggenerzeugerfestpreis, Kleie zum reinen Kleiefestpreis, Maisfuttermehl zum Preise von 7,50 RM pro Zentner und vollwertige Zuckerschnitzel zum Preise von 6,- RM pro Zentner sämtlich frei Eisenbahnempfangsstation geliefert. |
| Wann? | Ab sofort. |
| Wer? | Es muß jeder, der Roggen noch zur Verfügung hat, eintauschen. Er ist dazu jedoch erst berechtigt, wenn er sein Roggenablieferungssoll voll erfüllt hat. |
| Wo? | Der Eintausch erfolgt durch Abschluß eines Erzeuger-Tauschvertrages mit Deinem gewohnten Verteiler (Händler oder Genossenschaft). Du mußt Dich an ihn wenden.Deine zuständige Kreisbauernschaft wird Dir die vollständige Erfüllung Deines Ablieferungssolls und damit Deine Berechtigung zum Eintausch an Hand der vorhandenen Unterlagen bescheinigen. |
| Bediene Dich also dieser Möglichkeit des Eintausches! | |
| Du erfüllst damit Deine Pflicht gegenüber dem Volksganzen! | |
Wie kann dieser Text interpretiert werden? Maas plädiert für ein Vorgehen bei solchen Textanalysen, das jeweils vier bzw. fünf Schritte umfasst. Eine solche „Formalisierung des Vorgehens“ (ebd.: 17) sorge dafür, dass eine linguistische Analyse stattfinden könne, „statt nur assoziativ wertend zu denunzieren“ (ebd.). Die Schritte, die Maas zur Analyse vorschlägt, beziehen sich auf (vgl. ebd.: 18):